|
Die Geologie |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Zeiten, wo man auf gut Glück ein Loch in den Berg baut und
dabei herausfindet, was sich seit der letzten Sprengung im Gestein
veränderte, waren seit dem Bau der
Gotthardbahn vorbei. Man war sich der geologischen Vielfältigkeit
des Landes bewusst und daher gehörte es bereits um 1900 zum guten Tone,
wenn entsprechende Gutachten vor dem Bau eingeholt wurden. Daher
existierte beim Lötschbergtunnel ein entsprechendes Gutachten.
Beim
Gotthardtunnel
hatte man bei der Unterquerung der Ursenenmulde grosses Glück, musste aber
wegen dem Wasser führenden Gestein mit grossen Problemen kämpfen. Die
Folge der unerfahrenen Mannschaft war, dass hier sehr viele Opfer zu
beklagen waren. Es war klar, solche Probleme sollte es beim Bau des
Scheiteltunnels
am Lötschberg nicht mehr geben. Schliesslich hatte man aus den Erfahrungen
Lehren gezogen.
Mittlerweile hatten die Fachleute auch gelernt, die Oberfläche zu
betrachten und damit den Untergrund in diesem Bereich zu erahnen. Dabei
waren die Gesteine und deren Eigenschaften bei der Bearbeitung bekannt.
Mit diesem Wissen konnten passende
Baumaschinen
beschafft und die Baukosten berechnet werden. Beim Lötschbergtunnel wusste
man daher, was wo für ein Gestein angetroffen werden muss. Eine
Einschätzung war daher leichter möglich.
Erstellt wurde das geologische Gutachten bereits um 1900. Beim
erbitterten Kampf um die richtige Streckenführung waren solche Gutachten
und die dank diesen erwarteten Nachteilen natürlich hervorragende
Argumente. Jedoch hatten die meisten Leute, die Entscheide fällen mussten,
keine Ahnung was nun wo für ein Stein zu finden war. Es waren Berge und
diese sind bekanntlich hart und wo soll es da Probleme geben.
Geologisch gesehen, waren die Alpen sehr unruhig. Die Faltung des
Gebirges hatte zur Folge, dass die Gesteine in mehreren Gebieten
durchmischt waren. Diese Gebiete entstanden, als die tief liegenden
Granite nach oben gedrückt wurden und sich das andere Gestein
zusammenschieben musste. Im hochalpinen Bereich der Alpen sind diese
Schichten abgetragen worden, so dass dort die Granite der vielen Massive
erkannt werden konnten.
Gesteine anhand der Oberfläche zu bestimmen, war und ist keine
leichte Sache. Mit jedem neuen
Tunnel,
der gebaut wurde, lernte man dazu und konnte bessere Einschätzungen
vornehmen. Zudem waren seit 1900 auch erste geologische Karten der Schweiz
erstellt worden. Diese basierten jedoch auch auf den oberflächigen
Betrachtungen der Gesteine und Felsen. Damals konnte man noch nicht mit
seismischen Untersuchungen in den Berg sehen.
Dort wurde von der EGL der Kilometer null fest-gelegt und daher war diese Richtung bei jeder Ar-beit vorhanden.
Es entstand so ein Gutachten für eine Länge von rund 14 Kilometer.
Kleinere Differenzen lassen wir hier noch weg, denn letztlich endete der
Tunnel. Gleich bei Beginn der Bauarbeiten erwartete die Mannschaft auf der nördlichen Seite relativ unruhi-ges Gestein. In mehreren Faltungen wechselte sich kräftiger Jurakalk und problematischer Schiefer ab.
Diese Formation war eine Folge der Alpenbildung und daher in
diesem Bereich nicht selten anzu-treffen. Anhand der Gesteinslinien konnte
jedoch während des Baus gut abgeschätzt werden, wie sich die Fortsetzung
darstellen liess.
In Faltungen entstanden aber auch Hohlräume und Schichten, die
Wasser führen konnten. Gerade in oberflächennahem Gestein, waren
Schichten, die Wasser führten oft anzutreffen. Im nördlichen Teil hatte
man jedoch den Vorteil, dass in diesem Bereich sehr schnell Kalksteine
angetroffen wurden. Diese waren selber selten mit Wasser durchsetzt,
jedoch deren Schnittstellen. Daher erwartete man hier keinen leichten
Start des Baus.
Während der Kalkstein leicht zu bearbeiten war und relativ stabil
ist, mussten beim Schiefer spontane Abplatzungen von Gestein und Bergdruck
erwartet werden. Auf Grund der Erfahrungen beim
Gotthardtunnel
wusste man, dass die Durchquerung von Schiefer schwierig war. Die Geologen
empfahlen daher in diesen Zonen sehr kräftige Abstützungen um den
Bergdruck abfangen zu können. So sollten die gefürchteten Abplatzungen
vermieden werden.
Nach diesem unbequemen Gestein, das nach etwa drei Kilometer von
einer veränderten Schicht Schiefer abgelöst werden sollte, folgte eine
erste kritische Stelle. Dabei sollte das Gasterntal, analog zur
Ursenenmulde unterquert werden. Dabei lag dieses Tal rund 100 bis 200
Meter über der Tunnelachse. Eine Begehung des Gasterntals sollte Klarheit
über diese sehr knappe Überdeckung geben und so wichtige Hinweise bringen.
Das Gasterntal erstreckte sich hinter einem Bereich, der Klus
genannt wurde. Die Einschätzung der Geologen ging davon aus, dass es sich
um ein Tal handelte, das von Gletscher geschaffen wurde und daher eine
flache runde Mulde bildete. Aus diesem Grund sollte das Sediment nicht bis
zur Tunnelachse reichen. Die Mineure mussten jedoch mit vermehrten
Wassereinbrüchen im Schiefergestein erwarten. Es sollte keine leichte
Passage werden.
Mit Sondierbohrungen hätten hier im Vorfeld Abklärungen angestellt
werden müs-sen. Nur schon die geringe Überdeckung hätten diese Massnahme
erforderlich gemacht. Dann wäre erkannt worden, dass die
Achse
direkt durch die Sedimente geführt hätte. Vielmehr wurde am 24. Juli 1908 das Sediment des Gasterntals angestochen. In der Folge ergoss sich das Sediment in den Richtstollen und füllte diesen in wenigen Sekunden auf. An der Oberfläche entstand ein grosser Krater.
Doch was war von der geologischen Seite her falsch gelaufen? Eine
solch gravierende Fehleinschätzung durfte eigentlich nicht passieren.
Jedoch war das Gasterntal damals wirklich schwer einzuschätzen.
Die Klus bildete einen Riegel, der durch einen Bergsturz
entstanden war. Dahinter begann sich das Tal aufzufüllen. Dadurch wurde
verdeckt, dass das Tal seinerzeit nicht durch Gletscher geformt wurde,
sondern die Gesteine in diesem Bereich von der Kander über viele Jahre
angetragen wurden. Dadurch entstand kein flacher Trog, sondern ein tiefes
Tal in Form eines V. Die nachträglich von der EGL angestellten
Sondierbohrungen brachten das an den Tag.
Das Sediment reichte an der tiefsten Stelle bis hinunter auf rund
1000 Meter über Meer. Damit befand sich der harte Fels nicht im Bereich
der Tunnelachse, sondern etwa 200 Meter weiter unten. Diese Feststellungen
legten aber auch zu Tage, dass das oberflächliche Gelände der beiden
Seiten innerhalb des Sedimentes weiter geführt wurde. Genau dieser Punkt
sollte bei der rechtlichen Aufarbeitung des Fehlers zu Diskussionen
führen.
Sedimente, wie jene im Gasterntal konnten mit den damaligen
Mitteln mit einer oberflächigen Betrachtung schlicht nicht geschafft
werden. Selbst mit den heute üblichen modernen Baumethoden sind Sedimente
schwer zu bestimmen und zu durchqueren. Ein Schlagwort der neueren Zeit
war sicherlich die Pioramulde, die es zu sehr viel Präsenz in der Presse
brachte. Aber auch Bauten im Raum Zürich mussten durch Sedimente geführt
werden.
In den meisten Fällen gelingt dies Heute nur, wenn das Sediment
mit dem Wasser gefroren wird. Dann kann der Bereich einfach bearbeitet
werden. Anschliessend wird die Abdichtung vorgenommen. Der letzte Schritt
ist das Auftauen des Sediments. Um 1900 kannte man diese Methoden schlicht
nicht und Sedimente, waren nicht zu bewältigen. Wer diese antrifft hat ein
grosses schwer zu lösendes Problem und der Bau ist gefährdet.
Wie sich diese Störzone im Jahre 1908 auf den Richtstollen
auswirkte, werden wir in einem anderen Kapitel näher betrachten. Im
Gutachten wurde die Breite mit diesem kritischen Gestein auf lediglich 500
Meter geschätzt. Eine Distanz, die nicht sehr gross war, aber sicherlich
eine schwere Passage darstellen sollte. Man verwies hier auf die grossen
Probleme beim Bau des
Gotthardtunnels,
wo es in einer solchen Zone viele Opfer gab.
Nach diesem Bereich mit einer Störzone konnten im Gasternmassiv
kräftige Granite erwartet werden. Diese Granite waren hart, jedoch schwer
zu bearbeiten. Gerade der Bau des
Gotthardtunnels
bekam finanzielle Probleme, weil man diese Gesteine unterschätzt hatte.
Der Gasterngranit war dabei nicht ganz so alt und kräftig, wie jener am
Gotthard, trotzdem war er stabil genug um einen
Tunnel
aufnehmen zu können.
Die Erfahrungen beim Bau des
Gotthardtunnels
mit der Bearbeitung der sehr stabilen Granite des Gotthardmassivs flossen
hier in den Bau ein. So waren Maschinen vorhanden, die dieses Gestein
bearbeiten konnten. Ein Vorteil des deutlich späteren Baus dieses
Tunnels.
Auch die Berechnung des benötigten Sprengstoffes wurde anhand dieses
Gutachten ausgeführt. Die Härte der Steine hatte einen direkten Einfluss
auf den Sprengstoff.
Auf etwa sieben Kilometern erwartete man das harte und stabile
Granitgestein des Gasternmassivs. Hier war kaum Bergdruck zu erwarten, so
dass man bei den Abstützungen weniger Aufwand zu betrieben hatte. Somit
war rund die Hälfte des Lötschbergtunnels in diesem guten Gestein. Ein
Vorteil der meisten
Tunnel
im alpinen Bereich waren diese Massive, die wirklich kaum Probleme
bereiteten. Auch der
Gotthardtunnel
profitierte von diesen Bereichen.
Zudem wurde auf Grund der Erfahrungen beim Gotthard im
oberflächigen Bereich mit Schichten gerechnet, die Wasser führen konnten.
Jedoch hatte die Mannschaft auch die entsprechenden Erfahrungen. Ein weiterer wichtiger Punkt, war die Überdeckung. Jene des Gasterntals, die eine minimale Überdeckung ergab, haben wir schon kennen gelernt. Die höchsten Gipfel reichten im Berner Oberland bis fast auf 4000 Meter über Meer.
Daher musste mit hohen Werten gerechnet werden. Dabei gilt, dass
bei hohen Überdeckungen die Gefahr von Steinschlag im
Tunnel
zunimmt. Je mehr Gewicht auf dem Tunnel lastet, desto schlimmer ist der
Bergdruck.
In den Bereichen mit Schiefer wurden vom
Tunnel
einige Bergspitzen passiert. Dazu gehörten jedoch nicht die höchsten
Gipfel. Die Höhen der Spitzen betrugen dabei zwischen 2 200 und 2 600
Meter über Meer. Hier war daher eine maximale Überdeckung von 1 400 Meter
vorhanden, was keine zu grossen Probleme erwarten liess. Trotzdem es war
Schiefergestein, welches auch bei diesen Differenzen zu hohem Bergdruck
neigte.
Schiefer ist ein Gestein, das sich leicht spalten lässt und dabei
flache Flächen bildet. Bekannte Anwendungen für Schiefer sind die damit
aufgebauten Schreibtafeln. Je nach Schichtung, können daher im Stollen
Platten spontan abbrechen. Es kann aber auch zu Verschiebungen kommen.
Dadurch kann der Bergdruck den Stollen einfach wieder auffüllen. Auch das
geschieht in vielen Fällen sehr spontan, so dass eine grosse Gefahr
besteht.
Die maximale Überdeckung erreichte der
Tunnel
im Bereich des Hockenhorns und damit nahezu in der Mitte des Tunnels.
Dieses hatte eine Höhe von 3 292 Meter über Meer und stellte den höchsten
Punkte über der Tunnelachse dar. Damit stieg die Überdeckung auf Werte von
rund 2 100 Meter an. Da sich diese jedoch im massiven Felsen des
Gasternmassiv befand, konnten geringe Probleme mit dem Bergdruck erwartet
werden. Ein Vorteil dieses harten Gesteins.
Es bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, dass immer vom
Lötschbergtunnel gesprochen wurde, es jedoch keinen Berg mit gleichem
Namen gab. Lötschberg war ein Gebiet im Bereich des Lötschenpasses. Es
wurde zur Wahl des Namens genommen. Eine spezielle Geschichte war, dass
sich der
Scheiteltunnel
und der spätere
Basistunnel
genau in diesem Gebiet kreuzen sollten. Daher ein gut gewählter Name für
den Lötschbergtunnel.
Abschliessend kann gesagt werden, dass das geologische Gutachten
beim Lötschberg sehr gut war und es wirklich nur einen folgenschweren
Fehler gab. Man hatte seit dem Bau des
Gotthardtunnels
in diesem Bereich bereits grosse Fortschritte gemacht und konnte diese nun
nutzen. Jedoch bestätigte der Löschbergtunnel auf tragische Weise, dass
solche Gutachten nicht immer zuverlässig erstellt werden können. An diesem
Grundsatz hat sich eigentlich bis heute nicht viel geändert.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
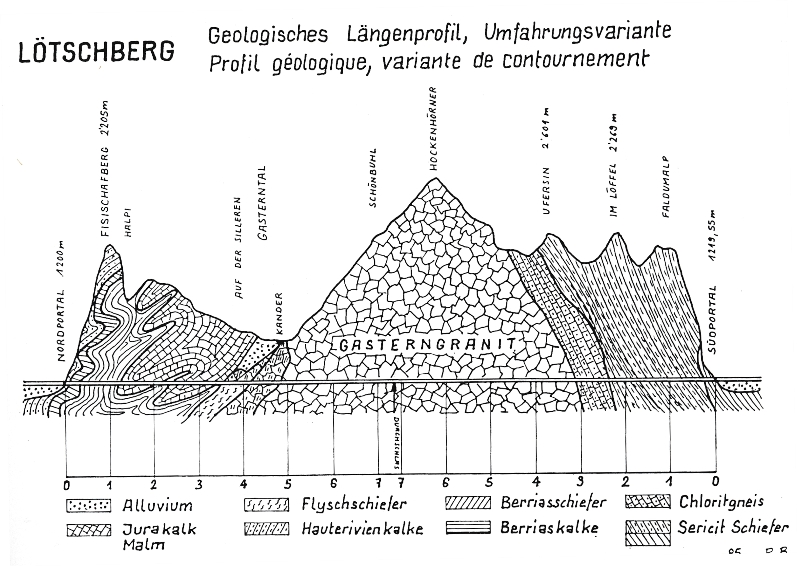 Beginnen
wir mit der Betrachtung des geologischen Profils des Lötschbergtunnels.
Dieses wurde auf die Länge beschränkt und begann auf der nördlichen Seite.
Beginnen
wir mit der Betrachtung des geologischen Profils des Lötschbergtunnels.
Dieses wurde auf die Länge beschränkt und begann auf der nördlichen Seite.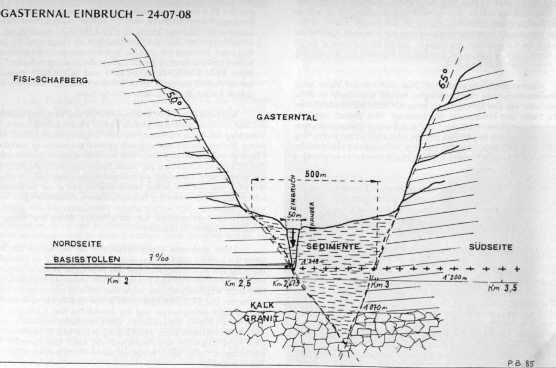
 Abgeschlossen
wurden die Granite jedoch nicht erst beim südlichen
Abgeschlossen
wurden die Granite jedoch nicht erst beim südlichen