|
Die Geologie |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Geologie ist ein Thema, das eigentlich
immer nur Überraschungen bereithalten konnte und kann. Gerade im späten
19ten Jahrhundert waren die Erfahrungen in diesem Bereich noch nicht weit
fortgeschritten. Der Vortrieb in den
Tunneln
lief daher meistens nach dem gleichen Muster ab. Man bohrte Löcher,
sprengte und hoffte, dass man hartes Gestein ohne Wasser und andere
unangenehme Erscheinungen vorfand.
Es war im Interesse des Staats, die
vorgefundenen Gesteine zu erfassen und diese zu katalogisieren. Die
Bauherrschaft wollte schlicht nur einen
Tunnel. Vor dem Bau war es nur möglich ein Gutachten zu erstellen, wenn die obersten Gesteinsschichten betrachtet wurden. Sondierbohrungen, wie wir sie heute kennen, gab es schlicht keine. Zudem nahm man sich die Erfahrungen mit anderen ähnlichen Bauten zu Hilfe. Jedoch war die Geologie beim Mont Cenis
nicht genau genug erfasst worden. Das sollte sich am Gotthard schliesslich
rächen und zu einem grossen Teil zu den Problemen beim Bau beitragen. Hilfe bei dieser oberflächlichen
Betrachtung suchte man bei der Ortsbevölkerung. Dort erhoffte sich die
Gotthardbahn vor dem Bau Informationen über das Verhalten von
Gesteinen. Das Problem dabei war, dass die Leute der Gesellschaft nicht
immer gut gesinnt waren. So war eine Erfassung der Geologie kaum möglich
und letztlich blieb lediglich der ungewisse Weg in den Berg. Bei jeder
Sprengung kamen neue Schichten zum Vorschein. Wenn wir uns mit der Geologie befassen,
blicken wir in den Berg, wie er sich während des Baus zeigte. Damit
bekommen wir einen ersten Einblick in die Probleme, die während dem Bau zu
erwarten waren. Wie schwer dieser Weg letztlich war, zeigte sich wenige
Jahre später beim Bau des Lötschbergtunnels, wo das Sediment des
Gasterntals angeschnitten wurde. Eine ähnlich gelagerte Zone gab es jedoch
auch am Gotthard.
Mit der Berufung des Deutschen an den
Gotthard konnte ein ausgesprochen gutes geologisches Profil des
Gotthardtunnels erstellt werden. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass
alles immer im Nachhinein erfasst wurde. Stapff nahm seine Arbeit im Jahre 1875 auf.
Dabei erstellte er ein Gutachten, das mit der Betrachtung der
vorgefundenen Steine allein nicht gemacht war. So nahm er alle 100 Meter
eine Gesteinsprobe und erstellte ein 25 Meter langes gut detailliertes
Profil des 15 Kilometer langen Gotthardtunnels. Friedrich Moritz Stapff
verstarb am 17. Oktober 1895 in Tanga. Sein Gutachten des Gotthards half
zum Beispiel beim Bau der Autobahn. Beginnen werden wir die Betrachtung des
geologischen Profils beim nördlichen
Portal
des
Scheiteltunnels.
Diese Richtung wurde seinerzeit von der Gesellschaft gewählt, weil die
Kilometrierung der
Bahnlinie
von Luzern nach Chiasso festgelegt wurde. Dies wurde so gewählt, weil bei
der Planung die Aufteilung der Strecke bei Giubiasco leichter vorgenommen
werden konnte und weil der Sitz der Gesellschaft in Luzern war. Daher wurde auch der
Tunnel
in dieser Richtung vermessen und die Profile erfasst. Die effektiven
Längenangaben beziehen sich jedoch ausschliesslich auf den Gotthardtunnel
selber. Auch diese Lösung wurde bei langen Tunnel immer so gewählt. Diese
zwar in der Messung der Strecke enthaltenen Bauwerke hatten immer eine
eigene Kilometrierung, die auch nach der Fertigstellung der Strecke
beibehalten wurde. Von Beginn an, bis zum Kilometer 2,1 befand
sich der Vortrieb in hartem Gestein. Dieses gehörte zum Aaremassiv und
bestand in erster Linie aus Glimmergneis. Es handelte sich um stabiles
Gestein, das kaum mit Einschlüssen versehen ist und daher einen leichten
Vortrieb des
Tunnels
erlaubte. Zudem wurden in diesem Massiv kaum Wassereinbrüche festgestellt.
Jedoch waren die ersten Maschinen der Mineure dazu ungeeignet.
Gerade der Schiefer neigte zu plötzlichen Ab-platzungen und Druckerscheinungen. Zudem waren immer wieder Wassereinbrüche und Einschlüsse von weichem Gestein vorhanden. Es war daher nicht so leicht zu durchqueren
und erforderte massive Einbauten zur Abstützung des Richtstollens. Besonders schlimm waren die Druckerscheinungen auf dem Abschnitt von Kilometer 2,582 und 2,763. Hier fanden starke Wassereinbrüche und plötzliche Abplatzungen statt. Dadurch waren hier auch schwere Unfälle zu beklagen. Gerade das einbrechende Wasser stellte ein
Problem dar, das nur mit sehr viel Aufwand eingedämmt werden konnte. Eine
schwere Störzone, wie es sie in Bergen immer wieder gibt. Erst später erkannte man mit der genauen
Vermessung, dass man in diesem Bereich die Ursenenmulde und das darin
eingelagerte Sedimentgestein des gleichnamigen Tales bei Andermatt nur um
rund 300 Meter untergraben hatte. Die Stärke der Decke betrug zum Sediment
nur noch weniger als rund 100 Meter, so dass das dort eingelagerte Wasser
durch Risse und Spalten im Gestein in den
Tunnel
gelangen konnte. Man konnte von Glück sprechen, dass dieses Sediment nicht
angestochen wurde. Ab dem Kilometer 4,4 beruhigte sich die
Lage wieder. Der Vortrieb kam in den Bereich des Gotthardmassivs, das aus
hartem Glimmergneis bestand. Dieses harte Gestein war von der Beschaffung
her mit den Gesteinen des Aaremassivs zu vergleichen und bot den Mineuren
die gleichen Schwierigkeiten. Jedoch waren weniger Druckerscheinen zu
erwarten, was die Abstützungen vereinfachte und so einen schnelleren
Vortrieb ergab. In diesem Bereich unterquerte der
Tunnel
auch den Gipfel des Chastelhornes. Dieser Berg oberhalb von Andermatt
hatte eine Höhe von 2 973 Metern über Meer. Da der Tunnel hier jedoch
seinen höchsten Punkt hat, kann die Überdeckung mit rund 1 770 angenommen
werden. Trotz dieser massiven Differenz zur Oberfläche, waren die
Druckerscheinungen im Gestein nicht besonders hoch, was klar für die
Stabilität des Glimmergneises sprach. Schliesslich wurde das Gotthardmassiv bei
Kilometer 11,8 wieder verlassen. Ab jetzt befand sich die Tunnelachse bis
nach Airolo in Glimmergneis und Schiefer. Dieser als Tessinmulde
bezeichnete Bereich war gegen das Ende des
Tunnels
stark Wasser führend. Die Arbeiten kamen daher nur schlecht voran, da mit
Abdichtungen und kräftigen Einbauten dem Schiefer, der zu Abplatzungen
neigte, Einhalt geboten werden musste. Damit haben wir ein Gutachten, das sich im
folgenden Kapitel aufzeigen sollte und dank dem wir nun auch erwarten
können, wie und wo die Mineure beim Bau des Gotthardtunnels Probleme
erwarten konnten. Auch bei modernen Tunnelbauten sind trotz solcher
Profile immer wieder nicht erkannte Störzonen vorhanden. Daher ist und
bleibt die Geologie immer eine Wundertüte, auch wenn man immer genauere
Profile erstellen kann. |
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Daher
ist spannend zu erfahren, dass sich die
Daher
ist spannend zu erfahren, dass sich die
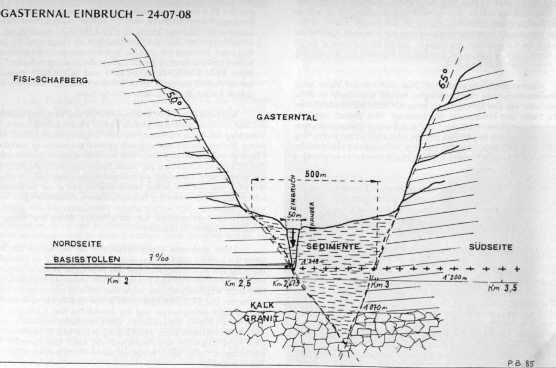 Mit
dem geologischen Gutachten wurde der am 26. Oktober 1836 in Gerstungen
geborene Friedrich Moritz Stapff beauftragt. Stapff war damals einer der
bekanntesten und besten Geologen weltweit.
Mit
dem geologischen Gutachten wurde der am 26. Oktober 1836 in Gerstungen
geborene Friedrich Moritz Stapff beauftragt. Stapff war damals einer der
bekanntesten und besten Geologen weltweit. Ab
dem Kilometer 2,1 bis zum Kilometer 4,4 durchquerte der Vortrieb die
Schichten der Ursenenmulde. Beim Gestein handelte es sich um Gneis und
Schiefer.
Ab
dem Kilometer 2,1 bis zum Kilometer 4,4 durchquerte der Vortrieb die
Schichten der Ursenenmulde. Beim Gestein handelte es sich um Gneis und
Schiefer.