|
Vermessung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Sie wird oft vergessen. Die
Vermessung
eines Bauwerkes ist enorm wichtig. Besonders dann, wenn man einen langen
Tunnel
baut. Beim Gotthard sah Louis Favre eine sehr kurze Bauzeit vor. Diese
wollte er damit erreichen, dass von beiden Seiten gleichzeitig gebaut
werden sollte. Das hatte unweigerlich zur Folge, dass man sich in der
Mitte treffen musste. Keine leichte Aufgabe für die Leute, die dabei die
Richtung vorgeben sollten.
Diese sehr aufwendige Lösung kam am
Gotthard nicht zur Anwendung. Vielmehr beschränkte man sich auf die
Vermessung
der beiden Seiten. Damit entstanden jedoch zwei Vermessungen. Die Vermessung der gesamten Strecke erfolgte im Zeitraum von 1869 bis 1874. Dabei wurden von der Gotthardbahn Geländeaufnahmen in den Massstäben 1:1000 und 1:500 gefordert. Es fällt die kurze Zeit auf, die für die
Vermessung
benötigt wurde. Schliesslich wurde nach knapp drei Jahren mit dem Bau
begonnen. Man kann daher von einer hektischen gemetrischen Aufnahme der
gesamten Strecke und damit des
Scheiteltunnels
gesprochen werden. Ausgehend von einer Referenz, die beim Gotthard eine Strecke im Raum Realp bildete, wurden die beiden Seiten vermessen. Dabei wurde mit der Trigonometrie gearbeitet. Diese Lösung basiert auf Dreiecken und
deren Winkel. Bestimmt wurden die Winkel durch Betrachten von festgelegten
Punkten im Gelände. Diese speziellen Vermessungspunkte wurden dazu
markiert. Anschliessend wurden diese von zwei Seiten betrachtet. So entstand ein Dreieck, dessen Winkel
bekannt waren. Um die Distanz von einem zum anderen Punkt zu bestimmen,
musste gerechnet werden. Dadurch wussten die Vermesser, wie weit sich
jeder Punkt von einem anderen befand. Daraus konnten weitere Punkte
bestimmt werden. Letztlich wurde so die Tunnelachse festgelegt und deren
Richtung vorgegeben. Man hatte einen Weg, den man in der Folge gehen
musste.
Dort harrte man schliesslich Wind und
Wetter ausgesetzt aus, bis die Sicht gut genug war um den bekannten Punkt
anzupeilen. Dabei darf den Spezialisten natürlich nichts passieren, da
sonst die Arbeit nicht korrekt abgeschlossen werden konnte. Von der Gotthardbahn wurden dazu mit der Eidgenössischen geodätischen Kommission staat-liche Stellen beauftragt. Diese konnten teilweise auf bereits vorhandene Punkte zurückgreifen. Die
Vermessung
der Strecke gelang dadurch in rekordverdächtiger Geschwindigkeit. Diese
jetzt nur auf den
Tunnel
beschränkte Betrachtung betraf natürlich die ganze Strecke und stellt
somit noch einen grösseren Aufwand dar. Verantwortlich für den Gotthard waren die Ingenieure Carl Friedrich Koppe und Otto Gelpke. Der Deutsche Carl Friedrich Koppe war am 09. Januar 1844 in Soest geboren worden. Koppe war von 1869 bis 1875 für die
Vermessung der
Gotthardbahn verantwortlich und zeichnete sich durch die
barometrische Höhenvermessung aus. Damit erlange er grosse Bewunderung.
Koppe verstarb am 10. Dezember 1910 bei Bonn. Vom Berner Otto Gelpke sind kaum
Informationen verfügbar. Er lebte von 1840 bis 1895 und war beim
eidgenössischen geodätischen Amt angestellt, als er zur
Gotthardbahn gerufen wurde. In seiner Funktion übernahm Gelpke die
Berechnungen anhand der Ergebnisse von Koppe beim Bau vom Gotthardtunnel.
Zusammen mit Koppe trug Gelpke schliesslich die vermessungstechnische
Verantwortung für das Gelingen des Bauwerks.
In der grossen Zeit des Bahnbaus war es für
Firmen von grossem Vorteil, wenn auf Geräte der in Aarau ansässigen Firma
zurückgreifen konnte. Die Produktion von Vermessungswerk-zeugen wurde in
Aarau im Jahre 1991 eingestellt. Jedoch war es mit der Lieferung der Geräte längst nicht getan, die schwerlichen Aufstiege führten immer wieder zu Schäden an den Theodoliten. Daher entsahnte die Firma Spezialisten zur Baustelle. Diese konnten die defekten Geräte wieder
herstellen und so die schnelle
Vermessung
ermöglichen. Sie sehen, dass bereits damals auf die Fähigkeiten von
Lieferfirmen Rücksicht genommen wurde. In diesem Punkt half natürlich auch
die staatliche Lösung. Eigentlich wurde dabei nicht der Tunnel, sondern die Strecken dorthin vermessen. Es gelang so die Tunnelachse auf Grund von Berechnungen zu bestimmen und so die Richtung zu definieren. Diese Lösung verlangte von den Vermessern
genaues Arbeiten und korrekte Berechnungen. Es kann davon ausgegangen
werden, dass wegen der kurzen Zeit kaum Nachmessungen vorgenommen werden
konnten und so die Berechnungen stimmen mussten. Zudem wurden erste Arbeiten an der Strecke bereits ausgeführt, als die Vermessung derselben abgeschlossen werden konnte. Das dabei eingegangene Risiko kann als gross bezeichnet werden und war der kurzen Bauzeit geschuldet. Gerade bei der grossen Anzahl vom
Vermessungspunkten und der damit verbundenen Berechnungen sind Fehler
schnell passiert. Andere Bahnprojekte nahmen sich daher für diesen Teil
mehr Zeit heraus und stellten dabei durchaus Fehler bei der
Vermessung
fest. Damit diese Ergebnisse letztlich in den
Tunnel
übertragen werden konnten, waren spezielle Richtstollen erstellt worden.
Diese Visierstollen gaben durch ihre Ausrichtung letztlich die Tunnelachse
vor. Damit hatte man eine Richtung, in der gearbeitet werden konnte.
Einfach gesagt, sagte jemand in diese Richtung und die Arbeiten wurden
entsprechend dieser Richtung aufgenommen. Nur wenn diese stimmte, gelang
das Bauwerk.
Dieses Vorgehen ist durchaus üblich und
erlaubt einen anderen Blickwinkel auf so wichtige Ergeb-nisse, wie die
Vermessung.
Erst jetzt konnte man den Ergebnissen der beauftragten Stelle vertrauen
und das Bauwerk erfolgreich abschliessen. Diese Nachmessung wurde von den Herren Emile Plantamour (1815 – 1882) und Adolphe Hirsch (1830 – 1901) ausgeführt. Deren Nachberechnung der Gott-hardbahn ergab für die rund 200 Kilometer lange Strecke zwischen Luzern und Locarno eine Abweichung in der Höhe von lediglich 30 Millimeter. In Anbetracht das dabei die Alpen überquert
wurden, kann die
Vermessung
der
Gotthardbahn als ausge-sprochen präzis bezeichnet werden. Grundsätzlich kann in Visierstollen ein
Theodolit
und ein Fixpunkt gestellt werden. Damit hat man die grundsätzliche
Richtung bereits bestimmt. Im
Tunnel
wurde in der Folge eine
Visierlanze
sowohl in der Höhe, als auch seitlich so verschoben, dass sie hinter dem
Fixpunkt verschwand und für den Betrachter nicht mehr sichtbar war. So
hatte man nun eine Linie zwischen diesen drei Punkten, auf der man sich
fortbewegen konnte. Diese Lösung war einfach in einen geraden
Tunnel
zu übertragen. Dabei mussten jedoch zwei Punkte berücksichtigt werden. Je
mehr sich der Treffpunkt von der berechneten Stelle entfernt, desto
grösser wurde die Differenz, denn es wurde eine leichte Steigung
vorgesehen, damit in den Tunnel eindringendes Wasser durch das Bauwerk
nach aussen abfliessen konnte. Das war gerade für die Berechnung der Länge
von Bedeutung. Andererseits entstanden leicht seitliche
Fehler, die durch ungenaues arbeiten entstehen konnten. In der Folge gab
es Abweichungen der beiden
Achsen,
die dazu führen konnten, dass man sich Seitlich nicht finden würde. Daher
war eine Nachprüfung wichtig, auch wenn dadurch die Arbeiten im
Tunnel
eingestellt werden mussten. Sie sehen, es waren durchaus Schwierigkeiten
zu erwarten und die Fehler wurden erst am Schluss festgestellt. Wie gut diese
Vermessung
letztlich war, stellte sich erst bei der Nachmessung nach dem Durchbruch
heraus. Bei der Nachmessung wurden die Abweichung der beiden Richtstollen
mit 330 Millimetern seitlich und lediglich 50 Millimetern in der Höhe
bestimmt. Bei einer Länge von 14 982 Metern kann von einem sehr präzisen
Ergebnis für die Vermessung gesprochen werden. Erst später wurde die Länge
des
Tunnels
leicht korrigiert. |
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
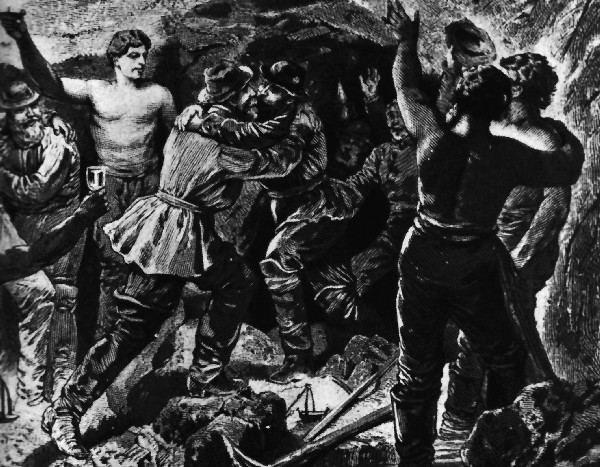 Es
stellt sich dabei unweigerlich die Frage, wie man dazu vorgehen soll.
Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an. Eine davon nimmt einem
gemeinsamen Punkt, der auf beide Seiten übertragen wurde und so die
Richtung vorgab.
Es
stellt sich dabei unweigerlich die Frage, wie man dazu vorgehen soll.
Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an. Eine davon nimmt einem
gemeinsamen Punkt, der auf beide Seiten übertragen wurde und so die
Richtung vorgab. Was
in einem flachen Gebiet einfach erscheint, ist im Gebirge extrem schwer.
So mussten die Punkte in den Berg oft mit abenteuerlichen Kletterpartien
erreicht werden.
Was
in einem flachen Gebiet einfach erscheint, ist im Gebirge extrem schwer.
So mussten die Punkte in den Berg oft mit abenteuerlichen Kletterpartien
erreicht werden. Für
die
Für
die
 Es
lohnt sich, wenn wir einen anderen Blick auf die
Es
lohnt sich, wenn wir einen anderen Blick auf die