|
Vermessung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bevor bei einem so grossen Bauwerk, wie dem Lötschbergtunnel die
Baumaschinen
und Arbeiter eingesetzt werden können, müssen die Position und die
Richtung des
Tunnels
bestimmt werden. Dabei ist diese besonders dann sehr wichtig, wenn
gleichzeitig von zwei Seiten gearbeitet wurde. Schliesslich mussten auf
beiden Seiten rund sieben Kilometer gebaut werden. Ziel war, dass man sich
im Tunnel treffen sollte.
Schon beim Bau der
Gotthardbahn wurde diese
Vermessung,
die fachlich auch als
Triangulation
bezeichnet wurde, akribisch ausgeführt. Als es jedoch mit dem geplanten
Datum für das Treffen nicht klappte, wurde schwer an diesem Prinzip
gezweifelt. Um diese Schwierigkeiten beim Lötschbergtunnel zu vermeiden,
sah man für die Vermessung deutlich mehr Zeit vor, als das seinerzeit bei
der Gotthardbahn der Fall war.
Dabei steckte sie sehr viel Zeit in die Entwicklung neuer Geräte.
Diese waren jedoch so teuer, dass sie nur noch von staatlichen
Organisationen erworben wurden. In einer Zeit, wo GPS und Navi so fremd klangen, wie heute ein Abakus, hatte man nicht viel mehr zur Verfügung. Die Geometer machten sich mit dem Theodolit und Visierstab an die Arbeit.
Damit gewisse immer wieder verwendete Punkte nicht jedes Mal
aufgesucht werden mussten, montierten die Vermesser im Gelände auch feste
Visiertafeln, die von mehreren Seiten betrachtet werden konnten. Damit das
ging, musste man wissen, wo sie steht. Die Vermessung eines Bauwerkes, wie dem Lötschbergtunnel, ist wegen den Alpen ungleich schwerer, als die Vermessung eines Grundstücks in der Stadt Bern. Berggipfel und Grate verhindern in vielen Fällen die Sicht auf die Visierlanze und somit die Bestimmung der unterschiedlichen Win-kel.
Man musste daher hohe Punkte im Gelände suchen und das waren die
Gipfel der Berge. Auch verkürzte Distanzen ermöglichten die Sicht. Während sich in Bern kleine Fehler kaum bemerkbar machen, kann ein solcher in den Alpen verheerende Auswirkungen haben. Daher wurde für die Ausführung der geometrischen Aufgaben staatliche Stellen beauftragt.
So konnte man auf die neusten Daten und Geräte zurückgreifen, ohne
dass man dafür selber Leute anstellen musste. Eine Lösung, die immer
wieder gewählt wurde und die jedesmal ungemein einfachere Lösungen ergab.
Musste in der Schweiz eine neue
Vermessung
durchgeführt werden, konnte man diese Daten abrufen. Modern ausgedrückt,
man konnte mitt-lerweile auf eine Datenbank mit vielen Werten
zu-rückgreifen. Das erleichterte die Arbeit und neue Punkte, die durch die Vermessung entstanden, wurden einge-bracht. Dadurch wurde das Netz mit den Punkten immer dichter und so ergab sich schnell ein sehr genaues geometrisches Profil der Schweiz.
Da für die
Vermessung
des Lötschbergtunnels staat-liche Geometer angestellt wurden, war klar,
dass die neuen Vermessungspunkte nachträglich in der umfangreichen
nationalen Datenbank aufgeführt wurden.
Ausgeführt wurden die
Vermessungen
durch die Kantonsgeometrie des Kantons Bern. Dabei zeich-nete sich der
Konkordatsgeometer für die
Triangulation
des gesamten
Tunnels
verantwortlich. Das galt auch für die südliche Seite. Speziell war, dass
es sich dort im Gebiete des Kantons Wallis handelte. Jedoch wurde im
Bereich der Geometrie sehr oft von Land und nicht von einem Kanton
gesprochen. Zudem arbeiteten die Leute im Auftrag der EGL.
Im Gegensatz zum Gotthard, wo die gesamte Strecke inklusive des
Haupttunnels vermessen werden musste, konnte der Geometer nun anhand der
bekannten Punkte im Gelände jedes einzelne Bauwerk der späteren
Bahnlinie
unabhängig von anderen Bauwerken vermessen. Es wurden daher nicht mehr die
beiden Seiten, sondern einzelne Bauwerke vermessen. Ein Punkt, der die
Arbeit der Geometer aufteilte und so vereinfachte.
Diese Referenzpunkte waren Bestandteil der neuen Landestopografie,
die auch im alpinen Bereich der Schweiz bereits fixe Punkte definiert
hatte. Diese wurden einmal vermessen und mit genauen Koordinaten versehen.
So wusste man, wo sich der Punkt befand und wie weit über dem
Meeresspiegel er lag. Alle weiteren Punkte wurden ab so einem
Referenzpunkt genommen. Wo ein direkter Weg nicht möglich war, schuf man
neue Referenzpunkte.
Da das noch junge geometrische Netz der Schweiz Lücken besass,
konnten damals nur markante Bereiche definiert werden. Diese markanten
Punkte gab es im Alpenraum zu genüge. Einige waren sehr bekannt und hörten
auf Namen, wie Matterhorn und Eiger. Für den Lötschbergtunnel waren die
Bergspritzen vom Steghorn, dem Atles, vom First, sowie vom Gellihorn, der
Birre und des Hockenhorns die massgebenden Fixpunkte.
Wo diese waren, wusste man erst, wenn man mit der
Vermessung
begonnen hatte. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas genauer hinsehen und
so die Vermessung des Lötschbergtunnels, sowie dessen Berechnung kennen
lernen. Verantwortlich für die Vermessung des Lötschberg-tunnel war Herr Th. Mathys. Der Berner Geometer war für das geometrische Amt des Kantons Bern tätig. Dort bekleidete er das Amt als Konkordats-geometer.
Für die die
Vermessung
des
Tunnels
wurde er daher mit seinem Team in die Alpen rund um das spätere Bauwerk
entsandt. Dieses Team von Spezialisten sollte schliesslich die
Verantwortung für das Ge-lingen des Bauvorhabens haben. Mit der Vermessung des Lötschbergtunnels begann man am 25. August 1906. Trotz der erwähnten fixen Punkt im Gelände, konnte sich das Team um Th. Mathys einige Klettereien nicht ersparen.
Dabei waren nicht alle Punkte leicht zugänglich und eine gewisse
Portion alpiner Erfahrung war durchaus von Vorteil. Besonders dann, wenn
man mit der schweren und wertvollen Ausrüstung unterwegs war, denn auch
die musste mitkommen.
Die zusätzlich zu bestimmten Punkte waren das Torrenthorn, der
Niroungrat und der Stritungrat. Es gelang so ein Netz aus Dreiecken über
den
Tunnel
zu legen und so auf rechnerischem Weg die Distanzen der einzelnen Punkte
zu bestimmen. Dabei musste man dreidimensional arbeiten, denn schliesslich
sollte man sich auch in der Höhe im Tunnel finden können. Es entstand ein
geometrisches Netz und darauf liess sich nahezu alles ablesen.
Insgesamt gab es daher lediglich neun Messpunkte. Es mag Sie
sicherlich überraschen, aber viel mehr war nicht erforderlich, denn zwei
weitere Punkte, die bisher noch nicht erwähnt wurden, waren natürlich die
beiden
Portale
des Lötschbergtunnels. Diese wurden im Netz mit einer Linie verbunden.
Diese sollte die spätere Tunnelachse darstellen und so war klar, wo die
beiden Portale zu stehen kommen würden.
Damit stand bereits die
Vermessung
des
Tunnels
unter keinem guten Stern. Doch bei dem schweren Gelände, das bei den
Alpenbahnen bestiegen werden mussten, ist es eher ein Glück, dass man
nicht mehr Vermesser verloren hatte. Es war mit der Vermessung und der Definition der Mess-punkte längst nicht getan. Nachdem die ersten Messungen abgeschlossen werden konnten, wurde der neue Tunnel berechnet.
Mit Rechenschieber und Tabellen, wurden Winkel und Län-gen
berechnet. Dabei ist diese Berechnung ebenso wichtig, wie die
Vermessung
selber. Fehler dürfen keine passieren, denn sonst endet die Suche im Berg
nicht so, wie erhofft. In der Folge konnte aus dem so entstandenen Netz ein Punkt vor den beiden Portalen berechnet werden. Man hatte die für die spätere Nivellierung benötigten Fixpunkte. Diese wurde vorerst provisorisch im Feld markiert.
Das Ziel war mit Angabe der Richtung und der Neigung erreicht
worden. Man hätte nun bauen können, aber stimmten die Werte wirklich?
Hatte sich bei all der Kletterei nicht doch ein Fehler eingeschlichen? Wurden die beiden neuen Fixpunkte miteinander ver-bunden, entstand eine gerade Linie, die den späteren Lötschbergtunnel darstellen sollte. Die berechnete Distanz der Fixpunkte lag bei etwa 15 Kilometer.
Wobei die Fixpunkte etwas von den späteren
Portalen
entfernt aufgestellt werden mussten. Der spätere
Tunnel
sollte gemäss diesen Berechnungen 13 695 Meter lang werden. Die
Vermessung
war damit abgeschlossen.
Es wäre schlicht unverantwortlich, wenn hier die Arbeiten begonnen
hätten. Diese erste Berechnung war nicht geprüft und von einer anderen
Person neu berechnet worden. Daher wurden die Berechnungen durch eine
andere Person ausgeführt und so die korrekte Position der Fixpunkte
bestätigt. Zumindest war das so geplant gewesen, denn durch andere
Berechnungen ergaben sich zur ersten Berechnung des Bauwerks deutliche
Differenzen.
Scheinbar stimmten die Berechnungen oder die Messungen nicht.
Erneut wurde der
Tunnel
ausgemessen und gerechnet. Die Überraschung war gross, als es erneut
andere Ergebnisse gab. Es dauerte nicht lange, bis die Vermesser
bemerkten, dass der Lötschbergtunnel auf rund 1 200 Meter über Meer zu
liegen kam. Diese Tatsache musste bei der Berechnung berücksichtigt
werden, wollte man eine korrekte Berechnung der Tunnelachse erreichen.
Natürlich wurde der
Tunnel
dreidimensional vermessen und berechnet. Jedoch ging man davon aus, dass
der nördliche Fixpunkt auf dem Niveau null zu stehen käme. Ein Fehler, der
korrigiert wurde und mit Hilfe der bekannten Koordinaten konnte die Höhe
neu berechnet werden. Dabei wurde jedoch berücksichtigt, dass der Tunnel
auf 1 200 Meter über Meer gebaut wurde. Das
Portal
Nord lag dabei etwas unter dieser Referenz.
Als dieser Umstand einbezogen wurde, konnten die Messungen und
Berechnungen erneut ausgeführt werden. Die Nachkontrollen und
Nachrechnungen ergaben nun in jedem Fall übereinstimmende Ergebnisse für
die Tunnelachse. Der Lötschbergtunnel war damit erfolgreich vermessen
worden. Daher konnten diese Arbeiten mit dem Setzen der Fixpunkte bei den
beiden
Portalen
am 08. September 1906 beendet werden. Mit der Vermessung der beiden Fixpunkte, war es noch nicht getan. Während dem Bau muss die Richtung immer wieder geprüft werden. Im Gegensatz zum Gotthard, wo man dazu einen Visierstollen erstellte, gab es diesen beim Lötschbergtunnel nicht mehr. Die Vermessung wurde in den wenigen Jahren so verbessert, dass man von einem fest definierten Punkt her die Richtung und somit den richtigen Weg kontrollieren konnte.
Vom Fixpunkt aus konnten mehrere Messpunkte im
Tunnel
erstellt werden. Dies erfolgte vom Fixpunkt aus. Mit einem
Theodolit,
bei dem der richtige Winkel und die richtige Neigung eingestellt wurde,
visierte man einen
Visierstab
im Tunnel an. Stimmte dessen Position, hatte man die richtige
Achse.
Ab diesem neuen Messpunkt, konnte schliesslich weiter in den Tunnel
gemessen werden. Einen grossen Unterschied zum Gotthard gab es dabei nicht
mehr.
Wie wichtig die korrekte
Vermessung
und die Kontrolle der Bauausführung ist, wurde beim Lötschbergtunnel auf
tragische Weise bewiesen. Nachdem es in der ursprünglichen Tunnelachse
unüberwindbare Probleme gab, musste im
Tunnel
eine Umfahrung mit mehreren
Kurven
berechnet werden. Die dabei ausgeführten Berechnungen gaben klar den
vorgesehenen Treffpunkt an. Traf man sich dort, war der Bau gelungen.
Je mehr sich der Treffpunkt jedoch von der Tunnelmitte entfernte,
desto grösser sollte die Abweichung sein. Bei zu grosser Verschiebung,
hätte dies durchaus dazu führen können, dass man sich im
Tunnel
nie finden würde. Jedoch sollten sich die Berechnungen als so gut
erweisen, dass man die Werte exakt nachvollziehen konnte. Diese konnte
jedoch auch nur gelingen, weil es seit der
Gotthardbahn, deutlich bessere
Theodoliten
gab.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Das
wichtigste Gerät bei der
Das
wichtigste Gerät bei der
 Seit
dem Bau der
Seit
dem Bau der
 Gipfel
waren einfache Punkte, weil sie von weither eingesehen werden konnten.
Jedoch in den Details, also im Bereich des
Gipfel
waren einfache Punkte, weil sie von weither eingesehen werden konnten.
Jedoch in den Details, also im Bereich des
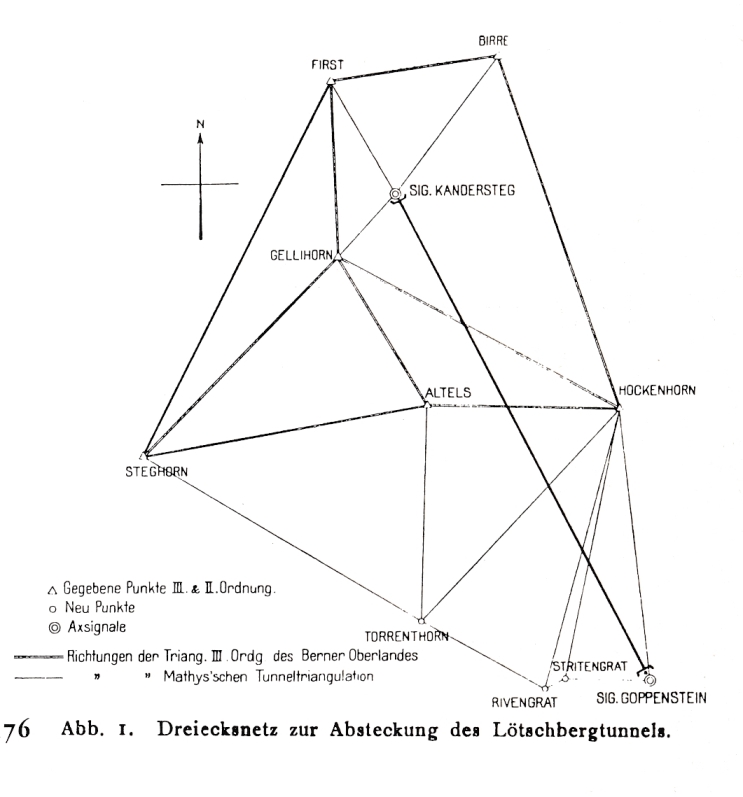 Der
tragische Verlust eines Mitgliedes im Team war eine Folge des unwegsamen
Geländes und der Tod warf die Arbeiten deutlich zurück, denn neue Leute
mussten zuerst eingearbeitet werden.
Der
tragische Verlust eines Mitgliedes im Team war eine Folge des unwegsamen
Geländes und der Tod warf die Arbeiten deutlich zurück, denn neue Leute
mussten zuerst eingearbeitet werden. Damit
Sie dieses Problem etwas besser vorstellen können nehmen wir eine Kugel.
Diese nennen wir Erde. Darauf stelle ich im Lot zwei hohe Türme. Beim
Damit
Sie dieses Problem etwas besser vorstellen können nehmen wir eine Kugel.
Diese nennen wir Erde. Darauf stelle ich im Lot zwei hohe Türme. Beim