|
Der Dieselmotor |
|||||
|
Ich
weiss, dass auch jetzt der Titel nicht korrekt ist. Denn der hier
vorgestellte Motor für
Dieselöl kann auch so
aufgebaut werden, dass er mit
Benzin arbeitet. Es
handelt sich um das Prinzip mit der als Selbstzündung bezeichneten Lösung.
Bei dieser entflammt sich der
Treibstoff
ohne fremde Zündung an der heissen Luft. Dazu darf er aber nicht zusammen
mit dieser in den Verbrennungsraum gelangen, denn das wäre der Ottomotor.
Genau hier liegt auch der Grund, warum sich diese Motoren bei den Eisenbahnen durchsetzen konnten, denn dort zählt die Kraft. Im weite-ren Verlauf werde ich vom Dieselmotor sprechen wenn ich ein Modell mit Selbstzündung meine.
Wird
jedoch vom Ottomotor gesprochen betrifft das die Bauarten mit einer
Fremdzündung. In den meisten Punkten sind sie jedoch identisch aufgebaut
worden, so dass mehrheitlich der Dieselmotor erwähnt wird, denn er ist das
Sinnbild für dem Aufbau mit der Selbstzündung. Das ist der einzige
Unterschied. Der Dieselmotor mit Selbstzündung wurde von Rudolf Christian Karl Diesel erfunden und der dazu benötigte Treibstoff bekam seinen Namen. Diesel wurde am 18. März 1858 in Paris geboren.
Der
Deutsche Staatsbürger wurde 1870 kriegsbedingt mit anderen Leu-ten
deutscher Herkunft aus Frankreich gewiesen und reiste schon früh nach
London. Seine Ausbildung zum Ingenieur erfolgte an der Uni-versität
München, wo er wegen einer Krankheit nicht abschliessen konnte.
Nach
einem Praktikum bei der Firma Sulzer konnte er sein Studium noch
abschliessen und er kehrte nach dem Krieg wieder nach Paris zurück. Rudolf
Christian
Diesel verschwand am 29.
September 1913 auf dem Fährschiff Dresden, und er wurde als vermisst
gemeldet. Nachdem er nicht gefunden werden konnte, wurde er für Tod
erklärt. Diesel hinterliess uns den Motor mit Selbstzündung und den
bekannten
Treibstoff.
Es
wird nur zum
Dieselöl, wenn es in
Motoren verwendet wird. Da auf
Treibstoffen
Steuern erhoben werden, wird
Diesel vor dem Verkauf
eingefärbt und unterscheidet sich daher farblich vom erwähnten
Heizöl. Auch beim Dieselmotor gab es eine Version, die mit zwei Takten arbeitete. Wir hier werden jedoch bei den Motoren bleiben, die mit vier Takten arbeiteten. Bereits bei der Vorstellung des Ottomotors haben wir davon gehört, dass die Motoren in der Regel mit vier Takten arbeiten.
Daraus konnten wir bisher noch nicht viel ableiten und nun wol-len wir
anhand des Dieselmotors diese einzelnen Schritte ansehen, denn sie waren
gleich, wie beim Ottomotor.
Bevor wir damit beginnen, muss erwähnt werden, dass gerade die
Dieselmotoren bei der Grösse unbeschränkt sind. Im Gegensatz zu den
Ottomotoren ist die bessere Ausnutzung der Kraft massgebend. Wie grösser
ein Motor wird, desto mehr wird auf die Kraft geachtet. Ein schwerer Motor
für ein Schiff muss nicht spontan reagieren, das ist nur bei Automobilen
der Fall und so kommen dort riesige Motoren für
Dieselöl vor.
Schiffsdiesel, also die Motoren für Schiffe
sind oft so gross, dass sie auch mit anderen
Treibstoffen
betrieben werden können. Daher sind dort
Kraftstoff
üblich, die auf Schweröl basieren, da das einfach billiger ist, als das
herkömmliche
Dieselöl. Auf die
Anwendung von diesem Schweröl wurde bei
Lokomotiven nicht so viel Wert
gelegt, denn die dort verbauten Motoren waren von der Grösse her nicht
dafür geeignet.
|
|||||
|
Funktion des Dieselmotors |
|||||
|
Es wird nun
Zeit, sich mit der Funktion dieses Motors zu befassen. Zwei Teile haben
wir kennen gelernt, denn wir haben den
Treibstoff
und die Luft für diese
Aufgabe vorbereitet. Damit können wir eine Verbrennung erzeugen. Es fehlen
nur noch die Zündquelle und der Zeitpunkt, wann welcher
Zylinder die
Verbrennung ausführen muss. Beim Dieselmotor wir jedoch im Unterschied zum
Ottomotor keine fremde Zündquelle verwendet.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn das ist nicht meine
Fachrichtung. Der Dieselmotor arbeitet im 3/4 Takt, auch wenn er sechs
oder zwölf
Zylinder hat. Macht er das nicht, funktioniert er nicht
richtig. 1. Takt (ansaugen): Unser Motor beginnt sich nun zu drehen. Durch die Nockenwelle werden die Einlassventile des Zylindern geöffnet. Der Weg für die Ladeluft wird so frei gegeben und die Luft kann in den Zylinder strömen.
Der dazu
notwendige Hohlraum wird geschaffen, weil sich nun im
Zylinder durch die
Drehung der
Kurbelwelle der
Kolben nach unten bewegt. So kommt immer mehr
Luft in unseren Zylinder, der immer mehr Platz frei gibt.
Bei modernen
Dieselmotoren mit besser verdich-teter
Ladeluft unterstützt der Druck
diesen Effekt noch zusätzlich. Das heisst, die Zeit, die nun verstreicht,
bis der
Kolben unten angelangt ist, kann besser genutzt werden. So strömt
mehr Luft in den Verbrennungsraum. Die Bezeichnung ansaugen stammt noch
aus jenen Tagen, wo es keine
Abgasturbolader
gab, denn dann wurde die Luft
durch den entstehenden Unterdruck in den Verbrennungsraum gezogen.
An dieser
Situation ändert sich erst etwas, wenn der
Kolben am unteren Wendepunkt
angekommen ist. Jetzt endet der erste Takt und es beginnt der zweite Takt.
Die
Einlassventile, die bisher geöffnet waren, werden wieder geschlossen.
Damit befinden wir uns nun unten und der Hohlraum ist mit Ladeluft
gefüllt. Die
Ventile sind geschlossen, so dass die
Ladeluft im
Zylinder
gefangen ist. Wir können nun zum zweiten Takt gehen.
2. Takt (verdichten):
Der
Zylinder wird nun durch die
Kurbelwelle nach oben bewegt. Die
Nockenwelle lässt alle
Ventile geschlossen. Damit kann keine Luft aus dem
Verbrennungsraum entweichen. Durch den nun kleiner werden Hohlraum, wird
die Luft zusätzlich verdichtet. Die Ventile werden dadurch zusätzlich
gegen ihren Sitz gepresst. Dadurch kann nun absolut nichts mehr
entweichen. Die Luft wird daher durch den immer kleiner werdenden Raum
zusätzlich verdichtet.
Durch die
Verdichtung wird die Luft immer heisser. Seit dem
Abgasturbolader
wissen
wir, dass Luft, die verdichtet wird, heiss wird. Je kleiner der Platz
wird, desto heisser wird die Luft im Verbrennungsraum. Für diese
Verdichtung wird fast die gesamte Zeit des Taktes benötigt. Eine Änderung
findet erst kurz vor dem Ende dieses Taktes statt. Die Luft ist nun sehr
heiss und steht unter sehr hohem Druck. Der
Zylinder ist für die
Verbrennung vorbereitet.
Kurz bevor
der
Kolben an der höchsten Stelle angekommen ist, wird der
Kraftstoff
durch die
Einspritzdüse in den Verbrennungsraum gespritzt. Dazu wird die
Düse geöffnet und der Weg für den
Treibstoff
frei gegeben. Jetzt versteht
sich auch, warum die
Einspritzpumpe
den Treibstoff unter einen hohen Druck
setzen muss, denn wäre das nicht der Fall, könnte der Treibstoff nicht in
ausreichendem Masse in den Hohlraum eingespritzt werden.
Genau zum jetzigen Zeitpunkt ist der zweite Takt fertig und der
Kolben am
obersten Punkt angekommen. Die vorzeitige Einspritzung ist nur nötig,
damit die Zeit noch ausreicht um den
Zylinder ganz nach oben zu schieben. Hier liegt nun der Unterschied zum Ottomotor, denn bei diesem wird jetzt das Gemisch entzündet. Der durch die Düse fein zerstäubte Treibstoff wird nun sofort mit der sehr heissen Luft in Kontakt kommen und verbrennt auf Grund der Hitze ohne fremde Hilfe.
Somit klappt das nur, wenn der
Kraftstoff
eingespritzt wird. Es ist egal welchen Treibstoff man nimmt, denn er gerät
sofort explosionsartig in Brand.
Sollten Sie
sich fragen, warum das Gemisch nicht explodiert, dann kann das eigentlich
nur mit dem armen Frosch im Kochtopf erklärt werden. Wird er in das heisse
Wasser verbracht, hüpft er sofort wieder aus diesem. Der kühle
Kraftstoff
explodiert in der Brennkammer. Wird der Frosch jedoch in kaltes Wasser
gesetzt und dieses dann erwärmt, bleibt er darin sitzen, bis er gekocht
ist. Er passt seine Körperwärme der Umgebung an.
Auch der im
Gemisch enthaltene
Treibstoff explodiert nicht, weil er sich nicht spontan
erhitzt. Daher muss beim Ottomotor eine Zündquelle her. Beim hier näher
vorgestellten Selbstzünder ist das nicht erforderlich, weil der
Kraftstoff
von sich aus in Brand gerät. Natürlich habe ich nichts gegen Frösche, aber
es ist ein sehr gutes Beispiel um die Situation bei den beiden Motoren zu
erklären, denn Treibstoff ist identisch.
3. Takt (arbeiten):
Durch die Verbrennung entstehen sehr grosse Kräfte. Die Luft will sich nun
ausdehnen und muss Platz schaffen. Damit wird der
Kolben im
Zylinder unter
gewaltigem Druck nach unten gestossen. Das ist das einzige Teil, das sich
nun bewegen lässt. Erstmals wird der Kolben durch die Explosion und nicht
durch die
Kurbelwelle gesteuert. Jedoch müssen wir die Verbrennung etwas
genauer betrachten.
Wir folgen
wieder unserem
Kolben. Der wird nun durch die Explosion nach unten
gedrückt. Dadurch versetzt er die
Kurbelwelle in Bewegung. Es ist von
allen vier Takten der einzige, wo der Kolben die Kurbelwelle steuert, denn
die Kraft der Explosion ist so gross, dass es für den Kolben nur einen Weg
gibt, den nach unten. Alles andere würde den Motor zerreissen und so zu
schweren Schäden am Motor führen.
Je weiter
der
Kolben nach unten bewegt wird, desto geringer wird die Kraft der
Explosion. Irgendwann wird dann der Punkt erreicht, wo die Kraft der
Explosion kleiner wird, als die Gegenkraft der
Kurbelwelle. Die Arbeit ist
getan und der Kolben ist beim unteren Wendepunkt angelangt. Genau hier
regeln wir die Drehzahl des Motors, denn der durch die Explosion
entstandene Schwung muss ausreichen, bis es zu einer neuen Explosion
kommt.
Explodiert
mehr
Treibstoff, ist die Kraft grösser und der
Kolben wir bis zum unteren
Wendepunkt beschleunigt. Der Motor beginnt sich schneller zu drehen. Ist
jedoch weniger
Kraftstoff vorhanden, verpufft die Kraft früher und die
Drehzahl verringert sich. Die Aussage, dass man
Gas gibt ist eigentlich
falsch, denn man spritzt mehr
Brennstoff in den Verbrennungsraum. Die
Menge der Luft ist immer identisch, denn dort ändert sich nichts.
Der
Arbeitstakt wird mit dem ganz unten angekommenen
Kolben beendet.
Spätestens jetzt übernimmt die
Kurbelwelle wieder das Kommando. Die
Ventile sind jetzt noch geschlossen, aber die
Nockenwelle bewegt sich ja
über die Kette auch und löst nun eine Veränderung der
Ventile aus. Das
heisst, wir kommen zum Takt vier und damit zum Abschluss unserer
Betrachtung. Wir müssen jetzt wissen, dass der Raum mit
Gasen aus der
Verbrennung gefüllt ist.
4. Takt (ausstossen):
Jetzt wo der
Kolben an seinem unteren Totpunkt angelangt ist, sorgt die
Nockenwelle dafür, dass die
Auslassventile geöffnet werden. Der jetzt
wieder nach oben laufende Kolben stösst die Verbrennungsrückstände aus dem
Zylinder. Das erfolgt so lange, wie der Kolben nach oben läuft. Damit
werden alle Rückstände ausgestossen. Der vierte und letzte Takt wurde
beendet und der Zylinder ist wieder in der Startposition.
Unser Motor
hat nun zwei Umdrehungen gemacht und wir sind wieder kurz vor dem
Startpunkt. Das heisst, die geöffneten
Auslassventile werden, wenn der
Kolben ganz oben ist, geschlossen und die
Einlassventile erneut geöffnet.
Der beschriebene Umlauf beginnt von vorne und wir haben die Funktion des
Dieselmotors kennen gelernt. Es gibt keine weiteren Schritte mehr. Während
dem Betrieb wiederholen sich die Schritte immer wieder.
Bei einem
Motor mit vier
Zylindern sind diese in der
Taktfolge so eingestellt, dass
immer einer den Arbeitstakt ausführt. So ist gesichert, dass die
Kurbelwelle immer in Bewegung bleibt. Grössere Motoren haben daher den
Vorteil, dass zwei Zylinder gleichzeitig arbeiten. Dadurch erhöht sich
insgesamt die
Leistung des Motors. So gesehen, kann man anhand der
Zylinder auf die Leistung des Motors Rückschlüsse ziehen.
Diese dreht sich nun in die Richtung, in der sie den
geringsten
Widerstand hat. Das darf aber zur richtigen Funktion nur in
einer bestimmten Rich-tung erfolgen, deshalb wird die Drehrichtung beim
Starten des Motors vorgegeben. Es reicht, wenn man die Kurbelwelle mit einer anderen Möglichkeit dreht. So wird die Dreh-richtung vorgegeben und der Dieselmotor startet automatisch. Bei einem Ottomotor muss noch die Versorgung der Zündkerzen sicher gestellt werden.
So gesehen ist der Selbstzünder ein sehr einfacher Motor, der kaum fremde
Energie benötigt, wenn er einmal in Betrieb steht. Ein Punkt, der klar für
diese Bauweise spricht.
Die
Kurbelwelle führt zwei Umdrehungen aus, bis wieder frische Luft in den
Zylinder geführt wird. Das Prinzip nutzt den
Treibstoff sehr gut aus, da
er erst in den Raum gelangt, wenn sämtliche
Ventile geschlossen wurden.
Das ist der grosse Vorteil gegenüber den Zweitaktmotoren, wo der
Treibstoff ungenutzt entweichen kann. Weiter betrachten müssen wir die
Funktion nicht mehr, denn es kommen nur noch Wiederholungen.
Ihnen ist
vermutlich aufgefallen, dass bei der Beschreibung so komische Begriffe
vorhanden waren. Unter
Zylinder und
Kolben können Sie sich vielleicht noch
etwas vorstellen, aber was ist eine
Nockenwelle und wieso wird diese
Kurbelwelle benötigt. Es wird Zeit, dass wir uns mit dem Aufbau von
Verbrennungsmotoren befassen. Dazu nehmen nun den Motor mit Einspritzung.
Nur die
Einspritzdüse gibt es beim Ottomotor nicht.
|
|||||
| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | |||
| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | |||
| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | |||
| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | |||
| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | |||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||
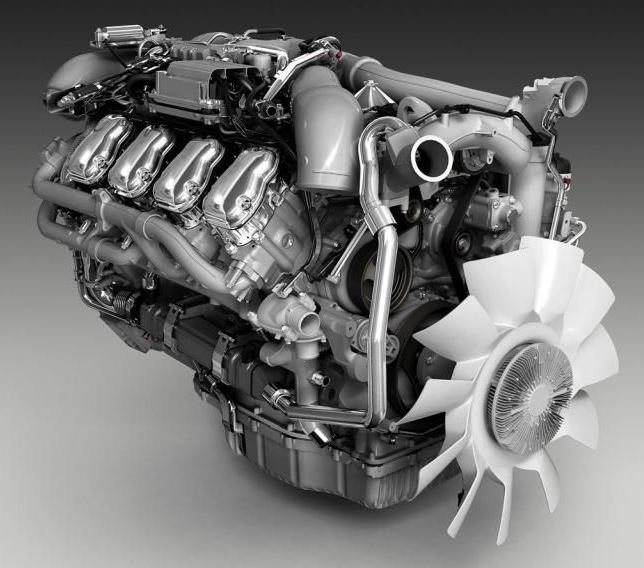 Wenn
wir nun mit den selbstzündenden Motoren arbeiten, dann bestehen die
Unterschiede bei der Wirkung von
Wenn
wir nun mit den selbstzündenden Motoren arbeiten, dann bestehen die
Unterschiede bei der Wirkung von
 Die
Idee von
Die
Idee von
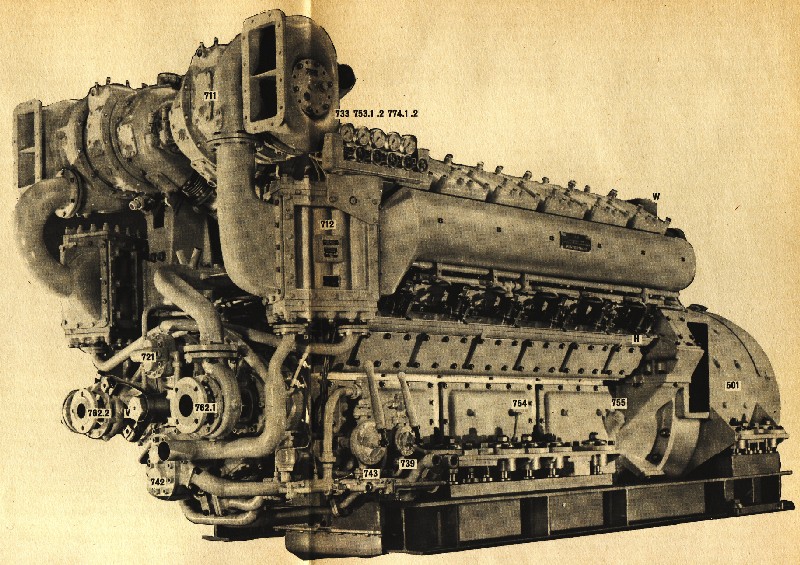 Genau
genommen handelt es sich um einen Vier-takt-Dieselmotor. Das heisst, der
Motor arbeitet in vier Takten. Sie haben schon von einem Takt gehört? Ja,
in der Musik geht nichts ohne einen Takt, da spricht man vom 3/4 oder 4/4
Takt.
Genau
genommen handelt es sich um einen Vier-takt-Dieselmotor. Das heisst, der
Motor arbeitet in vier Takten. Sie haben schon von einem Takt gehört? Ja,
in der Musik geht nichts ohne einen Takt, da spricht man vom 3/4 oder 4/4
Takt. Wie knapp
vor dem Ende des zweiten Taktes einge-spritzt wird, ist eine Einstellung,
die nur von Profis gemacht wird. Durch den Kontakt des fein zerstäubten
Wie knapp
vor dem Ende des zweiten Taktes einge-spritzt wird, ist eine Einstellung,
die nur von Profis gemacht wird. Durch den Kontakt des fein zerstäubten
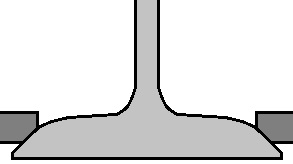
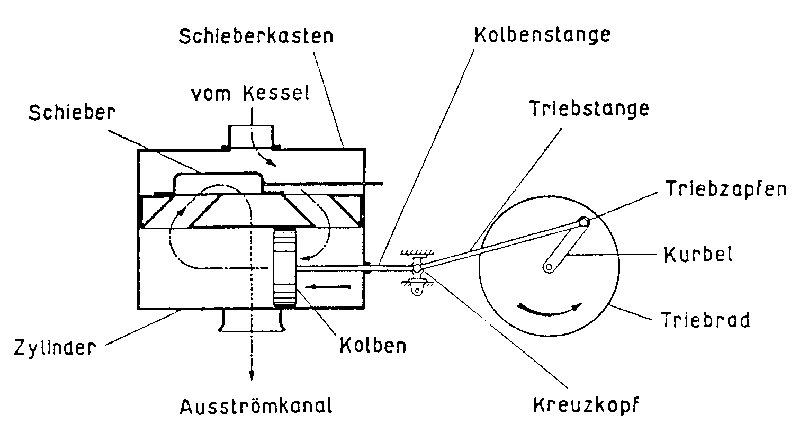 Wie bei der
Wie bei der