|
Laufwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Damit kommen wir zum
Fahrwerk der
Lokomotive. Dessen
Aufbau erkennen wir, wenn wir einen Blick auf die
Achsfolge werfen. Diese
wurde bei der Lokomotive mit 2’ C 1’ angegeben. Damit war nicht, wie man
erwarten konnte, die
Laufachse führend, sondern das zweiachsige
Drehgestell. Diese Lösung musste jedoch wegen der elektrischen Ausrüstung
so gewählt werden. Für uns bedeutet das, dass wir eine definierte
Richtung haben.
Dabei wurde jede Achse mit innen liegenden Lagern im Rahmen geführt. Die vertikale Bewegung konnte durch das Lager selber mit einer Gleitbahn aufgenommen werden. Die hier
vorhandenen seitlichen Gleitbahnen konnten mit einem einfachen
Schmiermittel, wie zum Beispiel
Fett, ge-schmiert werden. Einen etwas grösseren Aufwand musste man jedoch beim
eigentlichen Rotationslager betreiben. Diese
Lager waren wegen der hohen
Drehzahl der
Achse einer grösseren Belastung ausgesetzt. Daher mussten die
Lagerschalen zur besseren
Schmierung mit
Weissmetall ausgekleidet werden.
Um eine weitere Verbesserung dieser
Gleitlager zu erhalten und um die
Erwärmung darin zu reduzieren, wurden diese Lager mit
Öl geschmiert. Montiert wurden die drei
Triebachsen jeweils in einem
Abstand von 2 350 mm. Damit trotz den drei im Rahmen gelagerten
Achsen,
Kurven problemlos befahren werden konnten, wurde die mittlere Achse mit
einem seitlichen Spiel von jeweils 15 mm versehen. So konnte die
Lokomotive auch enge Radien von 100 Meter problemlos durchfahren. Der
feste Radstand der Lokomotive stieg bei den Triebachsen jedoch deswegen
auf 4 700 mm an. Auf jeder Seite wurde auf der
Achse ein
Rad
aufgeschrumpft. Dieses Rad bestand aus dem
Radkörper, der als
Speichenrad
ausgeführt wurde und der darauf aufgezogenen
Bandage mit
Lauffläche und
Spurkranz als Verschleissteil. Es war eine übliche Ausführung und der
gewählte Durchmesser von 1 610 mm entsprach den
Triebrädern anderer
Baureihen. Insbesondere galt das für die zur gleichen Zeit von den anderen
Herstellern gelieferten Modellen.
Diese Lösung hatte sich bisher bei vielen
Baureihen bewährt, so dass sie auch hier angewendet wurde. Man konnte sich
hier wegen der kurzen Bauzeit keine Exprimente leisten. Somit entsprach
der ge-samte Aufbau der Baureihe Ce 6/8 II. Die drei Triebachsen der Lokomotive erhielten na-hezu gleichmässig ausgeglichene Achslasten. So wurden die Triebachsen bei den Maschinen mit den Nummern 10 401 bis 10 420 mit Achslasten von 17.9 bis 18.7 Tonnen festgelegt, wobei nur die dritte Triebachse abgefallen war. Bei den anderen Maschinen änderte sich dieser Wert nur unwesentlich, so
dass hier Werte von 18.7 bis 18.8 Tonnen erfasst wurden. Abgefallen war
nun jedoch die erste
Triebachse. Wir können jedoch erkennen, dass es bei einer
Lokomotive mit stabilen Rahmen nicht sehr leicht war, die
Achsen
auszugleichen. Zudem hatten die Hersteller, in unserem Fall die MFO immer
wieder Probleme, die vorgegeben Werte einzuhalten. Damit können wir aber
auch erkennen, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei der
Bestimmung der
Leistung eine ganz gute Ahnung hatten, was machbar ist und
was utopisch ist. Damit die
Achslasten bei den drei
Triebachsen beim
Befahren von
Kuppen und
Senken, nicht zu sehr auf einzelne
Achsen
verschoben wurden, baute man zwischen den
Federn Ausgleichshebel ein.
Diese Hebel verteilten die Kräfte so, dass immer ausgeglichene Achslasten
vorhanden waren. Diese Hebel wurden sowohl zwischen den Triebachsen eins
und zwei, als auch zwischen der dritten Triebachse und der nachlaufenden
Laufachse eingebaut.
Dieses Drehgestell nach der Bauart SLM entsprach in der Ausführung und in der Abstützung genau den Modellen, wie sie auch bei der Baureihe Ae 3/6 I aus dem Hause BBC verwendet wurden. Daher konnten die
Laufdrehgestelle
zwischen diesen bei-den Baureihen ohne grossen Aufwand für Anpassungen
ausgewechselt werden. Das
Laufdrehgestell besass einen innenliegenden
Rahmen, der aus einzelnen Blechen erstellt wurde. Auch hier wur-den diese
mit Nieten so verbunden, dass ein stabiler
Drehgestellrahmen entstand.
Gegen das Ende der
Lokomotive wurde das
Drehgestell zudem mit zwei
Schienenräumern versehen. Diese wiederum entsprachen der üblichen Ausführung,
so dass bei den oft beschädigten Teilen vorhandene Ersatzteile genutzt
werden konnten. Auch die beiden im
Drehgestell gelagerten
Laufachsen
liefen in den damals üblichen
Gleitlagern. Dabei wurde auch hier die
Führung der
Achslager im Rahmen mit
Fett geschmiert, was wegen der
geringen Anzahl von Bewegungen ausreichend war. Ein seitliches Spiel, wie
bei der mittleren
Triebachse, war im Drehgestell jedoch nicht vorhanden,
da dieses nach dem damaligen Kenntnisstand bei zwei
Achsen nicht benötigt
wurde. Das Rotationslager der
Laufachse war, wie jenes der
Triebachsen mit
Lagerschalen aus
Weissmetall versehen worden. Auch hier
kam eine Sumpfschmierung mit
Öl zur Anwendung. Wegen den Bewegungen des
Drehgestells, waren diese
Achsen jedoch nicht an der zentralen
Schmierpumpe der
Lokomotive angeschlossen worden. Sie mussten daher vor
Ort geschmiert werden, was jedoch bisher bei allen Laufachsen so gelöst
worden war. Abgefedert wurden die
Achsen gegenüber dem
Drehgestell mit einer kombinierten
Federung. Diese bestand aus einer hoch
liegenden
Blattfeder, die sich über zwei
Schraubenfedern auf dem Rahmen
abstützte. Diese Lösung war schon bei den Dampflokomotiven der Baureihe
A
3/5 verwendet worden und sie erlaubte eine gute Abfederung der
Laufachsen,
die stärker beansprucht wurden, als die
Triebachsen, die nicht direkt an
der Führung beteiligt waren.
Das war grösser, als in den
Laufdrehgestellen der Dampf-lokomotiven, jedoch entsprach der Durchmesser
damit den
Laufachsen, wie sie bei den elektrischen Maschinen für die
Gotthardstrecke verwendet wurden. Der Rahmen der Lokomotive stützte sich mit einem Kugel-drehzapfen auf das Drehgestell und dessen Aufnahme ab. Dieser Drehzapfen war so geführt, dass er sich seitlich um bis zu 80 mm aus der Mitte bewegen konnte. Mit Ausnahme der Längsrichtung konnte das
Drehgestell jedoch alle weiteren Bewegungen ungehindert ausführen.
Zusätzliche
Blattfedern verhinderten jedoch, dass das Drehgestell ins
Schlingern geraten konnte. Die Achslasten auf dem Drehgestell waren verhältnismäs-sig hoch und sie verteilten sich gleichmässig auf die beiden Achsen. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 10 401 bis 10 420 wurden hier Werte von 14.6 Tonnen erreicht. Das war mehr als eine Tonne mehr, als
vorgesehen. Bei den Maschinen ab der Nummer 10 421 konnte die
Achslast des
Drehgestells leicht gemildert werden, so dass hier noch 13.5 Tonnen
erreicht wurden. Wir erkennen, dass die buchhalterisch leichteren
Lokomotiven mit den Nummern 10 421 bis 10 460 anders abgefedert wurden und
so der Gewichtsverlust ausschliesslich auf den
Laufachsen erfolgte.
Wichtig war das, weil so das bei solchen Lokomotiven wichtige
Adhäsionsgewicht nicht verändert wurde. Nebeneffekt war, dass sich das
Drehgestell wieder den Vorgaben näherte und so etwas geringere
Achslasten
bekam.
Dabei war der Hilfsrahmen dieser
Laufachse mit einer Deichsel am
Hauptrahmen der
Lokomotive beweglich befestigt worden. Gegen das Ende des
Hilfsrahmens wurden dann noch die beiden
Schienenräumer dieser
Fahrrichtung montiert. Um diesen Drehpunkt konnte sich die
Laufachse daher
aus der Längs-achse vertikal und seitlich bewegen. Dabei gab es zwischen
den
Lokomotiven dieser Baureihe Unterschiede. Bei den Nummern 10 401 bis
10 420 wurde eine seitliche Auslenkung von 83 mm in beide Richtungen
vorgesehen. Bei den später ausgelieferten Modellen wurde dieses seitliche
Spiel jedoch auf zweimal 70 mm reduziert, was auf die minimalen
Kurvenradien jedoch keinen Einfluss hatte. Um die
Laufachse, die wegen der Deichsel leicht ins
Schlingern geraten konnte, zu stabilisieren, wurde sie zusätzlich mit
kräftigen
Blattfedern versehen. Diese speziellen Zentrierfedern bewirkten,
dass sich die Laufachse nur gegen die Kraft der
Feder seitlich auslenken
konnte. Die Laufachse wurde so in
Kurven gegen die äussere
Schiene
gedrückt. Die
Federung verhinderte nun dank der Rückstellkraft, dass die
Kräfte im
Spurkranz zu gross wurden. Sowohl die
Lagerung, als auch der Aufbau der
Laufachse entsprach jenen im
Drehgestell. Selbst die Abfederung mit der
hochliegenden
Blattfeder, die sich auf zwei
Schraubenfedern abstützte, war
identisch ausgeführt worden. Es konnten so Ersatzteile eingespart werden
und dieser Punkt wurde mit den elektrischen
Lokomotiven schon sehr früh
eingeführt. Gerade bei
Achsen war dies wichtig, da diese viel Platz
benötigen. Das Gewicht der
Lokomotive wurde über ein am
Hauptrahmen montiertes und geschmiertes Querblech und die Aufnahme der
Laufachse auf diese übertragen. Dabei wurden bei den Lokomotiven mit den
Nummern 10 401 bis 10 420 für die Laufachse eine
Achslast von 14 Tonnen
erreicht. Bei den anderen Modellen dieser Serie konnte dieser hohe Wert
leicht vermindert werden, so dass hier noch eine Achslast von 13.4 Tonnen
vorhanden war. Mit der letzten
Laufachse können wir uns dem gesamten
Radstand der
Lokomotive ansehen. Dieser Wert wurde mit 10 800 mm
angegeben. Er war bei den elektrischen Lokomotiven nicht mehr so wichtig,
wie noch bei den Dampfmaschinen, da die elektrischen Vertreter selten
Drehscheiben aufsuchen mussten. Trotzdem konnten auch kurze Modelle in den
Depots problemlos benutzt werden. Tiefere Werte erreichte nur noch die
SAAS mit der Ae 3/5. Die
Lokomotive steht nun auf den eigenen
Achsen. Es
wird daher Zeit, wenn wir wieder zum Messband greifen. Diesmal soll die
effektive Höhe ohne Berücksichtigung des Federweges bestimmt werden. Für
den Kasten wurde ein Wert von 3 750 mm angegeben. Der höchste Punkt wurde
beim Dachaufbau, beziehungsweise bei den
Stromabnehmern erreicht. Hier
konnte ein Wert von 4 433 mm erfasst werden. Damit war auch jetzt das
Lichtraumprofil eingehalten. Damit aus den drei im Rahmen der
Lokomotive
gelagerten
Achsen auch
Triebachsen wurden, mussten diese mit einem
Antrieb
versehen werden. Um das erforderliche
Drehmoment zu erzeugen wurden zwei
identische
Fahrmotoren benötigt. Diese wurden im Rahmen montiert und
besassen auf beiden Seiten die entsprechenden Ritzel. Um Schläge auf die
Motorwelle aufzufangen waren diese, wie schon bei der Reihe
Ce 6/8 II
gefedert ausgeführt worden. Die Ritzel griffen in die auf den
Vorgelegewelle
gelagerten
Zahnräder, welche dank einem Ölbad geschmierte Zahnflanken
hatten. Das so entstandene
Getriebe hatte eine
Übersetzung von
1 :
2.224.
Somit erfolgte hier die Anpassung der Drehzahl des
Fahrmotors an jene der
Triebachsen. Eine weitere Übersetzung war wegen dem Aufbau des
Antriebes
nicht mehr vorhanden und wurde auch nicht mehr benötigt, da das Getriebe
ausreichend bemessen war.
Die hier
angebrachten
Drehzapfen drehten in einem Radius von 600 mm und ihre
Position war auf beiden Seiten um 90° versetzt ausgeführt worden. Damit
sollte mit diesem Versatz nur noch das hohe Gewicht des
Antriebes
ausgeglichen wer-den. Zwischen den beiden Drehzapfen der beiden Vorgelegewel-len wurde schliesslich der bei elektrischen Lokomotiven benötigte Dreiecksrahmen aufgehängt. Die Gleitlager zu den Drehzapfen waren aus Weissmetall und sie mussten regel-mässig geschmiert werden. Wie
bei den bisherigen Maschinen kam auch hier eine Nadel-schmierung zur
Anwendung. Daher waren für das Personal keine Neuerungen in diesem Bereich
zu finden. Die nun entstandene Bewegung wurde auf die zweite Trieb-achse übertragen. Dazu ruhte deren Kurbelzapfen direkt im Dreiecksrahmen. Damit nun aber die
Federung der
Triebachse im
Antrieb
ausgeglichen werden konnte, wurde das
Achslager, das eine Nadelschmierung
besass, in einer Gleitbahn gehalten. So konnte sich das
Lager nach oben
und unten frei bewegen. Spezielle Einlagen erlaubten hier die einfache
Nachstellung der Gleitelemente.
Wegen diesem Anschluss
der
Triebachsen mussten diese beiden
Achsen jedoch korrekterweise als
Kuppelachsen bezeichnet werden. Ein Punkt, der jedoch nebensächlich war. Durch die Laufflächen der drei Triebachsen wurde das von den beiden Fahrmotoren erzeugte Drehmoment schliesslich in Zugkraft umgewandelt. Dazu war für die benötigte Haftreibung ein Adhäsionsgewicht von 56 Tonnen vorhanden. Das reichte auf trockenen
Schienen für die
korrekte Übertragung der später noch vorge-stellten
Anfahrzugkraft aus, war
jedoch bei nassen Schienen zu gering. Die entsprechenden Erfahrungen hatte
man schon bei den
Dampfmaschinen gemacht. Um bei schlechtem Zustand der Schienen die Zugkraft besser auf dieselben zu übertragen, waren vor den vorlaufenden Triebachsen Sander montiert worden. Hier muss erwähnt werden, dass
Lokomotiven mit
Stangenantrieb weniger
Sander benötigten, als die Modelle mit
Einzelachsantrieb. Der Grund lag bei der starren
Verbindung der einzelnen
Triebachsen. So musste nur die erste mit Sand bestreut werden und das
Verhalten besserte sich. Die für den Quarzsand benötigten Behälter wurden beim Führerstand zwei Stück in diesem selber eingebaut. Sie wurden mit einfachen Deckeln abgedeckt, die dem Lokomotivpersonal auch als Sitzgelegenheit dienten. Wegen der Distanz war diese Lösung auf der Seite des
Führerstandes eins nicht möglich. Daher wurde hier in der linken Wand
zwischen dem zweiten und dritten Seitenfenster der entsprechende Deckel
eingebaut. Da der Quarzsand ein wichtiger Teil des Gewichtes für das Betriebsmaterial war, sollten wir uns diesen veränderlichen Teil ansehen. Angegeben wurden hier total 0.6 Tonnen. Darin enthalten waren
jedoch die mitgeführten
Schmiermittel, Ersatzteile, Werkzeuge und
natürlich der in den Behältern enthaltene Sand, der alleine rund 500 Kg an
das Gewicht des Betriebsmaterials beisteuerte. Damit erkennen wir, dass
ausreichend Sand mitgeführt wurde. |
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
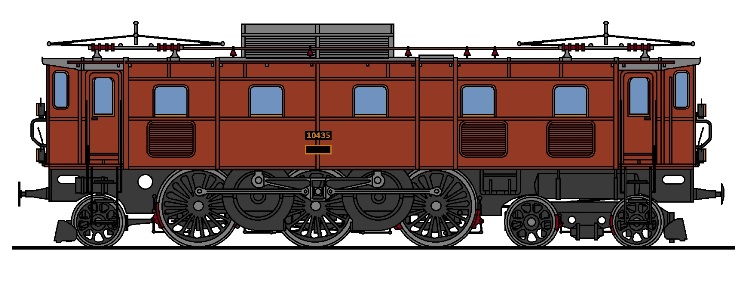 Beginnen werde ich die Betrachtung des
Beginnen werde ich die Betrachtung des
 Um die
Um die
 Wir können nun zu den drei
Wir können nun zu den drei
 Beide in einem Abstand von 2 150 mm eingebauten
Beide in einem Abstand von 2 150 mm eingebauten
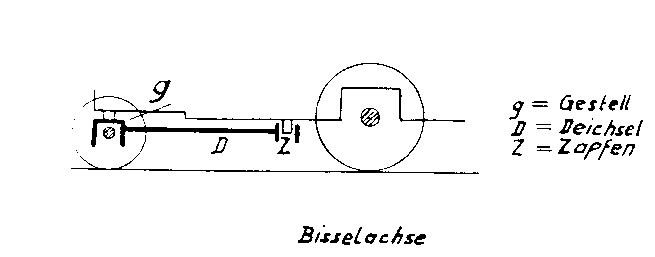 Damit bleibt eigentlich nur noch die sechste
Damit bleibt eigentlich nur noch die sechste 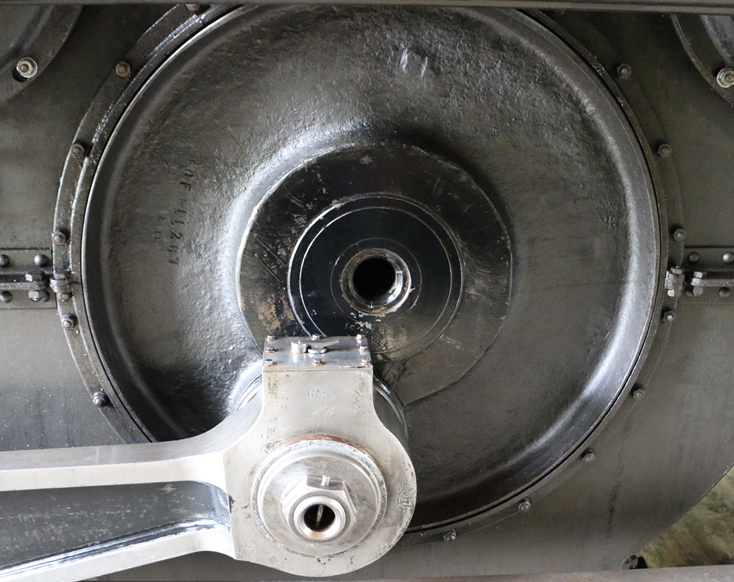 Auch die
Auch die
 Die beiden äusseren
Die beiden äusseren