|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bei Dampflokomotiven waren grössere Umbauten eher
selten. Die Technik mit
Kessel und
Dampfmaschine war einfach aufgebaut und
daher kam es zu wenigen Problemen. Waren diese Schwierigkeiten jedoch
vorhanden, wurde einfach der Bau angepasst. Zu einem Umbau bestehender
Modelle kam es jedoch selten und dann auch nur, wenn es lauftechnische
Probleme waren. Gerade in diesem Punkt, war die hier vorgestellte
Maschinen nicht optimal.
Besonders beim Vergleich mit
den älteren Modellen aus der Zeit der
JS wirkten sich hier die beiden
Dampfmaschinen zu-sätzlich negativ aus. Die
Lokomotive taumelte daher immer
etwas. Letztlich musste ein Entscheid gefällt werden. Der
Verschleiss in den engen Bögen war das grössere Problem, so dass das
ursprüngliche
Laufwerk beibehalten wurde. Die veränderten Maschinen wurden
jedoch nicht angepasst. Sie sehen, dass selbst misslungene Versuche nicht
mehr korrigiert wurden. Das war eine direkte Folge des Einsatzes, denn
Dampflokomotiven blieben ihren
Depots stets treu ergeben und so fand sich
schnell die passende Strecke. Man konnte die Baureihe B 3/4 nicht gerade als
Gelungen bezeichnen. Das Modell hatte Mängel, die bereits während dem Bau
angepasst werden mussten. Das Problem mit der Laufruhe haben wir bereits
kennen gelernt. Weitaus grösser war da schon das Problem mit dem
Kessel.
Das war so schlimm, dass die Anpassungen während dem Bau vorgenommen
wurden. Es stellt sich somit die Frage, wo denn das grosse Problem zu
finden war? Natürlich könnte man davon ausgehen, dass der Aufbau
des
Kessels der Baureihe
Eb 3/5 angepasst wurde. Identische Kessel gäben
grosse Vorteile bei der Vorhaltung von Ersatzteilen. Das war sicherlich
bei der Wahl ein Grund, aber die bereits vorhandenen Maschinen wurden
nicht mit dem neuen Kessel versehen. Daher kann diese Theorie verworfen
werden. Das Problem bei der Baureihe B 3/4 war wirklich grösser, als man
vermuten könnte.
Wir müssen uns daher kurz den Betrieb einer
Dampflokomotive ansehen. Während der Beschleunigung wurde sehr viel Dampf
benötigt. Dieser konnte im
Kessel nur bedingt erzeugt werden. In der Folge
sank der Druck im Kessel. Dieser wurde bei der anschliessenden Fahrt mit
geringeren
Zugkräften, oder mit abgestellter und daher nicht arbeitender
Dampfmaschine wieder ausgeglichen. So stand der optimale Druck wieder
bereit. Im Einsatz der Baureihe B 3/4 mit den vielen
Haltestellen, wiederholte sich das in kurzer Folge. Daher war auch die
Zeit um den Druck wieder zu ergänzen nur sehr kurz. Wurde dann noch Dampf
für die
Zugsheizung benötigt, konnte es passieren, dass der
Lokomotive der
Schnauf ausging. Es musste ein längerer Halt eingelegt werden um wieder
den Druck zu ergänzen. Auf den
Fahrplan und deren Einhalt-ung wirkte sich
das negativ aus. Bereits bei den beiden
Prototypen zeigte sich
schnell, dass in gewissen betrieblichen Situationen die Produktion des
Dampfes unzureichend war. Da aber die Versuche nur sehr kurz waren,
konnten sich diese Erfahrungen nicht auf die ersten Maschinen auswirken.
Erst als diese im Betrieb zeigten, dass es nicht immer möglich war, den
Druck ausreichend zu ergänzen, musste der
Kessel angepasst werden. Da war
jener der Baureihe
Eb 3/5 gerade richtig.
Man kann davon
ausgehen, dass aber bei einem neuen
Kessel das verbesserte Modell
verwendet worden wäre. Da es jedoch nicht dazu kam, blieben die
Differenzen vorhanden. Doch es gab noch ein grösseres Problem mit dem
Kessel. Der Verbrauch beim Dampf war bei der Baureihe B 3/4 wirk-lich gigantisch. Die beiden grossen Dampfmaschinen benötig-ten eine grosse Menge davon. In Anbetracht, dass mit diesem Modell durchaus die Zugkräfte der grossen Schnellzugslokomotiven erreicht werden konnten, war das nicht verwunderlich. Wurde dann noch Dampf für andere Verbraucher
benötigt, sank der Druck im
Kessel schnell ab. Der
Heizer musste diesen
wieder ergänzen. So musste die Verbrennung optimal ausgeführt werden.
Je-doch konnte auch diese nicht immer optimal erfolgen. Zwar wurden
entstandene Löcher in der Glut sofort mit neuer
Kohle zugedeckt, aber
diese musste zuerst noch entfacht werden und das dauerte einen Moment. In
diesem Fall stand daher auch nicht die optimale Wärme bereit, was
natürlich die Produktion beim Dampf weiter schmälerte. Der
Heizer musste
daher das Feuer dem
Fahrplan anpassen.
Jedoch hatte der Verbrauch beim Dampf zur Folge, dass
der Pegel beim Wasser schnell sinken konnte. Aus diesem Grund musste im
Kessel das Wasser ergänzt werden. Dazu waren die Abdampfinjektoren
vorhanden und diese funktionierten nur, wenn die
Dampfmaschinen liefen.
Das hatte zur Folge, dass ausgerechnet während der Beschleunigung kaltes
Wasser in den Kessel geleitet wurde. Auf den Druck wirkte sich das
verheerend aus.
Kurz bevor die Beschleunigung beendet wurde, erfolgte die Nachspeisung mit den Injektoren. Der nun folgende Leerlauf der Lokomotive konnte dazu genutzt werden, um den Druck wieder zu ergänzen. Eine optimale Lösung, die jedoch gute Kenntnisse der Strecke verlangten.
Auf Abschnitten mit anhaltender Steigung, musste daher eine Einbusse bei
der
Leistung in Kauf genommen werden. Sie sehen es war keine leichte
Aufgabe immer den optimalen Druck zu finden. Der
Heizer musste daher genau wissen, wann der
Lokführer den
Regulator schloss und kurz davor den
Injektor starten. Bei
Regionalzügen war das sehr oft der Fall. Mit anderen Worten es gelang
nicht immer. Das führte dazu, dass bei einer ungeschickten Mannschaft in
einem
Bahnhof während dem Stillstand Wasser gekocht werden musste. Viel
schlimmer war jedoch der Wasserstand, der in diesem Fall auf einen
gefährlichen Wert sank. Gerade dieser war ausgesprochen gefährlich, da es in
dem Moment zu einer Explosion des
Kessels kommen konnte. Wollte man das
Problem beheben, musste jedoch die
Nachspeisung verändert werden. Aus
diesem Grund baute man die
Lokomotiven um. Neu konnte das Wasser aus dem
Tender mit der Hilfe einer Speisewasserpumpe in den Kessel befördert
werden. Zur Sicherheit blieben aber die
Injektoren weiterhin im Einsatz.
Der Betrieb des
Kessels wurde daher verbessert, da nun die Zeit
mit der Verzögerung genutzt werden konnte, um den Druck wieder zu
ergänzen. Trotzdem sollte es gerade hier immer wieder eine enge Geschichte
werden. So funktionierte die Lokomotive recht gut. Trotzdem war der Verbrauch beim Dampf immer sehr hoch, was sich natürlich bei den Betriebskosten niederschlug. Gerade in diesem Punkt zeigte sich, dass die Modelle mit Ver-bund bei den Dampfmaschinen etwas besser bei der Ausnutzung des Dampfes waren. Trotzdem sollten sich auch in anderen Ländern die
Zwillinge durchsetzen. Die einfache Konstruktion war dafür verantwort-lich. Wir können daher feststellen, dass die Maschinen
nicht beson-ders gut gelungen waren. Die Verbesserungen beim
Kessel
linderten die grössten Probleme. Trotzdem kam es zu keinen grösseren
Umbauten und auch die Beendigung der Auslieferung hatte nicht mit den
erwähnten Problemen zu tun. Vielmehr hatten im Jahr 1918 die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschlossen, die
Hauptstrecken mit einer
Fahrleitung zu versehen. Mit den neuen elektrischen
Lokomotiven sollte auch
nicht mehr so viel in die alten Dampflokomotiven investiert werden. Es war
abzusehen, dass diese verschwinden würden und daher lohnte sich ein Umbau
schlicht nicht mehr. Das bemerkte nicht nur diese Baureihe, sondern auch
die anderen Dampflokomotiven. Doch gerade die neuen Maschinen sorgten für
eine Veränderung, die alle
Dampfmaschinen betreffen sollte.
Das schwere Zugsunglück von Bellinzona im Jahre 1923
zeigte, dass
Gas und Feuer keine gute Kombination sind. Aus diesem Grund
wurde nur ein Jahr später in der Schweiz die
Beleuchtung mit Gas verboten.
Davon betroffen waren sowohl die Wagen, als auch die
Lokomotiven. Bei den
letzteren waren es die mit Kalziumkarbid betriebenen Laternen. Das dort
erzeugte Acetylengas durfte somit nicht mehr verwendet werden. Aus diesem Grund wurden neue Laternen eingeführt.
Diese wurden mit
Leuchtpetrol betrieben. Der Vorteil des verwendeten
Petrols war, dass dieses erst unmittelbar bei der Verbrennung gasförmig
wurde. Damit konnte die Verbrennung kontrolliert durchgeführt werden. Es
sollte durch die Lampen nicht mehr zu Explosionen kommen. Ironie dabei
war, dass der
Kessel die unmittelbare Gefahr war und letztlich auch dieser
in Bellinzona zum Brand führte. Nachteil bei der Lösung mit
Leuchtpetrol war, dass
diese Flamme nicht mehr so hell leuchtete. Jedoch war das kein grosses
Problem, denn die
Dienstbeleuchtung war eigentlich nicht dazu vorgesehen,
dass in der Nacht vor der
Lokomotive etwas erkannt werden konnte. Vielmehr
sollte damit das Personal der Strecke über die betriebsbereite Lokomotive
informiert werden. Das funktionierte auch mit dem gelblichen Licht der
neuen Laternen. Weitere grössere Anpassungen gab es jedoch nicht
mehr. Die Baureihe B 3/4 hatte ihre Probleme, jedoch waren diese nicht so
gross, dass sich ein Umbau gelohnt hätte. Die etwas schwächeren Modelle
wurden einfach entsprechend eingesetzt. Das war jedoch ein Problem des
Betriebes und kein Umbau. Selbst der Anstrich wurde während dem ganzen
Einsatz nicht verändert. Dampflokomotiven waren daher wirklich selten
umgebaut worden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
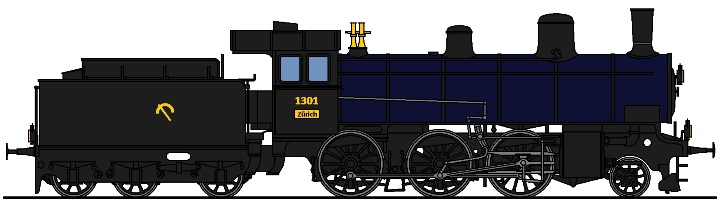 Bei hohen Geschwindigkeiten war die Laufruhe der
Bei hohen Geschwindigkeiten war die Laufruhe der
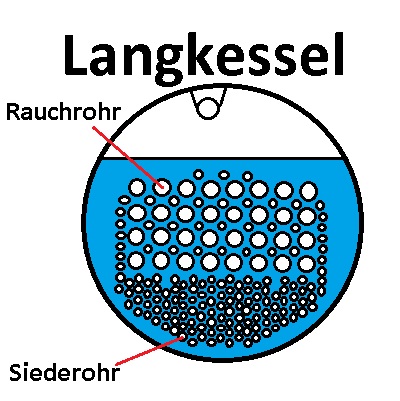 Die Maschine war nicht optimal ausgewogen worden.
Dabei waren es nicht die
Die Maschine war nicht optimal ausgewogen worden.
Dabei waren es nicht die
 Auf einen Umbau der älteren nicht so gut abgestimmten
Modelle verzichtete man jedoch. So schlecht waren die
Auf einen Umbau der älteren nicht so gut abgestimmten
Modelle verzichtete man jedoch. So schlecht waren die
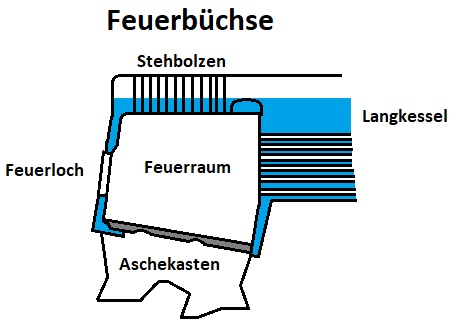 Um den
Um den
 Der Vorteil der Speisewasserpumpe bestand darin, dass
diese auch aktiviert werden konnte, wenn die
Der Vorteil der Speisewasserpumpe bestand darin, dass
diese auch aktiviert werden konnte, wenn die
