|
Farbgebung und Anschriften |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Ein oft diskutiertes Thema in den
Fachkreisen ist die Farbgebung der
Lokomotiven.
allgemein bekannt ist, dass neu eröffnete Bahnen sich damit auch keine
grossen Gedanken machten. Das führte dazu, dass die Anstriche von den
Herstellern definiert wurden. Dabei ist spannend, dass diese durchaus auf
die gleichen Lösungen kamen. Hier haben wir nun aber eine Lokomotive, die
an eine bestehende Bahn geliefert wurde.
Die hier verwendeten Lacke waren speziell
für die Zweck entwickelt worden. Sie sorgten für eine gute Haft-ung auf
dem Metall und das war für den Schutz sehr wichtig, denn die Feuchtigkeit
musste zuerst unter diese Farbschicht gelangen. Aufgetragen wurde dieser Schutz vor Rost
auf allen behandelten Bereichen. Dabei gab es jedoch auch Orte, wo die
Mittel nicht optimal wirkten. Das waren die
Bandagen,
die auch thermisch stark belastet wurden. Das hätte damals schlicht dazu
geführt, dass die Lacke verbrannt worden wären. Um das zu verhindern,
wurden diese nicht mit einem Farbauftrag versehen. In der Schweiz war das
durchaus üblich. Ebenso auf einen Farbauftrag verzichten
musste man bei den geschmiedeten Bereichen des
Stangenantriebs.
Diese Bereiche wurden durch die Bearbeitung so stark verfügt, dass die
damals verwendeten Lacke schlicht nicht haften blieben. So wurde auf den
Farbauftrag verzichtet. Zum Schutz der nun blanken Metalle wurde ein
Gemisch aus
Petrol
und
Öl
aufgetragen. Das wirkte gut, musste aber immer wieder erneuert werden. Alle anderen Bereiche der
Lokomotive
wurden mit einem Farbauftrag versehen und das betraf auch den
Kessel.
Es gab damals bereits erste Lokomotiven, die in diesem Bereich das neue
Russenblech
verwendeten. Bei der schweren
Güterzugslokomotive
wurde dieses teure Metall jedoch nicht verwendet und so musste der
Farbauftrag auch am Kessel ausgeführt werden. Dazu war die zweite
Farbschicht mit den beigemengten Pigmenten verantwortlich.
Da Lokomotiven im Güterverkehr nie zu den Glanz-stücken einer Bahngesellschaft gehörten, gab es auch hier einen eher schlicht wirkenden Anstrich. So wurden die behandelten Bereiche ohne
Aus-nahme mit einem schwarzen Farbauftrag versehen. Abweichungen davon gab
es nur bei Metallen, die keine Farbe benötigten. Bei der
Gotthardbahn hatte sich im Betrieb der
älteren
Baureihen
gezeigt, dass diese Farbe sehr gut mit den Verschmutzungen harmonierte. Da
es damals schlicht noch nicht bekannt war, dass man Fahrzeuge auch waschen
konnte, war die Wahl effektiv gar nicht so falsch. Wir haben erstmals die
Farbwahl erhalten, die später üblich wurde, weil sich damit im Betrieb
wirklich die grössten Vorteile ergeben hatten. Auch wenn sich dieser Anstrich später
durchsetzen konnte, die
Gotthardbahn sah es etwas anders. So
sollte dieser eher bescheidene Anstrich bei der hier vorgestellten
Lokomotive
etwas aufgelockert werden. Dazu wurden aber nicht die üblichen Lösungen
mit anderen Farben gewählt. Die Reihe
A2 hatte bereits gezeigt, dass die Leute bei der Gotthardbahn nicht so
stur an einem Anstrich hingen, wie das bei anderen Bahnen der Fall war. Hier wurde der komplett schwarze Anstrich
daher aufgelockert. Bei der
Lokomotive
für den
Güterverkehr
wurden dazu feine rote Zierlinien verwendet. Diese waren damals auch bei
den
Personenwagen
in Mode und daher waren sie nicht so sehr überraschend, wie man meinen
könnte. Der Lokomotive half das den biederen Anstrich etwas zu verbessern.
Es war ein gefällig wirkender Anstrich für die
Baureihe
D6 entstanden.
Die Modelle der Gotthardbahn verkehrten auf deren Strecken und daher sah man es nicht als notwendig, dass an der Loko-motive ein Hinweis auf den Besitzer vor-handen war. Eine Praxis, die damals durchaus auch bei
anderen Bahnen angewendet wurde. Wenn wir die nun bekannten Hinweise zusammenfassen, dann war schnell klar, dass die Güterzugslokomotive nicht zu den Schmuckstücken der Bahngesellschaft gehörten. Es waren Arbeitstiere, denen nicht zu viel
Beachtung geschenkt wurde und unter diesem Gesichtspunkt waren die roten
Zierlinien bereits viel, denn in der Schweiz waren
Lokomotiven
immer schlicht gehalten und in diesem Punkt unterschied sich die
Gotthardbahn nicht. Deutlich wichtiger war jedoch die
Betriebsnummer. Diese diente der klaren Zuordnung jeder
Lokomotive.
Da hier noch davon ausgegangen wurde, dass es zu einer Serie kommen würde,
wurde die Nummer so gewählt, dass die nachfolgenden Modelle sich nahtlos
anreihen konnten. Es kam daher bei dieser
Baureihe
zu einer neuen Nummerngruppe. Dabei hatten die Modelle für die
Güterzüge
bereits dreistellige Nummern erhalten. Bei der Bestellung der hier vorgestellten
Lokomotive
war klar, dass diese bei einem Erfolg die
Baureihe
D4t ablösen sollte. So sollten dort
keine neuen Modelle mehr beschafft werden. Da man bei der erwähnten Reihe
damals bereits bei der Nummer 131 angelangt war und weil man dem
Prototypen
noch nicht vertraute, wurde hier die Nummer 151 vorgesehen. So war eine
ausreichende Lücke zur Reihe D4t
vorhanden.
Angebracht wurden sie mit Schrauben an der
Seitenwand des
Führerhauses
vor der
Einstiegstüre.
Eine Lösung, die von den anderen
Baureihen
her bereits bekannt war und hier daher auch nicht verändert wurde. Für die rückseitige Nummer, die am Kohlenfach ange-bracht wurde, verwendete man die gleiche Lösung, wie sie schon bei der Seite benutzt wurde. Es war daher klar, dass nach Möglichkeit auf gegossene Schilder verzichtet werden sollte. Wobei das nicht so klar war. Hier war es
jedoch leicht möglich die einzelnen Ziffer mit Schrauben zu befestigen.
Schliesslich war das
Kohlenfach
noch leer, als die Nummern montiert wurden. Für die vorne an der
Rauchkammer
angebrachte Nummer kam jedoch nicht mehr diese Lösung zur Anwendung. Da
man sich dort über die Position noch nicht sicher war, wurde ein
entsprechendes Schild aus Messing gegossen. Bei diesem wurden die
vertieften Stellen mit schwarzer Farbe behandelt, so dass die Nummer gut
zu erkennen war. Solche Schilder waren über viele Jahre bei den Bahnen in
der Schweiz üblich. Nicht fehlen durfte das Herstellerschild.
Dieses wurde seitlich an den
Wasserkästen
montiert und war auf die gleiche Weise, wie die vordere Nummer ausgeführt
worden. Damit haben wir jedoch die Anschriften bereits abgeschlossen. Die
heute üblichen technischen Anschriften fehlten bei der
Lokomotive
schlicht. Das war jedoch damals üblich, da diese Angaben in einem
Verzeichnis geführt wurden und daher nicht an der Lokomotive vorhanden
waren.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Am
grundsätzlich Aufbau des Anstrich konnte auch die
Am
grundsätzlich Aufbau des Anstrich konnte auch die
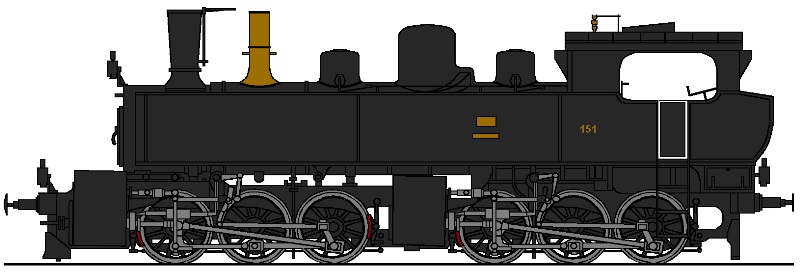 Es
wurde eine Farbwahl getroffen, die von der
Es
wurde eine Farbwahl getroffen, die von der
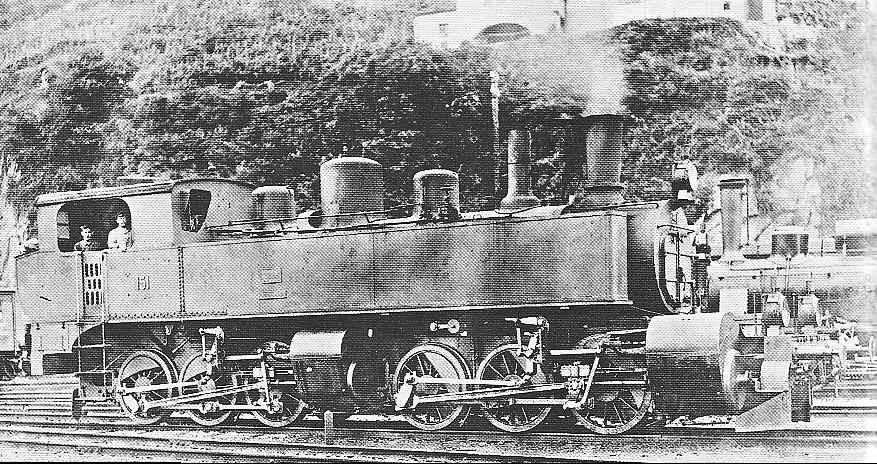 Wie
schon bei den ersten
Wie
schon bei den ersten
 Diese
Betriebsnummer wurde an der
Diese
Betriebsnummer wurde an der