|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Kommen wir zum
Fahrwerk der Lokomotive. Mit der
Bezeichnung A I war schlicht keine Information zur
Achsfolge vorhanden.
Bei einer nur 6 600 mm langen Maschine ist diese mit B angegebene
Achsfolge keine grosse Überraschung. Mehr war damals bei Modellen, die in
den
Rangierdienst
kommen sollten auch nicht vorgesehen. Daher entsprachen
diese Lokomotiven zumindest in diesem Punkt den vorhandenen Maschinen.
Bei den letzteren kamen
einfache Lösungen mit Stahl auf Stahl und einer
Schmierung mit
Öl
zur
Anwendung. Diese Führungen waren so aufgebaut worden, dass sich die
Achse
nur in der vertikalen Richtung bewegen konn-te. Genauer gefertigt werden mussten die Achslager, die auf Rotation belastet wurden. Hier kamen ebenfalls Gleitlager zur Anwendung. Wegen den hohen Drehzah-len bei der mit bis zu 50 km/h verkehrenden Lokomotive wurden die Lagerschalen aus dem üblichen Weissmetall hergestellt. Dieses hatte eine gute Eigenschmierung und war
daher ideal um gegenüber der
Achse
aus Stahl bestand zu hal-ten. Jedoch war
dabei die Temperatur ein Problem. Um die Temperatur der
Lager wirksam zu vermindern
und auch die Reibung zu verringern, mussten diese Lager mit
Öl
geschmiert
werden. Wie bei den anderen
Achslagern kam hier eine
Sumpfschmierung mit
einem unmittelbar bei Lager vorhandenen Behälter zum Einbau. Das
verbrauchte
Schmiermittel wurde dann durch die Ritzen beim Lager ins Freie
entlassen, so dass das Öl einem gewissen Verbrauch unterworfen war. Auch wenn wir heute diese Art der
Schmierung aus
Gründen des Umweltschutzes nicht verstehen können, es war schlicht die
einzige Möglichkeit, das verbrauchte
Schmiermittel aus dem
Lager zu
bekommen. Bei ähnlichen
Gleitlagern kommen auch heute noch solche Lösungen
vor. Wobei jetzt zur Schmierung
Fette verwendet wurden, die nicht so
leicht ausgewaschen werden konnten, wie die noch 1882 verwendeten
Öle.
Diese waren jedoch leichter aufgebaut worden, besassen aber auch die erforderlichen Gegenge-wichte für den Antrieb. Nicht im
Speichenrad enthalten waren jedoch
die
Lauffläche und der
Spurkranz, da dazu damals noch ein Verschleissteil
vorgesehen war. Als Verschleissteil kam eine aufgezogene Bandage zur Anwendung. Diese besass die Lauffläche und den Spurkranz und sie konnte bis zu einem be-stimmten Punkt abgenutzt werden. Dieser war mit einer Verschleissrille gekennzeichnet worden. War diese erreicht, musste die
Lokomotive, wie Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt um neue Reifen
ab-zuholen. So unterschiedlich waren als die Fahr-zeuge auf der
Schiene auch
wieder nicht. Der Durchmesser der Räder lag bei 1 000 mm und war daher auch nicht sehr gross geraten. Die Loko-motive sollte, weil die Dampfmaschine nur eine bestimmte Tourenzahl hatte, nur mit einer Höchst-geschwindigkeit von 50 km/h verkehren können. Das war aber für den
geplanten Einsatz im
Rangierdienst
und auf kurzen Strecken im
Flachland
hoch genug.
Zumal die
Gotthardbahn so oder so nicht gerade schnell verkehrte. Vorher bei der Vorstellung der
Lagerung, wurde
erwähnt, dass sich die
Achsen in vertikaler Richtung bewegen konnten.
Diese Bewegung war erforderlich, damit die
Lokomotive
mit einer wirksamen
Federung versehen werden konnte. Nur so wurden die Schläge und
Stösse, die
sich im
Laufwerk immer wieder ergaben nicht auch das Fahrzeug übertragen
wurden. Auch wenn mit 50 km/h langsam gefahren wurde, war die Federung
wichtig.
Wegen den Sparmassnahmen, die hier umgesetzt
werden mussten, kam eine von anderen Baureihen gänzlich andere und dabei
erst noch einfachere Lösung für die
Federung der ersten
Achse zum Ein-bau. Verwendet wurde eine quer zur Fahrrichtung eingebaute Blattfeder. Diese war oben liegend ein-gebaut worden und erlaubte es auf ein Federpaket zu verzichten. Die Wirkung dieser Feder, die kaum Unterhalt benötigte, war gut. Sie benötigte einfach viel Einbauraum im Rahmen, der
in der Regel nicht vorhanden war. Hier ging das von den Kutschen
übernommene Prinzip jedoch ohne grosse Probleme, da ja alles einfach
aufge-baut wurde.
Blattfedern hatten zudem eine lange Schwingungsdauer.
Das machte diese
Federung bei Fahrzeugen ideal, da sie sich nicht
aufschaukeln konnte. Ein Vorteil, der aber durch eine schlechtere Wirkung
bei hohen Geschwindigkeiten bezahlt wurde. Bei der hier vorgestellten
Lokomotive
spielte das keine Rolle, da ihr maximales Tempo weit unter der
kritischen Grenze lag. Daher war dies eine gute Federung. Kommen wir zur hinteren
Achse. Diese besass nun zwei
in Längsrichtung eingebaute
Federn. Die Lösung der ersten Achse konnte
hier nicht genommen werden, weil der dazu erforderliche Platz im Rahmen
fehlte. Sie wurden ebenfalls über dem
Lager eingebaut und sie sorgten für
eine breite Abfederung des Fahrzeuges, das so nicht so leicht seitlich
kippen konnte. Ein Problem, das man bei Dampflokomotiven nicht haben
sollte.
Doch damit haben wir die
Rangierlokomotive
auch auf die
Räder
gestellt und können uns eigentlich der Höhe
zuwen-den. Die Maschine war jedoch sehr nieder und daher ergaben sich keine
Probleme. Sollten Sie nun Massangaben erwartet haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Damals wurden die Höhen der Loko-motive nur in seltenen Fällen angegeben. Das war be-sonders oft der Fall, wenn das Lichtraumprofil ausgereizt wurde. Die hier vorgestellte kleine
Rangierlokomotive
hatte damit jedoch keine grossen Probleme. Die Reihe A I sollte wirk-lich
zu einer der kleinsten normalspurigen Maschinen der Schweiz werden. Bevor wir uns nun dem Antrieb zuwenden können, muss noch erwähnt werden, dass im Bereich des Rahmens um die Triebräder Schutzbleche montiert wurden. Diese wurden zudem überraschend weit nach
unten ge-zogen. So war die
Lauffläche kaum zu erkennen. Eine Massnahme, die
eigentlich nicht unbedingt nötig war, die aber der Erscheinung der
Lokomotiven nicht geschadet hatte. Die Bleche der A I standen ihr
ausgesprochen gut. So einheitlich der Aufbau des
Fahrwerkes war, beim
Antrieb entsprach die Maschine nicht mehr dem gängigen Aufbau. Wie bei den
anderen Dampflokomotiven wurde auch hier in einer
Dampfmaschine eine
lineare Bewegung erzeugt und diese mit einem Gestänge auf die
Triebachse
übertragen. Dieser Weg war aber anders gelöst worden, wie das bei
Dampflokomotiven sonst der Fall war. Daher lohnt es sich, wenn wir genau
hinsehen.
Die so erzeugte lineare Bewegung der Maschine
wurde über die
Kolbenstange auf das
Triebwerk übertragen. Dabei wurde die
Stange nahezu waage-recht geführt und sie endete in einem einfachen
Gelenk.
Dieses war mit einem
Gleitlager, das mit
Öl
geschmiert wurde, versehen
worden. Nach diesem Gelenk kam der grosse Unterschied zu den anderen Lokomotiven mit einer Dampfma-schine. Das sonst hier vorhandene und in der Fertigung sehr teure Kreuzgelenk fehlte schlicht. Die von der
Dampfmaschine mit der
Schubstange übertragene lineare Bewegung wurde in
der Mitte der
Lokomotive
von einem Umlenkhebel aufgenom-men und durch
diesen auf das Niveau der beiden
Achsen
angesenkt. Dieser Umlenkhebel war unter dem Umlaufblech in einem
Hilfsrahmen gelagert worden. Auch dieses nur auf Drehung belastete
Lager
war nach den üblichen Ideen aufgebaut worden. Die
Lagerschalen aus
Weissmetall wurden dabei wie die meisten anderen Lager des
Antriebes mit
einer
Sumpfschmierung versehen. Der Grund lag darin, dass die bei einem
Nadellager erforderlichen Fliehkräfte im Umlenkhebel fehlten. Die Aufgabe des Umlenkhebels bestand nicht nur darin,
die Bewegung auf das Niveau der
Achsen abzusenken. Durch das
Gelenk in der
Mitte, wurde die Bewegung gespiegelt. Ein Punkt, der zwar auffällig war,
der jedoch nur geringe Auswirkungen auf den weiteren
Antrieb hatte. Dieser
war nun nicht mehr schwer im Aufbau, da am Umlenkhebel nur eine weitere
Schubstange vorhanden war, die letztlich auf die
Triebachse wirkte.
Mit dem Umlenkhebel musste die Stange nun aber von
unten nach oben geführt werden. Eine Lösung, die kein Problem ergab, die
aber für den Betrachter etwas befremdlich wirkte, da es nicht üblich war. Diese einfache Triebstange lagerte neben dem Gelenk beim Umlenkhebel auch im Drehzapfen der hinteren Achse. Die-ser Zapfen war mit einem Gleitlager versehen worden und hier konnte eine Nadelschmierung verbaut werden. Diese mit
Öl
arbeitende
Schmierung konnte deutlich besser
eingestellt werden. Das erlaubte es den Verbrauch bei den
Schmiermitteln
zu vermindern. Ein Punkt, der sich bei den betrieblichen Kosten zeigen
sollte. Der Drehzapfen wandelte die Kraft der Dampfmaschine in ein Drehmoment um. Dieses wurde wiederum mit Hilfe der Haftreibung zwischen der Lauffläche und der Schiene in Zugkraft umgewandelt. Auch wenn
wir später noch erfahren werden, dass die
Dampfmaschine eine geringe
Leistung hatte, die
Zugkraft
war für eine
Triebachse schlicht zu hoch. Daher
musste auch hier die Kraft, wie bei den anderen Modellen, auf weitere
Achsen
übertragen werden. Mit einer
Kuppelstange
war die zweite
Achse
mit der
Triebachse verbunden worden. Damit haben wir beim vorderen
Radsatz eine
Kuppelachse
erhalten. Auch bei dieser wurde die Kraft der
Dampfmaschine
in
ein
Drehmoment umgewandelt. Wir haben so eine Teilung der Kräfte erhalten,
die ausreichte um die erforderlichen
Zugkräfte
der
Lokomotive
mit Hilfe
der
Adhäsion zu erzeugen. Damit haben wir nun den
Antrieb abgeschlossen.
Das führte dazu, dass die Kosten für die
Kreuzgelenke gespart werden konnten. Eine grosse Einsparung, da ja die
hier vorgestellte Lösung doppelt vorhanden war. Der benötigte Versatz der
beiden Seiten entsprach anderen Baureihen. Ein weiterer Vorteil war, dass der Radstand der Loko-motive gestreckt werden konnte. Dieser konnte nach belieben gestaltet werden, was der kurzen Maschine zu gute kam. Im Betrieb zeichnete sich der
Antrieb zudem dadurch aus, dass wenig Schmierstellen vorhanden waren und
dass diese zudem immer leicht zugänglich waren. So stellt sich uns
automatisch die Frage, warum diese Lösung nicht öfter angewendet wurde. Da hier die
Dampfmaschine
über dem Umlaufblech
mon-tiert wurde, kam sie in den Bereich des
Kessels. Dort war aber nur ein
bescheidener Platz vorhanden und so konnten keine grossen und kräftigen
Dampfmaschinen verbaut werden. Aus diesem Grund wurden die Maschinen unter
dem Blech montiert, wo deutlich mehr Platz vorhanden war. Es war also
schlicht eine Frage der
Leistung, die hier gering genug für diesen
Antrieb
war. Die im
Rad
erzeugte
Zugkraft
gelangte schliesslich
über die
Lager in den Rahmen der
Lokomotive. Im Rahmen wurde die Kraft
aller Räder zu den
Stossbalken
und so auf die
Zugvorrichtungen übertragen.
Dort nicht benötigte Zugkraft wurde hingegen in Beschleunigung
umgewandelt. Damit haben wir aber die physikalischen Kräfte erreicht und
hier gab es nun keinen so grossen Unterschied zu den anderen Lokomotiven
mehr.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die beiden
Die beiden  Beidseitig wurden an den in einem Abstand von 2 500
mm eingebauten
Beidseitig wurden an den in einem Abstand von 2 500
mm eingebauten  Die beiden
Die beiden  Auch beim immer wieder gefürchteten Kippeffekt in der
Längsrichtung konnte mit dem Aufbau des
Auch beim immer wieder gefürchteten Kippeffekt in der
Längsrichtung konnte mit dem Aufbau des 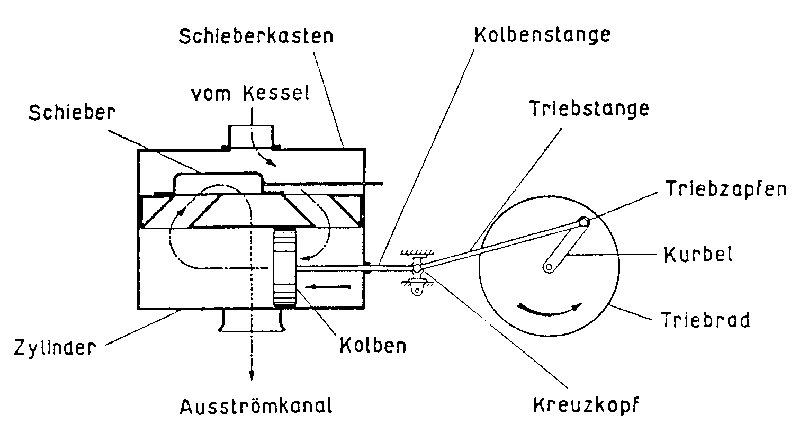 Im Gegensatz zu den anderen
Im Gegensatz zu den anderen
 Der optisch auffälligste Unterschied zu den anderen
Der optisch auffälligste Unterschied zu den anderen
 Der hier verbaute
Der hier verbaute