|
Mechanische Konstruktion |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Gotthardbahn
suchte eine einfach zu bedienende
Lokomotive.
Diese sollte mit den Nummern 11 und 12 auch geliefert werden. Beim Aufbau
unterschied sich dieses Fahrzeug nicht gross von den anderen
Dampflokomotiven. Es wurden alle Teile einfach etwas schwächer ausgeführt,
oder gar weggelassen. Das war auch eine Folge davon, dass die beiden
Maschinen nicht viel Kosten durften und dass die Anforderungen gering
waren.
Die Bahn benötigte viele Maschinen und da
waren kleine
Rangierlokomotiven
nicht vorgesehen. Dennoch wurden solche benötigt und da wurde auf
mög-lichst geringe Kosten geachtet. Bei einem Stückpreis von nur 29 000
Schweizer Franken musste der Hersteller sparen. Am grundsätzlichen Aufbau einer Dampflokomotive änderte sich nicht so viel. Mit einem Feuer wurde in einem Kessel Wasser erhitzt und mit dem ent-stehenden Dampf eine Maschine in Bewegung gesetzt. Obwohl damals immer wieder mit neuen Ideen
experimentiert wurde, die beiden
Lokomotiven
waren dafür schlicht ungeeignet. Daher können wir uns auf die üblichen
Informationen zu solchen Modellen freuen. Unterschiede zwischen den beiden von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM gebauten Lokomotiven gab es nicht. Die Nummern 11 und 12 konnten daher nicht als Prototypen angesehen werden. Weitere Modelle der Baureihe A I sah auch die
Gotthardbahn
nicht vor, denn es waren wirklich zwei Maschinen, die wegen den leeren
Kassen bestellt wurden. 29 000 Schweizer Franken war sehr billig. Tragendes Element der
Lokomotive
war der innen liegende Rahmen. Dieser wurde nach der damaligen Methode aus
Stahlblech, Gussteilen und Profilen aufgebaut. Als
Verbindungen
der einzelnen Bauteile wurden einfache
Nieten,
aber auch Schrauben verwendet. Letztere kamen dort zum Einsatz, wo Teile
leicht ausgetauscht werden mussten. Um Gewicht und Kosten zu sparen,
wurden einfach etwas dünnere Bleche verwendet.
Besonders dann, wenn etwas sportlich an Wagen
an-gefahren wurde. Daher musste eine sorgfältige Konstruk-tion vorhanden
sein. Sie sehen, Einsparungen führen nicht immer zu optimalen Lösungen. Das führte zum Beispiel dazu, dass der Rahmen kaum Ausschnitte besass. So konnte trotz den dünneren Blechen der übliche Kraftfluss erreicht werden. Zudem hätten die-se Öffnungen auch dazu geführt, dass die Kosten bei der Produktion zu hoch gewesen wären. Mit den Worten, dass es sich um einen
einfachen
Plattenrahmen
handelte, habe ich daher nicht übertrieben. Ein Punkt, der sich auch auf
andere Punkte auswirken sollte. Um das Gewicht dennoch gering zu halten,
verwendete man an den Stellen, wo das ohne Probleme ging, nur einfache
Profile. Diese waren als Flachprofile, aber auch als T-Profile ausgeführt
worden. In diesem Bereich entstanden daher grosse offene Bereiche, die
aber nicht der Übertragung der Kräfte zugeordnet werden konnten, denn dort
musste die üblichen Stahlbleche verwendet werden und das galt auch für den
Abschluss. Abgeschlossen wurde der Rahmen auf beiden
Seiten der
Lokomotive
mir je einem
Stossbalken.
Wegen den neuen
Stossvorrichtungen
der
UIC,
musste dieses Bauteil gegenüber dem Rahmen abgestützt werden. So konnten
die Kräfte optimal in den Rahmen übertragen werden. wir beginnen die
Betrachtung der angebauten Teile jedoch in der Mitte des Stossbalkens,
denn dort waren die
Zugvorrichtungen
der UIC montiert worden.
Eine seitliche Verschiebung war nicht
möglich, da hier eine durchgehende
Zug-stange
verwendet wurde. So konnten die
Zugkräfte
etwas vom Rahmen genommen werden. Besonders dann, wenn vor und hinter der
Lokomotive
Wagen eingereiht wurden. Solche Zugstangen waren damals besonders bei kurzen Wagen üblich und sie wurden beim Bau von Lokomotiven selten verwendet. Hier war das aber wegen dem schwachen Rahmen und auch wegen der sehr kurzen Maschine möglich. So wurde also auf eine Lösung gesetzt, die
bei den Wagen verwendet wurde. Ein-sparungen bei der Entwicklung, die auch
genutzt wurden, um den Preis für das Mo-dell sehr gering zu halten. Ergänzt wurde der Zughaken mit der ebenso neuen UIC-Standardkupplung. Beide Teile der Zugvorrichtungen wurden im Hinblick auf die Gotthardbahn in Europa und auch auf anderen Kontinenten eingeführt. So sollten die bisher verwendeten von den
Bahnen abhängigen Lösungen ver-schwinden. Dabei hatten diese
UIC-Standardkupplungen
nur ein Problem, denn sie konnten keine
Stosskräfte
aufnehmen und mussten damit ergänzt werden. Diese
Stossvorrichtungen
wurden seitlich am
Stossbalken
auf gleicher Höhe montiert. Dazu wurden Schrauben verwendet, denn die
Bauteile waren einem gewissen Verschleiss unterworfen und sie sollten auch
bei einer Überlastung beschädigt werden. Die Idee dabei war, dass die
Kräfte so vom Rahmen abgehalten werden konnten. Die Schäden an der
Lokomotive bei leichten
Anprällen
sollten so verschwinden.
Die
Federung
war erforderlich um leichte
Stösse,
wie sie beim Anfahren an Wagen entstehenden konnten, aufzunehmen. Zudem
erlaubte sie auch, dass mit der Einrichtung auch
Kurven
befahren werden konnten. Das Kontaktelement zu den Stossvorrichtungen des anderen Fahrzeuges, war ein einfacher Teller. Dieser Pufferteller war rund und er wurde nicht gleich ausgeführt. Jeweils der linke Puffer besass eine gewölbte Ausführung. Rechts wurde hingegen eine einfachere
Ausführung mit einem flachen
Puf-ferteller
vorhanden. Da diese in den Normen geregelt wurden, war garantiert, dass
immer zwei unterschiedliche Teller aufeinander trafen. Mit den am Rahmen montierten
Stossvorrichtungen
können wir bereits die Länge bestimmen. Diese wurde bei diesen
Einrichtungen immer über die
Puffer
angegeben und sie betrug bei den beiden hier vorgestellten
Lokomotive
grade einmal 6 600 mm. Da wir mit dieser Zahl nicht viel anfangen können,
muss erwähnt werden, dass es in der Schweiz kaum Dampflokomotiven gab, die
über eine geringere Länge verfügten. Am Rahmen montiert wurden auch noch die zum
Schutz des
Fahrwerkes
vorgesehenen
Schienenräumer.
Diese waren bei Dampflokomotiven bei der Auslieferung oft nicht vorhanden,
da dort einfach die bei der entsprechenden Bahn verwendeten Modelle
montiert wurden. Da die Schienenräumer in der Höhe verstellt werden
mussten und weil sie im Betrieb sehr oft beschädigt wurden, waren sie mit
Schrauben befestigt worden.
Wollte das Personal zu den Baugruppen
gelangen, musste eine Leiter verwendet werden. Stand diese nicht zur
Verfügung, blieb nichts anders übrig, als eine Kletterpartie zu
vollziehen. Auf dem Rahmen wurde ein Führerhaus und ein Kessel montiert. Den Kessel werden wir später noch genauer ansehen, hier soll jedoch erwähnt werden, dass das Führerhaus den Kessel im hinteren Bereich einrahmte. Damit haben wir aber auch die Ausrichtung der
Lokomotive
erhalten, denn in diesem Punkt gab es zu den anderen Baureihen keinen
Unterschied. Das
Führerhaus
befand sich in der Schweiz am hinteren Ende. Das Führerhaus nahm die ganze Breite der Lokomo-tive ein. Daher wurde das Umlaufblech nur bis vor dessen Frontwand geführt. Zu erwähnen ist dabei, dass es auch vom
Führerhaus
her keinen direkten Zugang zum Umlaufblech gab. Das war wegen dem Verzicht
auf die Aufstiege zu erwarten und so blieb wirklich nur der vorher
vorgestellte Weg. Doch nun sollten wir uns das Führerhaus der Maschine
genauer ansehen. Wer nun aber ein aufwendig konstruiertes
Führerhaus
erwartet, muss enttäuscht werden. Es waren eigentlich nur vier Wände
aufgestellt worden. Diese bildeten ein Rechteck und in der oberen Hälfte
wurden die Wände einfach zu breiten Säulen. Ein sehr einfacher Aufbau, der
aber damals üblich war, denn 1882 waren längst noch nicht alle Maschinen
mit so einem Gebilde ausrüstet worden, denn oft wurden nur
Frontwände
verbaut.
Diese war erforderlich, damit das
Führerhaus
erreicht werden konnte. Eine Türe war jedoch nicht vorhanden und eine
Kette diente auf der Fahrt als einfache Absturzsicherung. Sie sehen, es
wurde einfach gebaut. Für den Zugang vom Boden aus, war unter der Öffnung eine einfache Leiter montiert worden. Diese verfügte über zwei Stufen und war aus Stahl konstruiert worden. Eine sehr einfache Lösung, die nur leicht
verbreiterte Stufen besass und sonst keine
Sicherung
vor dem Abrutschen besass. Der Unfallschutz wurde damals noch nicht so
wichtig genommen, wie das heute der Fall ist, wo spezielle Beläge
vorhanden sind. Damit der Aufstieg überhaupt möglich wurde, waren seitlich einfache Griffstangen montiert worden. Diese dienten während dem Aufstieg dem Halt und sie waren gerade so lange, wie die Seitenwand des Führerhauses. Eine Lösung, die damals so üblich war und
welche bis in die Neuzeit bei
Lokomotiven
nur geringfügig verändert wurde. Wir haben daher einen jener Punkte kennen
gelernt, die trotz aller Sparmassnahmen nicht vereinfacht werden konnten. Gespart wurde jedoch im Bereich der Öffnungen. Diese waren weder an der Front, noch an der Rückwand verschlossen worden. Die hier sonst verbauten Gläser waren in der Anschaffung sehr teuer und daher wurden sie schlicht nicht verbaut. Auch das Gewicht dürfen wir nicht
vernachlässigen. Wir haben damit ein extrem einfach aufgebautes
Führerhaus
erhalten, das nur noch mit einem Dach abgedeckt werden musste. Das Dach war seitlich gewölbt ausgeführt
worden. Dabei befand sich der höchste Teil in der Mitte der Längsachse.
Für das Dach wurde, wie auch für das restliche
Führerhaus
einfaches Blech verwendet. Dabei besass dieses jedoch nicht die Stärke,
die beim Rahmen verwendet wurde. Das war aber so üblich, denn das Gebilde
sollte ja nur der Regen abhalten. Wegen den fehlenden Fenstern war das
aber nur im Stillstand der Fall. Diese Lösung erlaubte es dem Dachwasser
seitlich abzufliessen und es konnten sich keine Pützen bilden. Damit
dieses nicht der Wand entlang lief stand es auf allen vier Seiten etwas
vor. So war eine Kante vorhanden, bei der das Wasser einfach auf den Boden
tropfen konnte. Weitere Einbauten, oder gar Öffnungen gab es im Dach nicht
mehr. Es war wirklich eine billige Lösung für das
Führerhaus,
das recht zugig war. Um die auf dem Rahmen aufgebauten Bauteile
abzuschliessen, muss noch erwähnt werden, dass beim Umlaufblech seitlich
ein Geländer montiert wurde. Dieses war schon speziell, denn hier waren
solche kaum vorhanden, so dass zumindest in diesem Punkt eine einfache
Absturzsicherung vorhanden war. Wegen dem fehlenden Aufstieg war das eine
grosse Überraschung, auf die man ohne Probleme verzichten konnte. Wir haben bisher eine
Lokomotive
erhalten, die über alle Merkmale einer üblichen Variante hatte. Jedoch
wurden die Sparmassnahmen an vielen Punkten erkannt und diese betrafen
nicht nur das Gewicht des Fahrzeuges. Besonders die sonst bei ähnlichen
Lösungen in der Hauptrichtung vorhandenen
Frontfenster
waren einer dieser Punkte. Auch beim
Fahrwerk
der
Lokomotive,
das wir uns nun ansehen, sollte weiter gespart werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
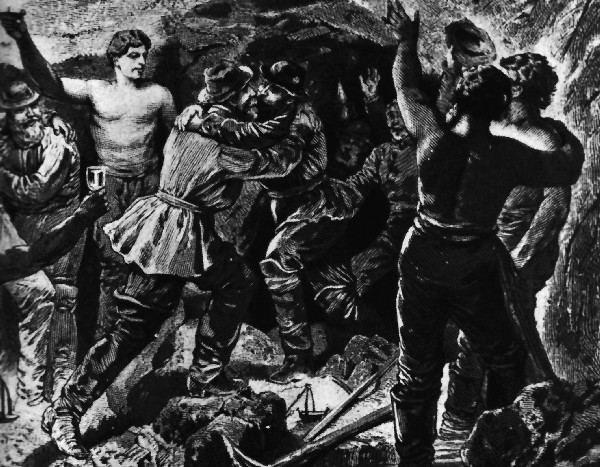 Erinnern
wir uns rasch daran. Die
Erinnern
wir uns rasch daran. Die
 Vom
grundsätzlichen Aufbau her unterschied sich dieser
Vom
grundsätzlichen Aufbau her unterschied sich dieser
 Als
Als  Verwendet
wurden
Verwendet
wurden
 Bleibt
nur noch zu erwähnen, dass der Rahmen mit einem Umlaufblech abgedeckt
wurde. Diese waren bei Dampflokomotiven üblich und sie wurden für den
Unterhalt benötigt. Daher mag es überraschen, dass es zu diesem
Umlaufblech schlicht keine Aufstiege gab.
Bleibt
nur noch zu erwähnen, dass der Rahmen mit einem Umlaufblech abgedeckt
wurde. Diese waren bei Dampflokomotiven üblich und sie wurden für den
Unterhalt benötigt. Daher mag es überraschen, dass es zu diesem
Umlaufblech schlicht keine Aufstiege gab. Etwas
genauer ansehen müssen wir uns nur die beiden identisch aufgebauten
Seitenwände. Diese waren nicht in der ganze Länge ausgeführt worden. Auf
der Seite der Rückwand war eine schmale Öffnung vorhanden.
Etwas
genauer ansehen müssen wir uns nur die beiden identisch aufgebauten
Seitenwände. Diese waren nicht in der ganze Länge ausgeführt worden. Auf
der Seite der Rückwand war eine schmale Öffnung vorhanden.