|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||
| Navigation durch das Thema | |||||
| Baujahr: | 1881 | Leistung: | 75 PS |
||
| Gewicht: | 15 t | V. max.: | 50 km/h |
||
| Normallast: | 240 t in der Ebene | Länge: | 6 600 mm |
||
|
Die
Lokomotive
A I konnte man bei einer
Bergbahn
nicht vermuten. Speziell war eigentlich nur, dass diese grosse
Gesellschaft mit der Strecke nach Locarno einen Abschnitt hatte, der im
besten Fall als
Nebenstrecke
angesehen werden konnte. Ein Erbe der Tessiner Talbahnen, die beim Bau
noch verlängert werden sollte. Die Strecke sollte aber nie gebaut werden,
so dass es bei der Stichbahn nach Locarno blieb.
Daneben sollten diese Lokomotiven auch die in grösseren Bahnhöfen an-fallenden Rangierdienste übernehmen. Mit anderen Worten, es wurde keine grosse
und schwere Baureihe erwar-tet, sondern eine kleine aber ausge-sprochen
wendige
Lokomotive. Betriebliche Rangierdienste gab es bei einer grossen Bahngesellschaft schon vor 1880. Meistens wurden dazu ältere oder kleine Lokomotiven verwendet. Bei der Gotthardbahn sollte das nicht anders sein. Damit sind wir aber bereits bei den für die Tessiner Talbahnen beschafften Maschinen angelangt. Es waren die
Lokomotiven,
die schon jetzt den lokalen Verkehr auf dem Ab-schnitt zwischen Biasca und
Locarno abdeckten. Gerade der
Regionalverkehr
auf die-sem Abschnitt konnte gut berechnet werden, denn es sollte nicht
viel mehr Reisende geben. Dabei müssen wir aber wissen, dass in jenen
Jahren der Tourismus im Tessin kaum vorhanden war. Die
Reisezeit
über die Alpen und der beschwerliche Weg, waren nicht dazu geeignet. Erst
mit der
Gotthardbahn
war das Tessin erreichbar und daher ist es nicht überraschend, dass
Locarno und Lugano die Zentren wurden. Bei den Tessiner Talbahnen waren neben den
neuen Maschinen auch Modelle vorhanden, die auf dem Markt als gebrauchte
Exemplare erstanden wurden. Das war eine direkte Folge der finanziellen
Probleme. Nur so konnte mit geringem finanziellen Aufbau der bescheidene
Betrieb aufrecht erhalten werden. Zur Übersicht, sollten wir daher diese
Sammelsurium anhand einer Tabelle etwas genauer ansehen.
|
|||||
|
Typ |
Nummern |
Baujahr |
V. max. |
Bemerkungen |
|
| A (Ed 2/2) |
1 - 4 |
1874 |
50 |
||
| A II (E 3/3) |
13 |
1875 | Nur Rangierdienst | ||
| A III (E
2/2) |
14 |
1876 |
35 |
Ex. Tösstalbahn |
|
|
Von den Maschinen waren eigentlich nur die
Betriebsnummern 1 bis 4 für den
Streckendienst
geeignet. Die anderen
Lokomotiven
waren dazu zu langsam, oder schlicht zu schwach. Mit anderen Worten, auf
dem Markt für gebrauchte Modelle, was damals kaum das passende Exemplar zu
finden. Trotzdem sollten wir uns diese Maschinen ansehen, denn sie
gehörten in den betrieblichen Bereich der hier vorgestellten Reihe A I.
Mit den zwei gekuppelten Achsen war sie ideal für den Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Bias-ca und Locarno geeignet. Ein Nachteil war, dass die acht Jahre alte
Baureihe nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik war. Insbesondere
der Aufbau des
Kessels
hatte sich seither verändert. Als kleinste Lokomotive hatten diese Maschinen bei den Tessiner Talbahnen die Bezeichnung I bekom-men. Das von den Talbahnen angewendete System
wurde aber im Hinblick auf die
Gotthardbahn
geändert. So mutierten die kleinen
Lokomotiven
zur Klasse A. Auf die hier vorgestellten Modelle hatte das insofern
Auswirkungen, als dass sie als A I bezeichnet werden mussten. So war aber
fälschlicherweise eine nahe Verwandtschaft zu erkennen. Einsetzen konnte man diese
Lokomotiven
nach Eröffnung der
Gotthardbahn
als
Rangierlokomotiven
und für lokale Züge auf flachen Strecken. Auf den sehr steilen Abschnitten
der
Bergstrecke
waren sie jedoch falsch. Im Gegensatz zu den anderen in der Tabelle
enthaltenen Maschinen war sie besser für eine weitere Verwendung geeignet.
Doch mit vier Lokomotiven war der Bestand eher bescheiden, aber für die
Talbahnen ideal. Um uns ein besseres Bild über diese
Maschinen zu machen, sehen wir uns deren Eckwerte an. Diese können Sie mit
den oben eingefügten Werten für die hier vorgestellte Reihe A I
vergleichen. Bevor Sie das tun, kann ich Ihnen sagen, dass man sich die
Frage stellen muss, warum eine neue Baureihe beschafft wurde, wenn das
ideale Modell bereits im Bestand der Gesellschaft vorhanden war. Die
Antwort sind acht Jahre. |
|||||
| Baujahr: | 1874 | Leistung: | 221 kW / 300 PS |
||
| Gewicht: | 29 t | V. max.: | 50 km/h |
||
| Normallast: | 60 t bei 25 km/h | Länge: | 8 612 mm |
||
|
Diese vier
Lokomotiven
hätten für den bei der
Gotthardbahn
anfallenden Aufwand beim
Rangierdienst
knapp ausgereicht. Jedoch waren sie mit der Geschwindigkeit von 50 km/h
und wegen der hohen
Leistung
auch für den lokalen Verkehr auf den flachen Abschnitten geeignet. Selbst
vor den steilen
Rampen
musste sie sich nicht verstecken, schaffte sie doch noch eine
Anhängelast
von bescheidenen 60 Tonnen, was ein oder zwei Wagen entsprach.
Daher war schnell klar, man musste den
Bestand der Tessiner Talbahnen erweitern, wollte man die grossen Baureihen
nicht vor leichten regionalen Zügen einsetzen. Man benötigte weitere Lokomotiven für den Ran-gierdienst in den grösseren Bahnhöfen. Bei leeren Kassen möchte man das Geld jedoch für starke Maschinen auf der Strecke einsetzen und nicht für Rangierlokomotiven ausgeben. Es mussten kostengünstige Möglichkeiten
gesucht werden, wollte man diese
Lokomotiven
für wenig Geld bekommen. Da kam die zum Verkauf angebotene Lokomotive aus
dem Tösstal gerade recht. Sie haben richtig gelesen, die
Gotthardbahn,
eine Gesellschaft die zur mächtigsten Bahn des Landes werden sollte, sah
sich nach gebrauchten
Lokomotiven
um. Deutlicher kann nicht aufgezeigt werden, wie knapp die Finanzen bis
zur Eröffnung der durchgehenden Linie waren. Mit den Occasionen hatte man
den Bedarf gedeckt, aber es war abzusehen, dass nach einem erfolgreichen
Start, diese Modelle schnell verschwinden. Die
Lokomotive
der Tösstalbahn war nicht optimal. die
Höchstgeschwindigkeit
lag bei bescheidenen 35 km/h. Das war für die Züge der
Gotthardbahn
schon zu langsam. Jedoch konnte die Maschine in den
Rangierdienst
genommen werden. Die bessere eigene Lokomotive wurde dann vor den
Regionalzug
gespannt. Das grösste Problem war aber, dass es nur ein Exemplar gab und
daher ein Exot in den Bestand kam.
Die Folge davon war, dass sich die
Gotthardbahn
auch um schwache
Lokomotiven
für den Lokal-verkehr und den
Rangierdienst
auf den grösseren
Bahnhöfen,
bemühen musste und das bei leeren Kassen. Die Lokomotiven A von den Tessiner Talbahnen waren daher ideal. Das grosse Problem war, dass diese bei der Beschaffung einen Stückpreis von 51 000 Schweizer Franken hatten. Das war Geld, das man auch für andere Baureihen hätte nutzen können. Die erhoffte Erweiterung mit diesen
Maschinen konnte daher erst nach der Betriebsaufnahme erfolgen, denn
vorher waren die guten
Lokomo-tiven
schlicht nicht zu zahlen. Bei der
Gotthardbahn
musste man notgedrungen spezielle kleine
Lokomotiven
für den
Rangierdienst
und den leichten Streckendienst beschaffen. Man erkennt hier klar den
gigantischen Rahmen, der für den Bau der
Bahnlinie
vorhanden war.
Rangierlokomotiven
mit speziellen Aufgaben wurden vor 1900 wirklich nur sehr selten bestellt,
da man oft auf alte Modelle zurückgreifen konnte. Diese hatte man, sie
reichten aber nicht und waren in der Nachbestellung zu teuer. So gesehen mussten zusätzliche
Lokomotiven
für den
Rangierbetrieb in den neuen
Bahnhöfen
Arth-Goldau und Erstfeld beschafft werden. Mit den vorhandenen Maschinen
sollten dann diese Aufgaben in den Bahnhöfen Biasca, Bellinzona und
Chiasso war genommen werden. Zudem wären Lokomotiven im Tessin für die
leichten Züge frei gestellt worden. Der Bedarf war daher gegeben, auch
wenn das damals kaum üblich war.
Die
Gotthardbahngesellschaft
musste daher zwei
Lokomotiven
für den
Rangierdienst
und den ein-fachen Streckendienst auf flachen Strecken an-schaffen. Leichte Maschinen mit geringer Leistung waren vorgesehen. Dabei war die Leistung nicht so wichtig, wie der Preis, denn diese beiden Loko-motiven sollten schlicht billig sein. Erfahrungen mit neuen
Rangierlokomotiven
ge-macht hatte niemand, denn bisher stammten diese einfach aus den
Beständen, was bei einer neuen Bahn schlicht nicht möglich war, zumal man
die passenden Modelle im Tessin vor den Zügen ein-setzen wollte. Schliesslich wollte man das noch zur
Verfügung stehende Geld nicht in
Lokomotiven
investieren, die kaum in der Lage waren einen
Bahnhof
zu ver-lassen. Dazu passte auch die Tatsache, dass man für diesen Zweck
nur zwei
Rangierlokomotiven
neu beschaffte und sich nicht zu einer kleinen Serie durchringen konnte.
Vermutlich wären die Kosten für eine grössere Serie einheitlicher
Lokomotiven einfach zu gross gewesen. Lieferant der beiden neuen
Lokomotiven,
die bei der
Gotthardbahn
mit den Nummern 11 und 12 versehen werden sollten, war die in Winterthur
ansässige und noch junge Maschinenfabrik. Sie hatte das für die
Gotthardbahn passende Angebot unterbreitet. Gerade die
Ausschreibungen
der damaligen
Bahngesellschaften
unterscheiden sich kaum von den Modellen heute, auch wenn weniger Details
genannt wurden. Die Bahn wusste, was sie wollte.
Die meisten zukünftigen
Lokomotiven
der Schweiz sollten dort ihre Geburtsstätte erleben. Die
Gotthardbahn
be-stellte also selbst in der Schweiz Lokomotiven. Es muss noch ein Wort über die Lieferanten verloren werden. Die Gotthardbahn bestellte ihre Lokomotiven zu einem grossen Teil in Deutschland. Von dort war viel Geld in den Bau geflossen und dieses sollte so wieder zurück bezahlt werden. Erst später sollten dann auch andere
Hersteller be-rücksichtigt werden. Dann jedoch oft auch deshalb, weil von
der
Gotthardbahn
immer wieder unmögliche Liefer-fristen verlangt wurden. Die neue Lokomotive, die zu einem Stückpreis von nur 29 000 Schweizer Franken an die Gotthardbahn geliefert wurde, sollte jedoch nicht so recht zur grossen Bahn passen, weil sie doch sehr gedrungen wirkte. Bei einer solchen
Bahngesellschaft
vermutete man die grossen schweren
Lokomotiven,
wie wir sie heute kennen. Damals war aber alles noch anders und es gab die
schmucken kleinen Maschinchen auch bei der
Gotthardbahn. Es sollten nicht die einzigen direkt an die
Gotthardbahn
gelieferten Maschinen der
Gruppe
Rangierlokomotiven
sein. Es waren die
Lokomotiven,
die von der Gotthardbahn bestellt wurden, als diese den Verkehr noch nicht
aufgenommen hatte. Erst mit dem Betrieb hatte man bei der Gotthardbahn das
finanzielle Polster um auch besser geeignete Rangierlokomotiven zu
beschaffen und den dafür verlangten Preis zu zahlen.
|
|||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||
 Für
diese Strecke, aber auch für den
Für
diese Strecke, aber auch für den
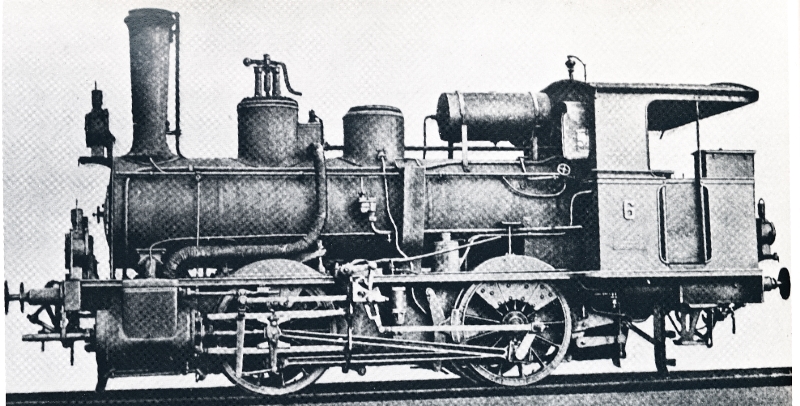 Mit
den bis zu 50 km/h schnellen Maschinen mit der Bezeichnung A hatte die
Bahn eigentlich geeignete
Mit
den bis zu 50 km/h schnellen Maschinen mit der Bezeichnung A hatte die
Bahn eigentlich geeignete
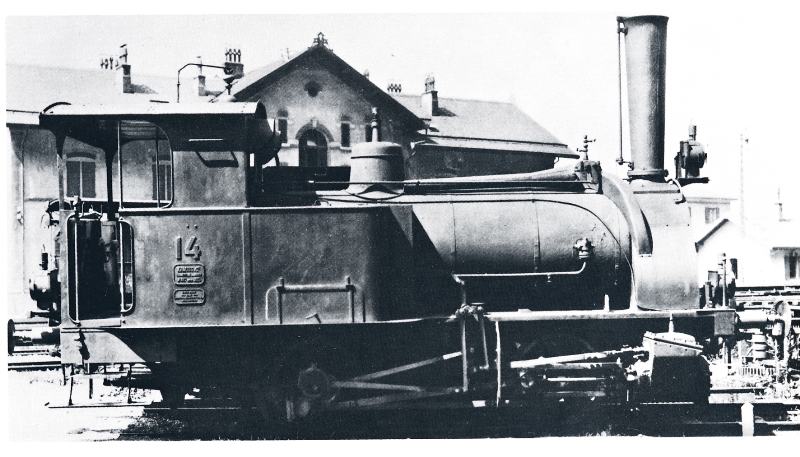 Weitere
Maschinen, die aus Beständen anderer
Weitere
Maschinen, die aus Beständen anderer
 Diese
als Ergänzung der
Diese
als Ergänzung der
 Diese
später unter der Bezeichnung SLM bekannt ge-wordene Maschinenfabrik war
erst vor wenigen Jahren gegründet worden und sollte mit den Jahren im
Bereich des Lokomotivbaus, als
Diese
später unter der Bezeichnung SLM bekannt ge-wordene Maschinenfabrik war
erst vor wenigen Jahren gegründet worden und sollte mit den Jahren im
Bereich des Lokomotivbaus, als