|
Dampfmaschine, Steuerung und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der im
Kessel
erzeugte Dampf wurde über einen
Regulator
dem
Dampfdom
entnommen und innerhalb des Kessels in die beiden Dampfrohre geleitet. Ab
dort gelangte der Dampf zu den Flachschiebern der
Dampfmaschinen.
Hier wurden insgesamt vier
Zylinder
im
Verbund
betrieben. Diese Lösung hatte sich mittlerweile in der Schweiz
durchgesetzt und die Erfahrungen bei der
Gotthardbahn zeigten den Vorteil des Verbundes.
Bei schweren Anfahrten konnten die
Zylinder
über ein Wechselventil umgeschaltet werden. Jetzt wurden die vier Zylinder
parallel betrieben und wir können jetzt von einem Vierling sprechen. Es
konnte so eine gesteigerte
Zugkraft
erzeugt werden. Wie lange dieser
Booster
eingeschaltet blieb, war dem
Lokomotivpersonal
überlassen. Jedoch musste bedacht werden, dass der Betrieb als Vierling
sehr viel Dampf benötigte und daher nicht wirtschaftlich war.
Die Anordnung der vier
Zylinder
erfolgte nach der
Bauart
De-Glehn. Das bedeutete, dass die
Dampfmaschinen
geändert angeordnet wurden. In der Folge wurde der frische Dampf aus dem
Kessel
über die
Schieber
den äusseren Zylindern zugeführt. Das war eine Lösung, die selten
angewendet wurde, weil dazu etwas längere Leitungen benötigt wurden.
Jedoch konnten so die Zylinder ohne Problem waagerecht angeordnet werden.
Wobei der Kolbenhub grösser war und so das
Volumen, das für die
Leistung
genutzt werden konnte. Somit waren die
Dampfmaschinen
grundsätzlich der gleichen Leistungs-klasse zuzuordnen. Jedoch merkte das
der Betrachter schlicht nicht. Weil hier die Hochdruckzylinder aussen montiert wurden veränderte sich das Bild. Daher erschienen sie im Ver-gleich zu den anderen Baureihen sehr klein und äusserst elegant. Das verhalf der Lokomotive zu ihrem eleganten Aussehen.
Da diese
Zylinder
zudem keine
Schlemmhähne
benötigten, war aussen kaum etwas zu erkennen. Genau hier zeigte sich die
Bauart
De-Glehn, die bei den Maschinen der
Gott-hardbahn nicht umgesetzt wurde. Über die Verbinder, die dem Aufbau im Verbund den Na-men gaben, gelangte der Abdampf der Hochdruckzylinder zu den Schiebern der Niederdruckzylinder.
Diese
Zylinder
wurden in einem gemeinsamen Zylinderblock, der im Rahmen mit einer Neigung
von 1:20 montiert wurde, untergebracht. Den Grund für die starke Neigung
dieser Zylinder werden wir später bei der Betrachtung des
Antriebes
noch genauer kennen lernen.
Die innen montierten
Niederdruckzylinder
hatten im Vergleich zu den äusseren Modellen einen viel grösseren
Durchmesser erhalten. Dabei betrug der Durchmesser bei vergleichbarem
Kolbenhub 570 mm. Bei diesem grossen Durchmesser konnte sich der
Kolbenschieber bei einseitiger Führung jedoch leicht verkanten. Deshalb
wurde die
Kolbenstange
bei diesen
Dampfmaschinen
beidseitig aus dem
Zylinder
geführt, so dass dies vorne zu sehen waren.
Bei der
Leistung
dieser vier
Dampfmaschinen
gab es zwischen den
Prototypen
und der Serie geringe Unterschiede. So wurde bei den beiden Prototypen
eine Leistung von 1 260 PS angegeben. Die Maschinen der Serie lagen mit
1 280 PS jedoch nur unwesentlich höher. Auch jetzt lohnt sich ein
Vergleich zu den
A3t der
Gotthardbahn, die für damalige Verhältnisse mit 920 bis
1 200 PS deutlich unter dem Modell der
JS
lagen.
Damit kommen wir zur Steuerung. Obwohl der
angewendete Versatz der einzelnen
Dampfmaschinen mit 180° zwischen
Hochdruck- und
Niederdruckzylinder und 90° zwischen den beiden Seiten der
Lokomotive, identisch mit der
A3t der
Gotthardbahn war, wurde hier eine
andere Lösung für die Steuerung verwendet. So wurde für jede Dampfmaschine
eine eigene Steuerung eingebaut. Am gleichmässigen und runden Lauf der
Dampfmaschinen änderte sich dadurch jedoch nichts.
Verstellt und so die Fahrrichtung vorgegeben werden, konnte diese
Steuerung mit dem Verschieben eines Gleitsteins innerhalb der Schmiege. Für die inneren Niederdruckzylinder wurde jedoch nicht die gleiche Steuerung verwendet. Hier baute man die mit einem Kreisel funktionierende Steuerung nach Joy ein.
Diese
Joysteuerung hatte
gerade in England, wo innen liegenden
Triebwerke oft verwendet wurden,
gute Eigenschaften erzielt. Zwar lief die
Dampf-maschine nicht ganz rund,
aber die Steuerung fand auf sehr kleinem Raum ihren Platz. Das war
natürlich innerhalb des Rahmens von Vorteil. Sowohl die Steuerung nach Walschaerts, als auch jene nach Joy, wurden mit einer einzigen Verstellstange eingestellt. Das machte die Konstruktion etwas aufwendiger, vereinfachte jedoch die Bedienung der Lokomotive.
Die Erfolge dieser Kombination zeigten sich bei
anderen Maschinen mit Verbinder. Im Gegensatz zur
Gotthardbahn, war diese
Lösung aber ein wenig schwerer geworden, was sich aber beim Gewicht nicht
gross auswirkte.
Es zeigt sich hier, dass die Steuerungen der
Dampfmaschinen immer weiter entwickelt wurden. Die
A3t der
Gotthardbahn
bekam daher die gut funktionierende Steuerung nach
Walschaerts. Hier
ergänzte man diese jedoch mit der neuen Steuerung nach
Joy und verbesserte so die
Funktion der Dampfmaschinen, da man jetzt die
Zylinder sehr genau
einstellen konnte. Ein Punkt, den man bei gleichen Kenndaten zur besseren
Ausnutzung der Kraft nutzen konnte.
Der Versatz der
Dampfmaschinen konnte beibehalten werden, die diese beiden
Achsen mit einer
Kuppelstange verbunden wurden und sich so nicht
verschieben konn-ten. Beginnen wir mit dem inneren Triebwerk, das an den Niederdruckzylinder angeschlossen wurde. Die Kolben-stange war hier mit einem doppelseitig geführten Kreuz-gelenk verbunden worden.
Ab dem
Kreuzgelenk wurde schliesslich die
Schubstange zur ersten
Triebachse
geführt. Wegen dieser kurzen Di-stanz, mussten die
Zylinder geneigt
montiert werden, weil nur so der Winkel im Kreuzgelenk auf einem
vertretbaren Wert gehalten werden konnte.
Die
Lager dieses
Antriebes wurden mit
Gleitlagern
versehen. Deren Lagerschalen wurden mit
Weissmetall ausgekleidet. Zur
Schmierung verwendete man
Öl, das über eine Nadelschmierung zu den Lagern
geführt wurde. Hier wurde der Vorrat des
Schmiermittels über die
Schmierpumpe zu den Wellenlagern geführt. Das erübrigte die komplizierte
Nachschmierung in diesem beengten Bereich der
Lokomotive und beschränkte
sich auf eine einfache Kontrolle.
Da wegen dem
Antrieb auf die
Achse selber kein
Kurbelzapfen vorhanden war, musste die
Triebachse gekröpft ausgeführt
werden. Diese aufwendig zu erstellende Achse ermöglichte erst den Aufbau
von Maschinen mit mehr als zwei
Zylindern. Zudem waren die Wellenlager
sehr schwer zugänglich. Mit der vorhandenen Schmierpumpe war jedoch
gesichert, dass immer genug
Schmiermittel vorhanden war. So funktionierte
das innere
Triebwerk sehr gut.
Bei der
Bauart De-Glehn arbeiteten die äusseren
Hochdruckzylinder auf die zweite
Triebachse. Hier wurde die
Kolbenstange
mit einem einseitig geführten
Kreuzgelenk verbunden. Von dort führte die
Schubstange schliesslich in einem vergleichsweise flachen Winkel zum
Kurbelzapfen der Triebachse. So wurde schliesslich die lineare Bewegung in
einen drehende umgewandelt. Letztlich wurden die beiden Triebachsen und
die
Kuppelachse mit einfachen
Kuppelstangen verbunden.
Zur
Schmierung verwendete man
Öl,
das über eine Nadelschmierung zu den
Lagern geführt wurde. Unterschiede
gab es nur beim Vorrat an
Schmiermittel. Hier wurden die Gefässe an den
Stangen montiert und daher musste man dieses
Triebwerk regelmässig
nachschmieren. Letztlich wurde mit Hilfe der Haftreibung zwischen Rad und Schiene aus der Bewegung des Rades eine Zugkraft erzeugt. Die hier massgebenden Kräfte waren durch die Physik bestimmt und konnten kaum mit konstruktiven Massnahmen beeinflusst werden.
Mit einer durchschnittlichen
Achslast auf den
Triebachsen von 15 Tonnen war eine gute Ausnützung der
Adhäsion zu erwarten. Wobei man wegen den
vor-handenen Gleisanlagen keine höheren
Lasten haben durfte. Mit den drei Triebachsen und der Kraft der Dampfmaschinen, konnte die Lokomotive eine Zugkraft von 76 kN erzeugen. Speziell wurde dieser Wert erst durch einen Vergleich.
Bei der hier
vorgestellten Maschine lag man bei der
Zugkraft vier Kilonewton über der
Baureihe
A3t der
Gotthardbahn. Erst die Maschen der Gotthardbahn, die
gleichzeitig oder später geliefert wurden, erreichten diese Werte oder
überboten sie sogar.
Das wirkte sich natürlich auf die
Normallasten
aus. So konnten mit der Maschine der
JS auf vergleichbaren Steigungen
durchaus die Lasten der
Gotthardbahn gezogen werden. Insbesondere im Jura,
war das natürlich ein Vorteil. Die Maschine konnte das gleiche Programm
fahren, war jedoch wegen den grösseren
Rädern mit 100 km/h etwas schneller
unterwegs. Die Vorgaben des
Pflichtenheftes wurden daher übertroffen und
wir haben eine gute Maschine erhalten.
Um die
Haftreibung, die bei Dampflokomotiven wegen
den
Schlemmhähne der
Zylinder immer etwas schlecht war, im Betrieb zu
verbessern, baute man eine
Sandstreueinrichtung ein. Diese bestand aus dem
auf dem
Kessel montierten Sanddom. Ab diesem führten schliesslich die
Leitungen vor die
Triebachsen eins und zwei. Damit der Sand durch die
langen Leitungen befördert wurde, unterschützte man die Schwerkraft mit
Druckluft.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
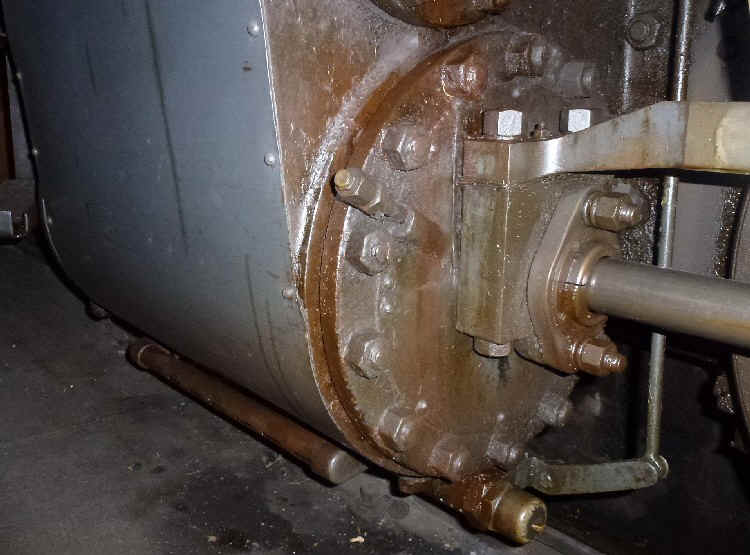 Die
Die
 Bei den aussen montierten
Bei den aussen montierten
 Der Aufbau des
Der Aufbau des
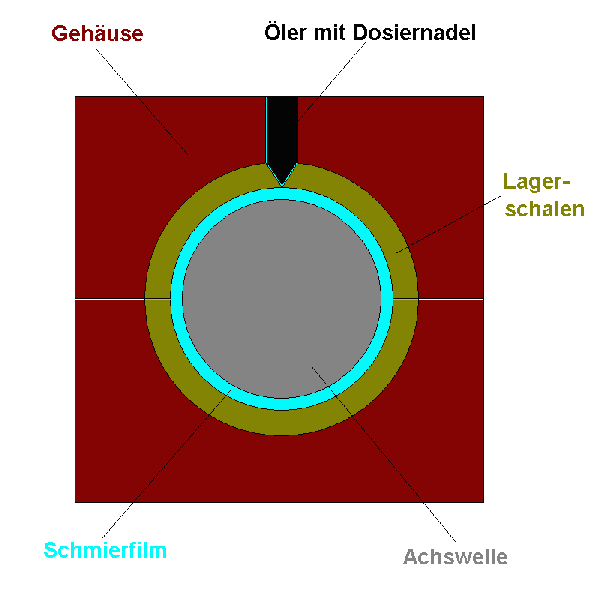 Die
Die