|
Laufwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um das
Laufwerk
der
Lokomotive
näher kennen zu lernen, sehen wir uns zuerst die
Achsfolge
an. Diese wurde mit Bo’Bo’ angegeben. Daraus ableiten können wir daher,
dass zwei identische
Fahrwerke
vorhanden waren und dass es sich dabei um einfache
Drehgestelle
mit einem
Antrieb
auf jede
Achse
einzeln handelte. Das erlaubt es uns die nähere Betrachtung auf eines der
beiden Drehgestelle zu beschränken und so die Sache etwas zu vereinfachen.
Jedoch erfolgten dabei punktuell einige
Anpassungen, die auf den Erfahrungen mit den Mustern aufbauten. Sie sehen,
dass man so eigentlich zu einem bewährten
Laufwerk
griff, dass sich schon seit einigen Jahren im Betrieb behaupten konnte.
Für jedes
Drehgestell
wurde ein stabiler und verwindungssteifer Rahmen erstellt. Dieser bestand
aus dem beim Bau von Drehge-stellen üblichen Stahl. Dabei wurden die
einzelnen Bleche mit Hilfe der elektrischen
Schweisstechnik
zum fertigen Bauteil verbunden. So entstand ein Hohlrahmen der im Bereich
der Mitteltraverse gekröpft wurde und der ein geschlossenes H bildete.
Grosse Neuerung konnten hier nicht umgesetzt werden.
In jedem
Drehgestellrahmen
wurden zwei
Achsen
eingebaut. Diese bestanden aus geschmiedetem Stahl und sie besassen die
Aufnahmen für die beiden
Räder
und die
Lager.
Der Abstand dieser beiden Achsen zueinander betrug 2 700 mm. Wobei das
hier jedoch nur im geraden
Gleis
galt, denn das
Laufwerk
der Baureihe Re 450 verfügte über flexibel gelagerte Achsen. Wie das genau
funktionierte, sehen wir uns anschliessend an.
Gerade bei einer
Lokomotive,
wo auf jedes Gramm geachtet werden musste, mag das überraschen, aber die
Triebwagen
hatten gezeigt, dass diese
Räder
hohe Laufleistungen erreichten. Um das Gewicht der beiden Räder trotzdem weiter zu vermindert, wurde derer Grösse verringert. So hatten diese im neu eingebauten Zustand nur noch einen Durchmesser von 1100 mm erhalten.
Im Betrieb konnten sie bis auf einen Wert
von 1040 mm abgenutzt werden. Dann musste aber das komplette
Rad
durch ein neues Modell ersetzt werden, denn eine Behandlung mit einem
Radreifen
war nicht mehr vorge-sehen. Damit die rotierende Welle in einem festen Bauteil eingebaut werden konnte, wurden Lager benötigt. Die-se waren hier aussen angebracht worden und es wur-den die üblichen doppelreihigen Rollenlager verbaut.
Der Vorteil dieser
Lager
bestand darin, dass sie mit
Fett
geschmiert werden konnten und dass diese
Schmierung
dauerhaft erfolgte. Diese Lager mussten daher nur beim Austausch der
Räder
gewartet werden. Ein Problem bei Achslagern war, dass diese eine grosse Drehzahl hatten. Diese wurde hier durch die verklein-erten Räder noch erhöht.
Jedoch hatten im Ausland diese
Rollenlager
gezeigt, dass sie für weitaus grössere Geschwindigkeiten, als die hier
zugelassenen 130 km/h geeignet waren. Daher konnte diese Lösung beruhigt
angewendet wer-den und die vielen verkehrten Fahrzeuge auf
Schiene
und Strasse, zeigten den Erfolg.
Jedes
Achslager
wurde gegenüber dem
Drehgestellrahmen
abgefedert. Dabei wurde hier das Gewicht vermindert, da man nur noch eine
Feder pro
Lager
verwendete. Diese wurde über dem Achslager eingebaut und sie bestand aus
Stahl. Genau wurden bei den Achslagern
Flexicoilfedern
verbaut. Diese konnten gegenüber den bisher angewendeten
Schraubenfedern
auch auf Torsion belastet werden. Etwas, was hier sehr wichtig war.
Bei den hier verbauten
Flexicoilfedern
wurden dazu je-doch statt mechanische, hydraulische Lösungen verbaut. Der
Vorteil dabei war, dass diese leichter eingestellt werden konnten.
Eine starre Führung der
Achslager
war hier jedoch nicht mehr vorhanden. Auch die mit der
Lokomotive
Re 4/4 II eingeführten
gefederten Achslager gab es nicht mehr. Bei der Baureihe Re 450 wurden
Radsätze
verbaut, die sich im Betrieb radial einstellen konnten. Dabei erfolgte
diese Einstellung jedoch auf passive Weise, so dass wir nicht von
gesteuerten Radsätzen sprechen dürfen, diese kamen erst mit der Reihe
Re 460.
Durch die fehlende Führung der
Achslager
konnten sich die
Radsätze
in einer
Kurve
durch die auf das
Rad
wirkenden Kräfte im
Gleis
an die Kurve anpassen. Dabei wurden die
Flexicoilfedern
verdreht und auf Torsion belastet. Da sie jedoch wieder in die
ursprüngliche Lage zurückkehren wollten, gab es eine Kraft, die den
Radsatz sobald es möglich war, wieder in die korrekte mittige Lage
verbrachte. Die Einstellung erfolgte dabei an die Kurve angepasst.
Das so sehr flexible System hatte jedoch
zwei Probleme. Die
Zugkräfte
konnten nicht über das
Lager
übertragen werden und die Kräfte im
Gleis
konnten dazu führen, dass der
Radsatz
am
Drehgestellrahmen
anschlagen und beschädigt werden konnte. Der letzte Punkt wurde mit am
Achslager
montierten Stösseln jedoch verhindert. So war die maximal möglich
Auslenkung des Radsatzes durch deren Wegstrecke beschränkt worden.
So wurden die
Spurkränze
stärker belastet. Um das zu ver-mindern, wurde auch bei der Baureihe Re
450 eine intensiv wirk-ende
Spurkranzschmierung
verbaut. So konnte der Verschleiss deutlich gemindert werden. Durch die Tatsache, dass sich die Radsätze in den Kurven einstel-len konnten und dank der Spurkranzschmierung war es kein Pro-blem mit der Lokomotive die Zulassung zur Zugreihe R zu erlangen.
Das war klar eine Forderung im
Pflichtenheft
und seit der Bau-reihe
Re 4/4 II hatten die
Konstrukteure diese im Griff, auch wenn dazu bei der Reihe
Re 6/6 mit einem zusätzlichen Trick
gearbeitet wurde. Die angesprochene
Querkupplung
gab es hier nicht. Vorher haben wir erfahren, dass diese flexiblen Führungen der Achsen keine Zugkräfte aufnehmen konnten. Da wir nun aber eine Lokomotive haben, mussten diese übertragen werden.
Daher kommen wir zu den
Antrieben
und bei diesen gab es gegenüber der KTU Re 4/4 leichte Abweichungen. Doch
auch hier musste dazu zuerst der
Fahrmotor
im
Drehgestell
eingebaut werden und dabei griff man auf eine ältere Lösung zurück.
Der
Fahrmotor stützte sich einseitig auf die
Achse
ab. Die zweite Abstützung war jedoch mit einem Tatzenlager und einer
elastischen Drehmomentstütze versehen worden. Diese Stütze erlaubte es dem
Fahrmotor sich zusammen mit dem
Radsatz in der
Kurve einzustellen. Genau
hier lag jedoch der Grund für diese Lösung, denn der Winkel des Motors
gegenüber der Achse durfte sich wegen dem verbauten
Getriebe nicht
verändern.
Jedoch konnte dessen Gewicht
weiter verringert werden, so dass sich diese Probleme nicht so sehr
auswirkten. Doch nun gab es auch ein Problem, denn auch diese Lösung
konnte keine
Zugkräfte übertragen. Das im Fahrmotor erzeugte Drehmoment wurde von diesem auf ein Getriebe übertragen. Dabei kam ein schräg verzahnten Getriebe mit einer Übersetzung von 1:6.056 zum Einbau.
Durch diese
Übersetzung wurde das
Drehmoment so verändert, dass sich die Drehzahl
minderte und dafür die Kraft vergrössert wurde. Eine Lösung, die jedoch
bei allen
Lokomotiven angewendet wurde, denn die Motoren hatten zu hohe
Drehzahlen.
Um das empfindliche
Getriebe vor Verschmutzung zu
schützen, war es in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut worden. Dieses
war mit einer
Ölwanne versehen worden. Dort wurde normales Schmieröl
gelagert. Durch das sich nun drehende
Zahnrad wurde von den Flanken das
Schmiermittel aufgenommen und auf das Ritzel übertragen. Durch die nun
wirkenden Fliehkräfte wurde ein Teil des
Öl an die Wände geschleudert.
Gerade der Schutz des
Getriebes war immer ein
wichtiger Punkt. So wurden bei den Modellen mit
Seriemotorn gefederte
Ritzel zur Minderung der
Drehmomentpulsation eingebaut. Diese gab es hier
nicht mehr, jedoch hatten die KTU Re 4/4 gezeigt, dass dem Getriebe eine
neue Gefahr droht und diese kam von den
Achsen. Kam die
Lokomotive ins
Schleudern, übertrugen sich die Schläge direkt auf das Getriebe, was
diesem nicht gut bekam.
Dank den Elementen konnte
der Einbauraum ge-mildert werden, da sie nicht so viel Platz benötig-ten.
Das
Getriebe war jedoch so gut es ging vor dieser Belastung geschützt. Das so auf die Achse übertragene Drehmoment wurde in den beiden Rädern mit Hilfe der Haft-reibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zug-kraft umgewandelt.
Um diese hohen Kräfte auch bei schlechtem
Zustand der
Schienen übertragen zu können, war eine
Sand-streueinrichtung
vorhanden. Massnahmen, die je-doch bei
Lokomotiven der Schweizerischen
Bun-desbahnen SBB schon seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt wurden. Nun muss aber die Zugkraft auf den Drehgestell-rahmen und anschliessend auf den Kasten über-tragen werden.
Wir haben vorher
erfahren, dass diese nicht über die
Achslager und auch nicht mit der
Befestigung des Motors erfolgen konnte. daher wurde der Weg über den Motor
gewählt. Neben der Abstützung im Rahmen waren zwei Schiebelager eingebaut
worden. Diese konnten sowohl auf
Zugkraft als auch auf Druck belastet
werden.
Die Schiebelager waren trapezförmig eingebaut worden
und konnten sich verstellen. Durch die hier nun anstehenden Kräfte und
wegen dem Einbau erfolgte eine zusätzliche Kraft, die den
Radsatz gerade
ausrichtete. Zudem bewirkten diese Stützen auch, dass der Radsatz seine
Position im
Drehgestell zentrierte. Wir haben somit auch die
Achslager von
der Kraftübertragung entkoppelt, was deren Lebensdauer erhöhte.
Bevor wir dem Kraftfluss weiter folgen können,
müssen wir die
Drehgestelle unter dem Kasten einbauen. Damit sie die
Position behalten konnten, war in der Mitte ein
Drehzapfen verwendet
worden und zudem wurde das Drehgestell gegenüber dem Kasten gefedert.
Diese sekundäre
Federung bestand aus insgesamt sechs
Federn. Auch hier
mussten wegen der Auslenkung
Flexicoilfedern verwendet werden. Die
Rückstellung entsprach den
Achslagern.
Da wir nun die
Laufwerke unter dem Kasten eingebaut
haben, können wir einige Masse überprüfen. Der Abstand der beiden
Drehzapfen betrug 10 350 mm und die
Lokomotive hatte eine Höhe von 4 500
erhalten. Damit passte sie in das normale
Lichtraumprofil der Schweiz. Die
maximal mögliche Auslenkung der
Drehgestelle erlaubte es mit der
Lokomotive Kurven mit einem Radius von lediglich 80 Metern zu befahren.
Das so fertig aufgebaute
Drehgestell hatte ein
Gewicht von zwölf Tonnen erhalten. Gerade dieser Wert zeigt deutlich auf,
wie leicht der Kasten wirklich gebaut wurde. Jedoch müssen wir auch
berücksichtigen, dass die
Fahrmotoren auch hier ein recht hohes Gewicht
hatten und wir noch nicht alle Bauteile kennen gelernt haben, die im
Drehgestell eingebaut wurden. Dazu gehört auch noch die fehlende
Übertragung der
Zugkraft.
So fehlt uns der weitere Weg der
Zugkraft. Dieser
erfolgte nicht, wie man erwarten könnte, über den
Drehzapfen des
Drehgestells. Vielmehr war eine
Tiefzugvorrichtung eingebaut worden. Diese
griff die Zugkraft im Bereich des Drehgestells auf 200 mm über der
Oberkante der
Schiene ab und übertrug die Kraft nun mit einfachen
Zugstangen auf Mitnehmer, die am Kasten eingebaut wurden. Die gefürchtete
Entlastung der vorlaufenden
Achse wurde so verhindert.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
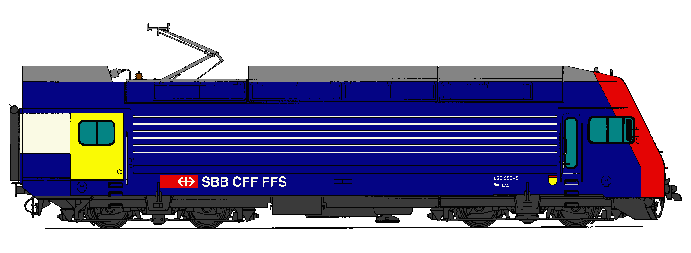 Nicht
aus der
Nicht
aus der

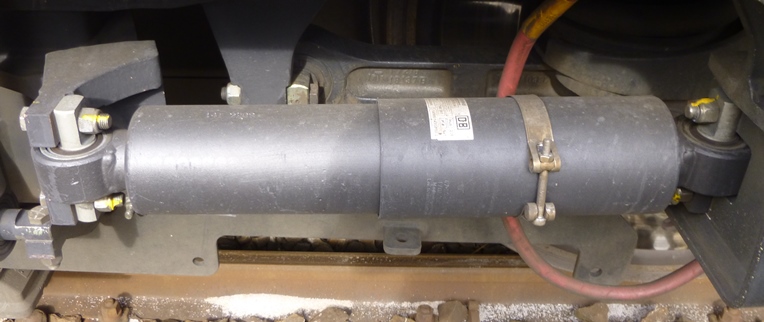 Wie
die
Wie
die
 Diese
Diese
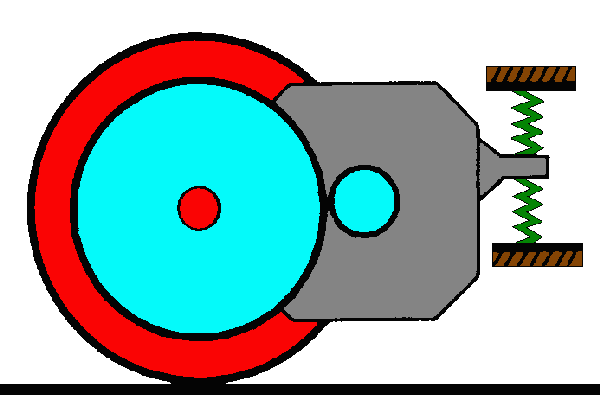 Auch wenn wir hier viele Merkmale des als veraltet
verschrienen
Auch wenn wir hier viele Merkmale des als veraltet
verschrienen 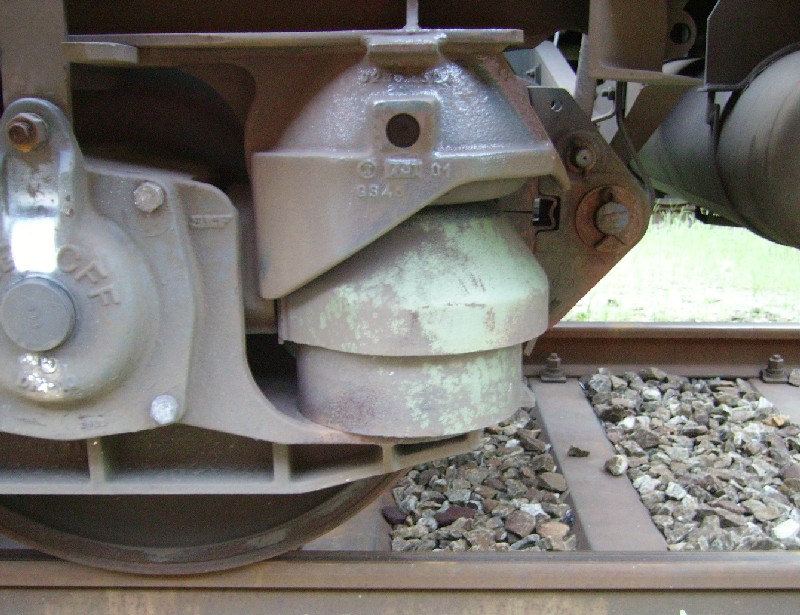 Aus diesem Grund wurde der
Aus diesem Grund wurde der