|
Der Kasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Am 29. Juli 1988 wurde der erste fertige
Kasten von der SLM an die ABB geliefert. Damit konnte erstmals auch ein
Blick auf die Arbeit des Mechanikers geworfen werden. Dieser hatte keine
so leichte Aufgabe, wie man das meinen könnte, denn die Reduktion beim
Gewicht musste zu einem grossen Teil im mechanischen Bereich erfolgen.
Dabei konnte die SLM jedoch auf die bei früheren Modellen gemachten
Erfahrungen zurückgreifen.
Viele der dort gemachten Erfahrungen konnten
daher in das hier vorgestellte Modell übertragen werden. Wirkliche
Neuerungen waren daher nicht zu erwar-ten. Merkmal der selbsttragenden Kasten war, dass dieses in vier Baugruppen aufgeteilt wurden. Diese Aufteil-ung wollen auch wir machen und daher teilte ich den Kasten in die Bereiche Untergurt, Seitenwände, Dach, Gepäckabteil und Führerstand auf.
Für die Festigkeit des Konstrukts wurden
jedoch nur der Untergurt und die beiden Seitenwände benötigt. Daher werden
wir die Betrachtung auch mit diesen beiden Zonen beginnen.
Der Untergurt war für die Aufnahme der
Baugruppen vorgesehen und in seinem Bereich wurden auch die Zug- und
Stosskräfte
in das Fahrzeug eingeleitet. Aus diesem Grund musste hier eine grosse
Festigkeit vorhanden sein. Als Werkstoff kam normales Stahlblech mit einer
Dicke von 30 mm zu Anwendung. Die einzelnen Bleche wurden dabei mit Hilfe
der elektrischen
Schweisstechnik
zu einem stabilen Hohlträger verbunden.
Punktuell wurde der Untergurt so verstärkt, dass die
von den anderen Fahrzeugen übertragenen Kräfte optimal in das Bauteil
eingeleitet wurden. Von den an diesem Bauteil angebauten Baugruppen sehen
wir uns hier nur den
Bahnräumer an. Dieser wurde nur auf einer Seite
angebaut, da es sich bei der
Lokomotive um einen
Triebkopf handelte und
daher der Schutz des
Fahrwerkes nur auf einer Seite benötigt wurde.
So konnten
sie die Schutzfunktion wahrnehmen, hatten aber ein deutlich geringeres
Gewicht. Bei einer
Loko-motive wo in der Leichtbauweise gearbeitet werden
musste war klar, dass auch hier dieser Werkstoff ver-wendet werden musste. Die weiteren Baugruppen, die am Untergurt befestigt wurden, werden wir uns später noch ansehen. Es muss hier erwähnt werden, dass diese aber vom Untergurt nicht getragen werden konnten, denn dieser war von seiner Konstruktion her für die Längskräfte ausgelegt worden.
Daher musste das Bauteil verstärkt werden und dazu waren die Seitenwände
vorgesehen. Diese wurden mit dem Untergurt verschweisst und waren daher
formschlüssig verbunden.
Bei den beiden Seitenwänden wurde eine grosse
Einsparung beim Gewicht erreicht, wenn dünnere Bleche verwendet wurden.
Diese Lösung wurde schon bei der Baureihe Re 4/4 IV verwendet. So wurden
auch hier Bleche verbaut, die nur über eine Stärke von 15 mm verfügten.
Damit sie trotzdem eine genug grosse Festigkeit hatten, wurden Sicken
vorgesehen. Dank den neun vorhandenen Sicken wurden beide Wände deutlich
leichter.
Mit den beiden Seitenwänden können wir nun die
Breite des Kastens bestimmen. Diese betrug über die Sicken gemessen 2 980
mm. Das erlaubte
Lichtraumprofil wurde dabei nicht ausgenutzt, jedoch
werden wir später noch Bauteile kennen lernen, die dieses Mass
überschreiten sollten. Die
Lokomotive konnte aber auch mit diesen in der
Grundstellung das erlaubte Profil einhalten, so dass es keine Probleme
damit gab.
Eine Lösung, die dank den neuen elektrischen
Baugruppen ge-wählt werden konnte und die auch für ausgeglichene Lasten
in-nerhalb der
Radsätze sorgte. So war auch hier die verlangte
Leichtbauweise zu erkennen.
Abgestützt wurden die beiden Seitenwände durch die
in der
Lokomotive beim
Führerstand und beim
Gepäckabteil vorhan-denen
Querwände. Zusätzlich wurden gleichmässig verteilt im Bereich des Daches
noch zwei einfache Querträger eingebaut. So konnten die Kräfte optimal
aufgenommen werden. Jedoch haben wir damit auch erfahren, dass es bei
dieser Maschine zwei unterschiedlich gestaltete Abschlüsse gab.
Ich beginne die beiden Bereiche mit der Rückseite
der
Lokomotive. Durch den Aufbau als
Triebkopf hatte diese eine klare
Richtung bekommen. Das können wir nutzen und nun den
Gepäckraum ansehen.
Dieser hatte eine rechteckige Grundfläche erhalten und er hatte eine
Grundfläche von 9 m2 bekommen. Das lag etwas unter dem
Pflichtenheft, hatte jedoch auf die Zuladung von vier Tonnen keine
Auswirkungen erhalten.
Der Zugang zum
Gepäckraum erfolgte auf beiden Seiten
der
Lokomotive über genug breite Tore. Diese waren mit einem grossen
Fenster versehen worden, das aus dem üblichen
Sicherheitsglas bestand.
Geöffnet wurden die beiden Tore auf beiden Seiten gegen den hinteren
Abschluss der Lokomotive, so dass dort eine senkrechte Wand vorhanden war.
Wegen den Sicken konnte nur diese Lösung angewendet werden und wir haben
das hintere Ende erreicht.
Mittig wurden die
Zugvorrichtungen nach den Normen
der
UIC montiert. Diese bestanden aus dem im Untergurt gelagerten und
seitlich verschiebbaren
Zughaken. Durch die eingebauten kräftigen
Spiralfedern konnte sich der Haken auch in Längsrichtung bewegen. Damit
konnten die Kräfte auf der am Zughaken montierten
Schraubenkupplung
vermindert werden. Auch diese war nach den Normen der UIC aufgebaut
worden.
Da die
Schraubenkupplung nach
UIC keine
Stosskräfte
übertragen konnte, wurde sie mit den beiden seitlichen Stosselementen
ergänzt. Hier kamen die damals üblichen
Puffer zur Anwendung. Es handelte
sich dabei genau um die normalen
Hülsenpuffer mit
Spiralfedern, die mit
rechteckigen
Puffertellern versehen wurden. Wegen dem erwähnten
Gummiwulst
mussten deren Ecken jedoch an der oberen Seite eingezogen werden.
Es wird nun Zeit, dass wir auch das vordere Ende der
Lokomotive betrachten und da kommen wir zuerst zum
Stossbalken auf dieser
Seite. Dieser war nur noch an den Seiten vorhanden. Dort wurden spezielle
Zerstörungsglieder angebracht. Diese sollten den Bereich der Lokomotive bei
einem Kontakt mit einem Fahrzeug, das über die normalen Zug- und
Stossvorrichtungen verfügte, schützen. Eine andere Funktion hatten sie
jedoch nicht.
Mittig wurde an Stelle des
Stossbalkens eine
automatische Kupplung eingebaut. Diese war von der
Bauart GF/Sécheron und
sie entsprach den Modellen, wie sie schon bei den
Triebzügen
RABDe 12/12
verwendet wurden. Mit diesen Fahrzeugen konnten sie jedoch nur mechanisch
und pneumatisch verbunden werden. Die auch mögliche elektrische
Verbindung
der automatischen Kupplung war jedoch nur bei baugleichen Fahrzeugen
möglich.
Mit der
automatischen Kupplung, die zusätzlich zum
Schutz vor Anprällen ebenfalls mit eingebauten
Zerstörungsgliedern versehen
wurde, können wir nun die Länge der
Lokomotive bestimmen. Diese betrug
über die
Kupplung gemessen 18 400 mm. Dabei fiel jedoch auf, dass der
Überstand der automatischen Kupplung auf dieser Seite nur knapp über die
Front reichte. Damit wurden die Züge sehr nahe gekuppelt, was eine seltene
Lösung war.
Bevor wir zu
Front und damit zum
Führerstand kommen,
muss noch erwähnt werden, dass die
automatische Kupplung mit einer
Hilfskupplung auch mit Fahrzeugen verbunden werden konnte, die über die
Zugvorrichtungen der
UIC verfügten. Diese Hilfskupplung befand sich jedoch
nicht auf dem Fahrzeug. Verbunden wurden dabei jedoch nur die
Luftleitungen und die
Stosskräfte wurden nicht auf die
Puffer, sondern
über die Hilfskupplung auf den
Zughaken übertragen.
Über der
automatischen Kupplung wurde die
Front
zunächst senkrecht nach oben geführt. Dabei einstand eine senkrechte Zone,
die jedoch nicht zu breit war. Oberhalb von dieser Wand wurde die Front
nach hinten abgelegt ausgeführt. Die Neigung betrug dabei etwa 25°. Es
entstand so eine einfache Front, deren Kanten abgerundet wurden. Die bei
anderen Baureihen noch verwendete Pfeilung war jedoch nicht vorhanden.
Durch
die flache
Front konnten in diesem Bereich auch sehr einfache, da flache
Frontscheiben verwendet wer-den. Der Grund war simpel, denn die
Sicherheitsgläser waren teuer und der Preis stieg, wenn diese gewölbt
aus-geführt werden mussten. Damit die Festigkeit der speziellen Gläser auch bei kühler Witterung gewährleistet war, mussten die Frontscheiben beheizt werden. Dazu war, wie schon bei den zuvor ausgelieferten Baureihen, Lösungen mit einer auf dem Glas aufgedampften Schicht verwendet worden.
Diese
Scheibenheizung sorgte für eine gleichmässige Er-wärmung und führte
dazu, dass die
Frontfenster den An-schein hatten, als seinen diese getönt
worden. Zur Reinigung der Frontscheibe waren unten zwei Schei-benwischer montiert worden. Deren Arme waren so ausgelegt worden, dass die Wischerblätter senkrecht standen und so ein möglichst grosser Bereich gereinigt werden konnte.
Der
Antrieb erfolgte mit Hilfe von
Druckluft und durch die Steuerung war eine definierte Endstellung
vorgesehen worden. Somit entsprachen die Wischer der neusten Aus-führung
bei den Bahnen.
Um die Scheibe auch vor festsitzendem Schmutz
befreien zu können, waren ebenfalls unterhalb der
Frontscheibe bei jedem
Scheibenwischer die Düsen einer einfachen
Scheibenwaschanlage vorhanden.
Diese Düsen sorgten dafür, dass das Mittel gleichmässig auf der Scheibe
verteilt wurde. Eine Regelung, die dabei automatisch die Wischer
aktivierte, war nicht vorhanden. So konnte das Mittel auch eine Zeit
einwirken.
Obwohl eine optimierte Reinigungsmöglichkeit für die
Scheibe vorhanden war, konnte nicht verhindert werden, dass der Zugang zur
Frontscheibe im Unterhalt erfolgen musste. Dazu wurde unten am Untergurt
ein Tritt montiert und an der
Front die erforderlichen Haltestangen
angebracht. Um den sicheren Stand während der Arbeit zu ermöglichen,
mussten jedoch manuelle
Plattformen verwendet werden, da es kaum
Standflächen gab.
Im oberen Bereich war das übliche Seitenfenster verbaut worden. dieses war nun aber zweiteilig ausgeführt worden und der vordere Teil war fest montiert. Der zweite Teil wurde nicht als Senkfenster, sondern als einfaches Schiebefenster ausgeführt. So konnten dem Lokführer von beiden Seiten Dokumente über-reicht werden. Der sonst bei Schweizer Lokomotiven übliche weisse senkrechte Strich war hier nicht mehr vorhanden, da wir keine Senkfenster hatten.
Der Vorteil dieser Lösung war jedoch, dass die Seitenfenster
besser abgedichtet werden konnten, denn diese waren immer wieder für die
gefürchtete Zugluft verantwortlich. Ein Problem, das gemildert wurde.
Im Bereich des festen Teils der Seitenfenster war
noch ein grosser
Rückspiegel eingebaut worden. Dieser war damit beidseitig
vorhanden und er konnte vom Lokführer bei Bedarf mit einer Fussleiste
aktiviert werden. Damit wurden die beiden Spiegel mit der Hilfe von
Druckluft ausgeklappt. Eine Möglichkeit den Winkel anzupassen war jedoch
nicht vorhanden. Die Rückspiegel waren entweder offen oder geschlossen.
Die
Einstiegstüre öffnete gegen den
Maschinenraum
und sie war nach dem Muster der
Lokomotive Re 4/4 IV aufgebaut worden. Mit
anderen Worten, in der Türe war ein grosses Fenster eingelassen worden.
Das erhellte den Bereich etwas, so dass nicht gleich ein dunkler Raum
entstand. Eine Lösung, die wegen dem Zugang in dem Maschinenraum
erforderlich war. Trotzdem war bei jeder Türe ein Lichtschalter vorhanden.
Da für den Lokführer kein Fluchtweg bestand, wenn es
im
Maschinenraum zu einem Brand kommen sollte, musste eine andere Lösung
gefunden werden. In diesem Fall musste der
Führerstand über eines der
beiden Seitenfenster verlassen werden. Um die Höhe auffangen zu können,
waren im Inventar die entsprechenden Hilfsmittel vorhanden. Eine Lösung,
die auch schon bei der Baureihe Re 4/4 IV angewendet wurde.
Um die Türe vom Boden her zu erreichen, war
unterhalb eine Leiter vorhanden. Deren drei Stufen waren im Untergurt
eingelassen worden. Die unterste Stufe befand sich jedoch in der unter dem
Kasten entlang der ganzen
Lokomotive verbauten Verschalung. Da die Anzahl
der Stufen den anderen Baureihen entsprach war es auch hier erforderlich,
dass beidseitig der Türe zwei
Griffstangen montiert wurden. Wir haben
einen normalen Zugang.
Es wird nun Zeit, dass wir die
Lokomotive abdecken.
Dazu war ein Dach vorhanden. Dieses war in mehrere Bereiche aufgeteilt
worden. Beim
Führerstand und beim
Gepäckabteil war es fest mit dem
restlichen Kasten verbunden worden. Im Bereich des
Maschinenraumes war das
Dach jedoch abnehmbar. Eine Lösung, die für den Unterhalt benötigt wurde,
da die Baugruppen mit einem
Kran in den Maschinenraum gehoben werden
mussten.
Das Dach hatte zwei Schichten erhalten. Seitlich
waren diese gut zu erkennen, denn entlang des
Maschinenraumes wurden
Lüftungsgitter montiert. Diese waren mit den üblichen
Filtermatten
versehen worden und sie reinigten die durch die senkrechten Lamellen in
den Hohlraum gepresst Luft. Der nun vorhandene Hohlraum diente nun der
Beruhigung der Luft. Wie wichtig diese war, werden wir später bei der
Ventilation noch erfahren.
Auch im Bereich des
Gepäckabteils war eine Abdeckung
vorhanden. Diese wurde, wie jene des
Maschinenraumes dazu benötigt, die
Bauteile der elektrischen Ausrüstung zu verdeckten und die
Lokomotive
optimal an die Wagen anzupassen. Wir müssen uns dabei jedoch erinnern,
dass die
Doppelstockwagen höher waren, als normale
Reisezugwagen. Die
Lokomotive war daher gegenüber den Wagen nur etwas breiter ausgefallen.
Um den Kasten abzuschliessen noch ein paar
allgemeine Informationen. Die zulässige Längsdruckkraft im Bereich der
beiden
Hülsenpuffer betrug trotz der Leichtbauweise 750 kN pro
Puffer.
Damit entsprachen die Werte den üblichen Normen. Doch wir müssen noch das
Ergebnis der Bauweise ansehen und das zeigte sich beim Gewicht. Der Kasten
alleine hatte dabei ein Gewicht von 12.9 Tonnen erhalten. jetzt wird es
jedoch Zeit diesen auf das
Fahrwerk zu stellen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Aufgebaut
wurde ein selbsttragender Kasten, der schon leicht war. Dieser wurde aber
mit weiteren Massnahmen versehen, so dass er noch leichter wurde. Man
sprach daher von einer Leichtbauweise, wie sie schon bei der Lokomotive Re
4/4 IV angewendet worden war.
Aufgebaut
wurde ein selbsttragender Kasten, der schon leicht war. Dieser wurde aber
mit weiteren Massnahmen versehen, so dass er noch leichter wurde. Man
sprach daher von einer Leichtbauweise, wie sie schon bei der Lokomotive Re
4/4 IV angewendet worden war.
 Die Seitenwände besassen keine Fenster. Diese hätten
das Ge-wicht unnötig erhöht und sie wurden auch nicht mehr benötigt. Der
Die Seitenwände besassen keine Fenster. Diese hätten
das Ge-wicht unnötig erhöht und sie wurden auch nicht mehr benötigt. Der
 Hier wurde der
Hier wurde der
 Es war eine einfache Frontpartie, die aber einen
Vorteil beim verbauten Fenster hatte. Das bei einem
Es war eine einfache Frontpartie, die aber einen
Vorteil beim verbauten Fenster hatte. Das bei einem
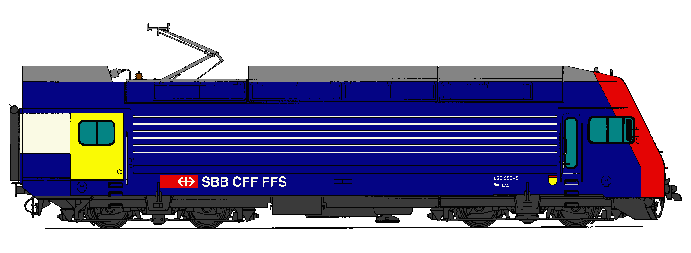
 Wir haben damit den
Wir haben damit den