|
Entwicklung und Beschaffung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im Jahre 1986 zeichnete sich in der Arbeitsgruppe eine Einigung
ab. Damit nahm das für die
S-Bahn
in Zürich gewünschte Fahrzeug auch erste Formen an. Auch wenn nun alle
Beteiligten zu einem Ziel gekommen waren, musste das Modell noch
entwickelt werden. Genau genommen musste ein
Pflichtenheft
ausgearbeitet werden, das der einschlägigen Industrie übergeben werden
konnte. Genau in dieses wollen wir nun einen Blick werfen.
Jedoch hatte der Kanton Zürich während dem ganzen Prozess ein Mitspracherecht, das direkte Auswirkung-en auf die neuen Fahrzeugen haben sollte.
Doch dazu später mehr, zuerst mussten Details be-schrieben werden,
denn nur so wussten die Erbauer, was gewünscht wurde. Gewünscht wurde ein Triebzug der aus einer Loko-motive mit ansprechender Leistung bestand. An diese sollten dann drei Wagen gekuppelt werden. Diese mussten zudem als Doppelstockwagen ausgeführt werden.
Am Schluss dieser festen Einheit war ein
Steuerwagen
vorgesehen, der es auch erlaubte mit dem neuen
Triebzug
in beide Richtungen zu fahren. Für den Unterhalt sollten die Fahrzeuge
einzeln entnommen werden können.
Der komplette
Triebzug
sollte eine Länge von 100 Meter aufweisen. In sich wurden die Fahrzeuge
mit den klassischen Zug- und
Stossvorrichtungen
bei
Personenwagen
versehen. Dank dieser Lösung mit der
Schraubenkupplung
konnte verhindert werden, dass für den schweren Unterhalt ein grosser
Aufwand betrieben werden musste. Ein Wagen konnte, wie die anderen
Modelle, in die passenden
Geleise
gestellt und auch so verschoben werden.
Nur am Schluss der Einheit kam es zum Einbau einer
automatischen Kupplung,
die zu den
Triebzügen
RABDe 12/12 passen
sollte. Hier lagen sicherlich auch die Interessen der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB vor, die so theoretisch die Wagen in normale Züge
einreihen konnten. Bei der gewünschten automatischen Kupplung wurde jedoch
im
Pflichtenheft
erwähnt, dass nur die mechanischen
Verbindungen
zu dem
RABDe 12/12
möglich sein mussten.
Trotzdem wurde in den
Pflichtenheften
der komplette
Triebzug
umschrieben. Durch die Festlegung der einzelnen Fahrzeuge wurde aber nicht
ein klas-sischer Triebzug, sondern ein
Pendelzug
gewünscht. Damit erhoffte man sich Vereinfachungen beim Unterhalt. Bevor wir uns genauer mit der Lokomotive befassen, ein paar interessante Angaben zum kompletten Triebzug. Genauer genommen um de Ausstattung der Fahrzeuge, denn diese bot eine grosse Überraschung.
Insbesondere der Komfort bei den neuen
S-Bahnen
wurde genau definiert und musste daher von den Erbauern eingehalten
werden. Wie weit hier der Kanton beim
Pflichtenheft
mitreden konnte, entzieht sich meiner Kenntnis. In der zweiten Wagenklasse wurde ein Komfort erwartet, der den Einheitswagen I entsprach. Diese doch schon älteren Fahrzeuge galten in die-sem Bereich als sehr komfortabel.
Trotzdem war das eher eine Überraschung, den mit den
Triebwagen
RBDe 4/4 war durchaus eine
Steigerung vorhanden. Jedoch sollten mit den neuen Einheiten so viele
Leute, wie nur möglich befördert werden. Daher die Ab-striche beim
Komfort.
Für die erste
Wagenklasse
nahm man die
Triebzüge
der Baureihe
RABDe 12/12 als
Muster. Somit war auch klar, dass in keinem der Wagen eine
Klimaanlage
gewünscht wurde. Diese erachtete man damals als im
Nahverkehr
nicht als sinnvoll. Daher wurde darauf verzichtet, auch wenn die neuen
Einheitswagen IV
damit versehen wurden. Die neue
S-Bahn
für Zürich sollte deshalb im Bereich des Komforts kaum neue Massstäbe
setzen.
Der Grund lag in der Tatsache, dass bei den Triebzüg-en RABDe 12/12 im Bereich der ersten Wagenklasse die Bestuhlung mit vier Sitzen in der Breite gewählt wurden.
Der
Einheitswagen
war für längere Strecken gebaut worden und hatte daher die Lösung 2/1. Sie
sehen, hier sollte es enger werden. Da wir hier die Lokomotive genauer ansehen wollen, lassen wir die drei Wagen für einmal beiseite. Diese klar zu den hier vorgestellten Fahrzeugen passenden Wagen werden an der geeigneten Stelle kurz vorge-stellt werden.
Auch wenn es starre Einheiten waren, der formierte Zug galt als
Pendelzug
und nicht als
Triebzug
und daher liegt der Schwerpunkt dieses Artikels auf der
Lokomotive,
die dazu benötigt wurde. Im Pflichtenheft der Lokomotive war nur erwähnt worden, dass die Maschine mit den Wagen ein harmonisches Bild ergeben sollte.
So mussten sich die verschiedenen Hersteller der
Lokomotive
und der Wagen während dem Bau verständigen, denn noch war ja das Profil
der Wagen nicht restlos geklärt worden. Es war aber sicher grösser, da
Doppelstockwagen
entstehen sollten. Jedoch galten die bei den Wagen verfügten
Beschränkungen bei der Lokomotive nicht.
Mit anderen Worten, auch wenn die
Lokomotive
eine grosse Höhe haben sollte und letztlich auch gut zu den
Doppelstockwagen
passte, sie wurde so gebaut, dass das normale
Lichtraumprofil
der Schweiz eingehalten werden konnte. Mit dem
Triebkopf
konnte auf dem ganzen Streckennetz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
gefahren werden. Ein Punkt, der bei Fahrten in den schweren Unterhalt ein
grosser Vorteil sein konnte.
Somit war klar, dass die
S-Bahnen
in Zürich im Ge-gensatz zu allen anderen solchen Systemen auch Fracht
mitführen sollten. Es war daher deutlich zu erkennen, dass sich das System
in der Schweiz nicht mit den anderen S-Bahnen vergleichen liess. Uns stellt sich damit unweigerlich die Frage, ob eigentlich von einer Lokomotive gesprochen wer-den durfte. Triebfahrzeuge die Gepäck mitführten wurden bis anhin als Triebwagen bezeichnet.
Beispiel dafür waren die Modelle
De
4/4, die überall verkehrten. Jedoch nahm dort das
Gepäckabteil
den grössten Teil des Platzes ein und das war hier nicht der Fall. Daher
sollte der neue
Triebkopf
als
Lokomotive
geführt werden. Ob nun alles so seine Richtigkeit hat, kann vermut-lich über eine lange Zeit diskutiert werden. Diese Diskussionen wurden von den Fachleuten und von denen, die meinten es zu sein auch geführt und daher müssen wir sie nicht erneut führen.
Beim neuen
Triebfahrzeug
für die
S-Bahn
in Zürich wurde von einer
Lokomotive
gesprochen und das wollen wir nun auch so halten, denn die weiteren
Merkmale des Fahrzeuges passten dazu.
So genau wie in anderen
Pflichtenheften
wurde hier jedoch nicht auf alle Details eingegangen. Es wurden Angaben
für die
Leistung
und die
Zugkräfte
gemacht. So sollte eine Leistung von rund 3 000 kW installiert werden und
die maximal mögliche Zugkraft lag bei 240 kN. Damit lag das Modell unter
der Baureihe
Re 4/4
II, was aber wegen dem hier verbauten
Gepäckabteil
erfolgte. Zudem mussten ja nur drei Wagen befördert werden.
Der Grund waren nicht erwartete Einsätze im Gebirge, sondern die
steilen
Rampen
im Bereich der neuen Strecke in Zürich. Dort traten durchaus Neigungen
auf, die den Gotthard als Flach-bahn erschienen liessen. Gerade bei der Achslast waren die Schweizerischen Bundesbahnen SBB genau. Diese durfte einen Wert von 20 Tonnen auch mit der vollen Zuladung im Gepäckabteil nicht überschreiten. Die sonst hier vorhandenen Toleranzen nach oben gab es jedoch nicht mehr.
Mit anderen Worten, es wurde durchaus ein tiefer Wert erwartet. So
wurde die
Zulassung
zur
Streckenklasse
C2 erwartet, die mittlerweile auch bei dem meisten
Nebenstrecken
angewendet wurde. Wie wichtig hier die gemachten Angaben waren, zeigt sich bei anderen Baureihen. Die dort oft vorhandenen Toleranzen wurden immer wieder stark ausgereizt. Obwohl die Reihe Re 4/4 II offiziell mit 80 Tonnen angegeben wurde, wusste jeder, dass sie nach dem Besuch der Waage etwas Gewicht zugelegt hatte.
Bei der neuen Maschine wurde klar erwartet, dass dies nicht
passieren sollte. Dank der geringeren
Leistung
keine unmögliche Sache.
Bei der Ansteuerung der
Fahrmotoren
war man aber relativ offen. Zwar wurde eine klassische Lösung
ausgeschlossen, aber das war es auch schon. Von einer Lösung mit
klassischen
Strom-richtern,
wie bei der Baureihe Re 4/4 IV, bis zu modernen Ideen mit
Umrichtern
war alles möglich. Es muss hier klar gesagt werden, dass die Ausschreibung
in einer Zeit erfolgte, wo die neusten Lösungen mit Umrichter erste
Schritte wagten.
Wobei andere Punkte im
Pflichtenheft
klar die Richtung vorgaben. So wurden hier massive Einsparungen beim
benötigten Personal und beim Unterhalt gefordert. Mit anderen Worten, bis
zu den regelmässigen
Revisionen
sollten keine Komponenten ausgetauscht werden. Gerade die alten Motoren
mit
Kollektoren
konnten hier nicht mithalten. Diese waren aber auch bei den
Wellenstrommotoren
vorhanden, so dass diese kaum erwartet wurden.
Ein
Pendelzug
lässt sich nicht so einfach abstellen, wie eine
Lokomotive
und zudem waren die Kosten der Beschaffung hoch und das wollte der
Betreiber während der Einsatzzeit wieder ausgleichen können.
Bahngesellschaften
zahlten längst nicht mehr jeden Preis. Um die Verzögerungen bei der Ausarbeitung des Pflichten-heftes aufholen zu können, wurde erwähnt, dass eine kurze Inbetriebsetzung der neuen Maschine erwartet wurde. Die neue Lokomotive sollte daher ab Werk funktionieren.
Lange Fahrten zur Bestimmung der Kräfte im
Gleis
wollte niemand durchführen. Hier zeigte sich, dass man beim Be-steller
durchaus auf ein bestimmtes Modell geachtet hatte und das war die neue KTU
Re 4/4 der BT. Auch wenn wir nicht jeden Punkt im Pflichtenheft ange-sehen haben, können Sie ohne Probleme annehmen, dass diese nahezu vollständig auf die KTU Re 4/4 bezogen wurden.
Diese
Lokomotive,
die sowohl bei der Bodensee-Tog-genburg-Bahn BT, als auch bei der SZU
eingesetzt wurde, passte ideal für die neue Maschine. Die von den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Raum Zürich für die
S-Bahn
gewünschten Modelle waren keine Neuentwicklung.
So gut die Re 4/4 der
Privatbahnen
passte, sie hatte ein Problem. Für den
Triebzug
der
S-Bahn
war sie schlicht zu schwer. Wir erinnern uns, dass hier ein
Gepäckabteil
eingebauten werden sollte, das bis zu vier Tonnen aufnehmen konnte. Mit
diesem zusätzlichen Gewicht wäre das Muster zu schwer geworden. Für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB musste das Muster daher abspecken. Genau
genommen ging es um vier Tonnen.
Als direkte Folge der bereits vorhandenen Bau-reihen wurde daher
die Bezeichnung Re 4/4 V genommen. Für die Nummern wählte man 10 500 und
folgende. Einen allfälligen Konflikt mit der Baureihe
Ae 3/6 I sollte nicht
entstehen.
Auch wenn wir am Schluss dieses Kapitels wissen, dass dieser
erwähnte Konflikt durchaus entstanden wäre, gab es ihn nicht. Der Grund
war, dass bis zu diesem Zeitpunkt von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
die älteren Modelle der
Ausrangierung
zugeführt wurden. Es entstanden die notwendigen freien Plätze. Nur die
historischen
Lokomotiven
konnten ein Problem verursachen. Die Wahl war daher nicht optimal.
Bei der Wahl der Hersteller gab es keine grosse Wahl. Der Auftrag
für die neue
Lokomotive
erging daher an die Asea Brown Boveri und Co ABB in Oerlikon als
Elektriker und an die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in
Winterthur als Mechaniker. Diese waren die einzigen in der Schweiz noch
verbliebenen Erbauer und auch die
S-Bahn
sollte eine sehr grosse Wertschöpfung in der Schweiz haben.
Einer davon war der letztlich vereinbarte Preis. Dieser war mit
4 702 000 Schweizer Franken für eine
Lokomotive
recht hoch. Schliesslich handelte es sich nicht um eine Maschine mit hoher
Leistung. Im Jahre 1986 wurde dann eine erste Serie von 24 Exemplaren bestellt. Diese wurden als Re 4/4 V geführt und sollten mit den Nummern 10 500 bis 10 523 versehen werden.
Doch wie so oft sollte es anders kommen, als es geplant war, denn
in jener Zeit wurde bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch nach
einem neuen Nummernschema gesucht, das besser durch die neuen EDV-Systeme
verarbeitet werden konnte.
So wurde während dem Bau das System für die Bezeichnungen
eingeführt. Die bisher als Re 4/4 V geführte Baureihe sollte zu einer der
ersten werden, die mit diesem Schema ausgeliefert werden sollte. Neu wurde
daher von der Baureihe Re 450 und von den Nummern 450 000 bis 450 023
gesprochen. Wie knapp der Entscheid war, zeigt die Tatsache, dass die
Nummer 10 500 von der SLM an die ABB geliefert und erst dort neu
bezeichnet wurde.
1988 wurde die Serie erweitert. Mit den Nummern 450 024 bis
450 049 wurden weitere 26
Lokomotiven
in Auftrag gegeben. Die Reihe Re 450 mutierte damit zur grössten Serie von
Lokomotiven mit
Umrichtern
in der Schweiz. Die neue Technik sollte damit den Siegeszug beginnen, der
bis in die heutigen Tage anhalten sollte. Die einfachen und im Unterhalt
sehr sparsamen
Fahrmotoren
waren dabei der wichtige Punkt.
Jedoch gab es nun erste Probleme mit den Zeiten für die
Lie-ferung. Da nun auch der Bau der ersten Modelle für die Reihe Re 460
begonnen hatte, reichten die
Kapazitäten
bei der Schwei-zerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM nicht aus.
Um die SLM zu entlasten wurden daher die mechanischen Bau-gruppen
ab dem Jahr 1991 teilweise bei Schindler Waggon in Pratteln SWP gebaut.
Ein klassischer
Wagenbauer
übernahm die Aufgabe eine
Lokomotive
zu bauen. So schwer war das ja nicht, da man mit den Plänen der SLM
arbeiten konnte. Jedoch wurden nun Re 450 von zwei Seiten nach Oerlikon
und somit ins dortige Werk der ABB überführt. So konnte die Lieferzeit
eingehalten werden.
Wir haben damit 95 Maschinen der Baureihe Re 450, die mit den
passenden Wagen zu
Pendelzügen
formiert wurden. Jedoch reichte die Anzahl mit der weiteren Erweiterung
der
S-Bahn
in Zürich nicht mehr aus. Es mussten daher im Jahre 1994 weitere 20
Einheiten bestellt werden. Nun wurde aber nicht nur die
Lokomotive
sondern der komplette
Triebzug
in Auftrag gegeben. Es war eine Vereinfachung für den Besteller.
In diesen vier Serien wurden insgesamt 115 Exemplare der Baureihe
Re 450 in Betrieb genommen. Die
Lokomotiven
bildeten das Rückgrat der
S-Bahn
in Zürich, konnten sich aber bei den anderen S-Bahnen der Schweiz nicht
mehr durchsetzen. So kam es zu keiner weiteren Bestellung mehr. Der Grund
war auch, dass nun die
Triebzüge
auch doppelstöckig gebaut werden konnten. Wir hier wollen jedoch die
Lokomotive Re 450 genauer ansehen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Verantwortlich
für die Beschaffung der neuen Fahr-zeuge waren die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB. Diese traten gegenüber den Herstellern als Besteller
auf.
Verantwortlich
für die Beschaffung der neuen Fahr-zeuge waren die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB. Diese traten gegenüber den Herstellern als Besteller
auf. Auch
wenn grundsätzlich eine einheitliche Formation erwartete wurde. Die
Aufträge für die
Auch
wenn grundsätzlich eine einheitliche Formation erwartete wurde. Die
Aufträge für die
 Es
stellt sich die Frage, warum bei der ersten
Es
stellt sich die Frage, warum bei der ersten
 In
der
In
der
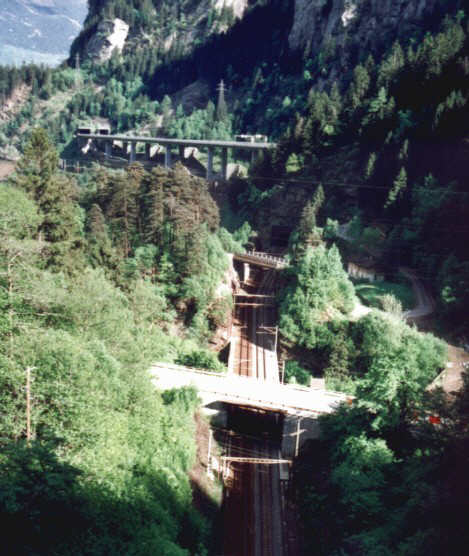 Auch
wenn wir es kaum erwarten würden, für die neue
Auch
wenn wir es kaum erwarten würden, für die neue
 Gerade
der Unterhalt war bei diesem Fahrzeug ein sehr wichtiger Punkt. Das für
die
Gerade
der Unterhalt war bei diesem Fahrzeug ein sehr wichtiger Punkt. Das für
die
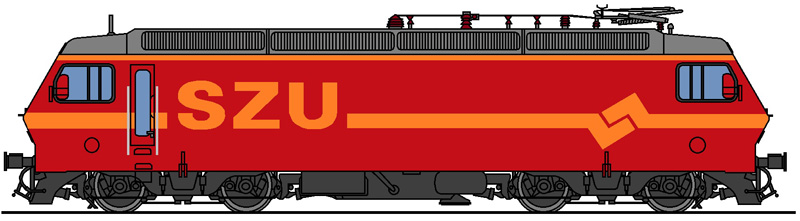 Wie
in allen anderen
Wie
in allen anderen
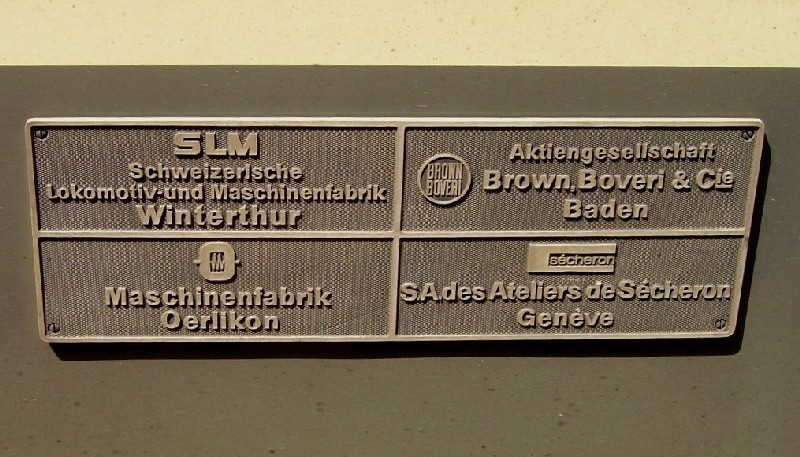 ABB
sollte sich als Elektriker auch um die Aus-lieferung der Maschinen
bemühen. Daher war die Firma in diesem Konsortium der direkte
Ansprech-partner für den Besteller und dabei gab es durchaus Grund zu
Diskussionen.
ABB
sollte sich als Elektriker auch um die Aus-lieferung der Maschinen
bemühen. Daher war die Firma in diesem Konsortium der direkte
Ansprech-partner für den Besteller und dabei gab es durchaus Grund zu
Diskussionen.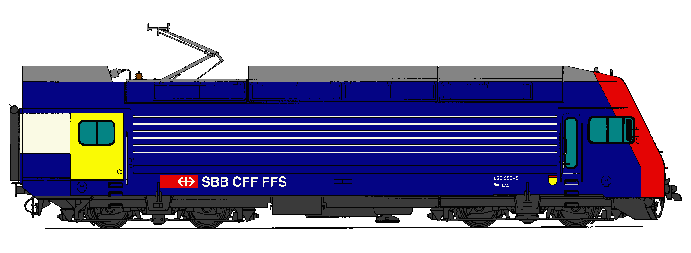 Erneut
zwei Jahre später, also 1990 wurden weitere
Erneut
zwei Jahre später, also 1990 wurden weitere