|
Einleitung |
|||||||||||
|
|
Navigation durch das Thema | ||||||||||
|
Baujahr: |
1989 – 1997 | Leistung: |
3 200 kW / 4 350 PS |
||||||||
|
Gewicht: |
74 t |
V. max.: |
130 km/h |
||||||||
|
Normallast: |
500 t |
Länge: |
18 400 mm | ||||||||
|
Der Ballungsraum Zürich bildete bereits zu
Beginn der Eisenbahnen grosse Vorteile. So hatten sich hier die ersten
Banken angesiedelt. Das führte dazu, dass hier die erste Eisenbahn der
Schweiz entstand. Wobei genau genommen damals noch der mit dem Salz zu
Reichtum gelangte Kanton Aargau helfen musste. So gesehen war es kein
Zufall, dass die Geschichte der Eisenbahnen in der Schweiz hier den Anfang
finden sollte.
Der Platz in der beengten Stadt Zürich reichte nicht aus. Immer mehr Gemeinden in der Nähe der eigentlichen Stadt wurden von dieser eingenommen und endeten als Quartiere. Heute kennen wir die ehemaligen Gemeinden Enge und Höngg nur noch als Quartiere der Stadt.
Die Liste mit den so verschwundenen
Gemeinden könnte endlos verlängert werden. Jedoch stellte sich diese
Lösung bei grös-seren Gemeinden als Problem heraus.
Grössere Gemeinden konnten sich erfolgreich
der Stadt widersetzen. Damit musste das eigentliche Wachstum von Zürich
gebremst werden. Trotzdem zogen immer mehr Leute in diese Region. Der
Grund war, dass die Banken gute Löhne bezahlten konnten und so die
Arbeiter nach Zürich lockten. Doch der Platz dazu reichte nicht mehr aus.
Die Stadt wurde neu mit einer Agglomeration ergänzt und konnte so mit den
Gemeinden wachsen.
Eine Lösung, die der Stadt Zürich ein nahezu
unbegrenztes Wachstum erlaubte. In einigen Jahrzehnten sollte der Einfluss
der Stadt sogar bis in die benachbarten Kantone Aargau, Schwyz und Zug
reichen. Doch im Jahr 1960 war davon noch nichts zu spüren. Die Leute
siedelten sich in den Gemeinden um die Stadt an und reisten dann zu
Arbeit. Die ersten Pendler entstanden und damit auch der benötige Verkehr
um die Stadt.
So konnten diese genutzt werden. Das einzige
Problem der
Bahnlinien
war jedoch, dass Zürich HB ein
Kopfbahnhof
war und so alle Züge die Fahr-richtung wechseln mussten. Es fehlte der
Durch-gangsbahnhof. Solche Zentren haben aber allgemein immer ein grosses Problem. Durch die Ballung stiegen die Preise für Mieten und Wohneigentum. Normale Arbeiter konnten sich im Zentrum kaum eine Wohnung leisten. In der Folge mussten sie in die Aussenquartiere ziehen.
Später kamen auch Gemeinden in der
Agglo-meration dazu. Eine rein logische Abfolge des gros-sen Wachstums in
jenen Jahren, welches nicht mehr aufzuhalten war und das für Probleme
sorgte. Die in den Aussenquartieren lebenden Leute musste in das Zentrum fahren, wo die Arbeit vorhanden war. In der Folge suchten sie nach Möglichkeiten um den Weg zu schaffen.
Von der Stadt bereits gestellt wurde dabei
der öffentliche Verkehr. Dieser bestand aus einem dichten Netz von
Strassenbahnen,
das an gewissen Stellen mit neuen Bussen ergänzt wurde. Doch damit war das
Problem mit dem Verkehr längst nicht gelöst worden.
Viele fuhren mit einem Auto in das Zentrum. Damals
standen die Parkmöglichkeiten noch zur Verfügung und daher wurde der
eigene Wagen genutzt. Durch die starren Arbeitszeiten kam es auf den
Strassen in die Stadt immer öfters zu Stau. Diese sorgten dafür, dass auch
Tram und Bus stecken blieben. Es gab zeitweise kaum mehr ein Durchkommen.
Der Stadt droht bereits 1960 der Kollaps beim Verkehr und ein Dauerstau.
In diesen gab
es neben den
Tram und Bussen auch andere Verkehrswege, wie U- oder
S-Bahn.
Diese zeichneten sich durch den Vorteil aus, dass sie sich die Strasse
nicht teilen mussten. Die Idee der Planer sah einen neuen Tiefbahnhof im Be-reich des Hauptbahnhofes vor. So konnten die Trams im Untergrund vom Verkehr unabhängig verkehren. Ein Pro-jekt, dass im Jahre 1962 dem Stimmvolk unterbreitet werden sollte.
Der Tiefbahnhof als Vorprojekt einer
weiteren Lösung für die Verkehrsprobleme der Stadt wurde jedoch vom
Stimm-volk bei der Abstimmung beerdigt. Zu unausgereift war die Idee für
viele Bürger.
Gerade der fehlende Nutzen für die Gemeinden in der
Ag-glomeration bewirkte, dass
deren Bürger gegen das Pro-jekt waren. Selbst Fachleute waren sich nicht
sicher, ob dieses Lösung ein Erfolg geworden wäre. Das Nein an der Urne
zwang die Planer wieder an den Tisch und nach der Suche nach einer neuen
Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Selbst die neue Autobahn in die
Stadt sollte diesen nicht bewältigen können.
Nicht vom Tisch war damit das Problem mit dem
Verkehr. Die Planer der Stadt mussten einen Schritt weiter gehen. Dazu
wurde wieder über die Grenze geschaut und dort erkannte man, dass sich die
U-Bahnen durchsetzen konnten. In Städten wie New York ersetzten sie
schlicht die
Trams. Ergänzt mit einer
S-Bahn nach dem Muster in vielen
Städten in Deutschland sollte eine nachhaltige Lösung für das Problem
gefunden werden.
Die Baureihe
RABDe 12/12 sollte den Verkehr
über-nehmen. Die Züge kamen in den Betrieb, die
S-Bahn in Zürich jedoch
nicht. Die 1973 durchgeführte Ab-stimmung brachte erneut ein deutliches
Nein des Stimmvolkes.
Auch das zweite Nein war längst keine Lösung für die
Probleme. Um die grossen Mengen Leute zu befördern, boten sich eigentlich
nur die Bahnen an. Diese verfügten über hohe
Kapazitäten und verkehrten
auf einem eigenen Streckennetz. Daher reifte die Idee, dass die Zukunft
für das Problem mit dem Verkehr nicht unter der Erde zu finden war. Aus
dem Projekt von 1973 wurde daher die
U-Bahn gestrichen und die
S-Bahn
erneut vor das Volk gebracht.
Das neue Konzept sah eine reine
S-Bahn vor. Diese
sollte im Zentrum mit neuen Strecken arbeiten, aber ausserhalb davon auf
dem konventionellen Netz verkehren. Somit war die Idee der S-Bahn Zürich
nicht mit anderen Städten zu vergleichen, denn dort verkehrten diese auf
dem eigenen Streckennetz. Diese Idee schien beim Volk aber keine Chance zu
haben. Daher nun der dritte Versuch mit einer angepassten S-Bahn.
Bei der Abstimmung vom 29. November 1981 konnte man
gespannt sein. Es war der dritte Versuch um ein Problem zu lösen. Die
Frage war, konnte man die Leute auf dem Land davon überzeugen, der grossen
Stadt eine
S-Bahn zu geben. Jedoch hatte sich dort seit 1973 viel
geändert, denn immer mehr Leute wohnten dort, mussten aber in die Stadt um
dort der Arbeit nachzugehen. Daher war das Ergebnis alles andere als klar.
Niemand konnte damals ahnen, wie gross der
Erfolg dieser
S-Bahn werden würde. Ja selbst das Wort, war vielen Leuten
damals noch unklar. Eine S-Bahn war doch nur ein ganz normaler
Regionalzug. Grundsätzlich stimmt das, aber die Idee von S-Bahnen besteht darin, dass diese das Zentrum nicht als Start-punk nehmen. Vielmehr beginnen die Züge in der Um-gebung und führen durch die Stadt wieder in eine andere Gegend.
In Zürich ging das aktuell wegen dem
Bahnhof schlicht
nicht. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas genauer auf die
S-Bahn der
Stadt Zürich blicken, denn sie sollte wirklich eine einmalige Sache
werden. Kernstück der S-Bahn die damals 653 Millionen Schweizer Franken kosten sollte, war eine Neubau-strecke. Diese sollte im Bereich des Güterbahnhofes beginnen und von dort unterirdisch den Hauptbahnhof passieren.
Da der neue Teil auf der Seite des Landesmuseums
entstehen sollte, wurde vom
Bahnhof Museumsstrasse gesprochen. Zürich HB
sollte damit aber zu einem
Durchgangsbahnhof werden, der mehr
Geleise mit
Prellbock hatte.
Anschliessend sollte die neue Strecke in einem neuen
Tunnel nach Stadelhofen verkehren. Damit würde die bisherige Strecke über
Letten nicht mehr benötigt und daher der Verkehr darauf eingestellt. Der
Bahnhof Letten sollte anders berühmt werden. Wegen dem Gelände, das
unterfahren werden sollte, gab es hier
starke Gefälle, die in ebenso
starke Steigungen übergehen sollten. Es sollte eine der dichtest
befahrenen Strecken werden.
Hauptproblem dabei war, dass hier eine dichte Be-bauung vorhanden
war und daher konnte nur mit
Tunnel und
Brücken gearbeitet werden. Das
trieb die Kosten für dieses Projekt in die Höhe, denn Tunnel waren teuer. Ausserhalb dieser Bereiche sollte das Netz nur aus-gebaut werden. Namentlich wurde dabei immer wieder der vierspurige Ausbau im Limmattal bis Killwangen-Spreitenbach erwähnt. Ein Ausbau der wichtig war, denn gerade in diesem Bereich hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB das grösste Problem mit der Kapazität.
Zwar konnte der
neue
Rangierbahnhof Limmattal
im Raum Dietikon das Problem entschärfen,
aber nicht lösen. Am 02. März 1982 wurde zwischen den Schweiz-erischen Bundesbahnen SBB und der Stadt ein Ver-trag abgeschlossen. Die Staatsbahnen sollten sich für den Bau und den Betrieb verantwortlich zeigen.
Dazu wurde
zudem der Zürcher Verkehrsverbund ZVV ins Leben gerufen. Dieser war
wichtig, damit auch andere Bahnen und Busse in das System mit den
S-Bahnen
eingebunden werden konnten. Der
Nahverkehr im Raum Zürich war in der Hand
des ZVV.
Es war klar, dass es mit neuen Strecken nicht getan
war. Die
S-Bahn in Zürich benötigte auch die passenden Fahrzeuge. Dabei
waren die
Triebzüge der Baureihe
RABDe 12/12 seinerzeit gebaut worden.
Durch die politisch bedingten Verzögerungen passten diese nicht mehr. So
waren sie technisch veraltet und die
Kapazität reichte dem erwarteten
Verkehrsaufkommen schlicht nicht mehr aus. Zürich benötigte neue
Fahrzeuge.
Die Planer von damals hatten
durchaus auch die Zu-kunft im Auge und diese sah klar eine Steigerung des
Verkehrs vor. Der
Hauptbahnhof in Zürich sollte zu einem der meist
bereisten der Welt werden. Lediglich Tokio musste sich nicht davor
fürchten.
Da jetzt aber nicht mehr die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB selber entscheiden konnten, wurde eine Projektgruppe
gebildet. Diese hatte durchaus Ideen, die nicht umgesetzt werden konnten.
Jedoch sah man schnell, dass das Problem mit der
Kapazität nur gelöst
werden konnte, wenn die Leute zwei Decks zur Verfügung hatten. Die Wahl
von
Doppelstockwagen passte den
Staatsbahnen nicht, da sie nicht freizügig
verkehren konnten.
Selbst mit endlosen Diskussionen über die Höhe der
Bahnsteige konnte man sich bei der Projektgruppe aufhalten. Komplett
eigene Lösungen für die
S-Bahn kamen bei den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB nicht gut an, da auch konventionelle Züge in den Randbereichen
eingesetzt würden. So lange hier aber keine Einigung erzielt würde,
konnten die neuen Fahrzeuge für die
S-Bahn in Zürich noch nicht beschafft
werden.
Wie so oft konnten die Probleme mit den Höhen der
Bahnsteige mit einem Kompromiss gelöst werden. Die hohen Lösungen des ZVV
waren ebenso vom Tisch, wie die Idee alles beim alten zu belassen. Die
Bahnsteige der
S-Bahn Zürich sollten daher auf eine Höhe von 550 mm über
der Oberkante der
Schienen festgelegt werden. Ein Wert, der heute als
Standard in vielen Ländern in Europa und der Schweiz angesehen wird.
|
|||||||||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Durch
die sich hier angesiedelten Banken wurde die Stadt nach dem zweiten
Weltkrieg zu einem Finanzzentrum. Wegen dem wirtschaftlichen Zentrum Basel
und der politischen Macht in Bern, startet die Stadt mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung nicht so durch, wie das in Städten wie
Frankfurt, oder Milano der Fall war. Die Schweiz schien eher bescheiden zu
bleiben. Trotz-dem wurde Zürich zu dem was es sein wollte.
Durch
die sich hier angesiedelten Banken wurde die Stadt nach dem zweiten
Weltkrieg zu einem Finanzzentrum. Wegen dem wirtschaftlichen Zentrum Basel
und der politischen Macht in Bern, startet die Stadt mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung nicht so durch, wie das in Städten wie
Frankfurt, oder Milano der Fall war. Die Schweiz schien eher bescheiden zu
bleiben. Trotz-dem wurde Zürich zu dem was es sein wollte. Gerade
für die grösseren Strecken boten sich die Bahnen an. Ein wichtiger Teil
wurde dabei von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB übernommen, denn
deren Strecken hatten zum Teil auch Halte innerhalb der Stadtgrenze.
Gerade
für die grösseren Strecken boten sich die Bahnen an. Ein wichtiger Teil
wurde dabei von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB übernommen, denn
deren Strecken hatten zum Teil auch Halte innerhalb der Stadtgrenze. In der Stadtverwaltung suchte man zweifelhaft nach
einer brauchbaren Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Da es
vergleichbare Probleme in der Schweiz sonst nicht gab, mussten die
Verkehrsplaner sich an den Metropolen der Welt orientieren.
In der Stadtverwaltung suchte man zweifelhaft nach
einer brauchbaren Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Da es
vergleichbare Probleme in der Schweiz sonst nicht gab, mussten die
Verkehrsplaner sich an den Metropolen der Welt orientieren.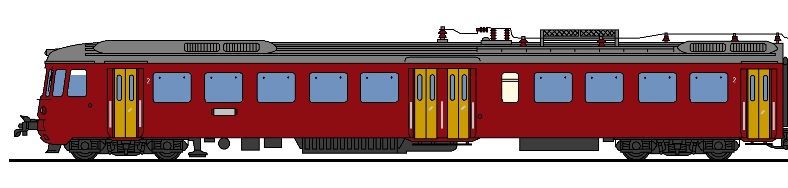 Die Idee war so ausgereift, dass man erneut mit
einer kombinierten U- und
Die Idee war so ausgereift, dass man erneut mit
einer kombinierten U- und
 Als alle Stimmen ausgezählt waren, war klar, dass es
im dritten Anlauf geklappt hatte. Zürich sollte daher als erste Stadt der
Schweiz eine
Als alle Stimmen ausgezählt waren, war klar, dass es
im dritten Anlauf geklappt hatte. Zürich sollte daher als erste Stadt der
Schweiz eine
 Weiter sollte ein
Weiter sollte ein
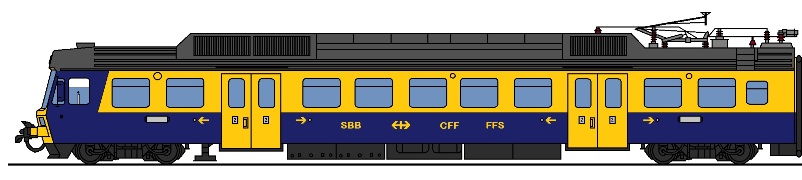 Die gewünschte Länge hatten die Züge der Bau-reihe
RABDe 8/16. Jedoch konnten diese vier
Die gewünschte Länge hatten die Züge der Bau-reihe
RABDe 8/16. Jedoch konnten diese vier