|
Laufwerk und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der
Kasten stützte sich auf zwei
Drehgestelle
ab. Diese beiden Drehgestelle
waren identisch aufgebaut worden und wurden unter dem Kasten montiert.
Daher wurde auch diese
Lokomotive
nach dem beliebten Baumuster mit zwei
zweiachsigen Drehgestellen gebaut. Die Forderung, dass die Lokomotive auch
erhöhte Geschwindigkeiten in den
Kurven einhalten sollte, führte zu sehr
gut durchdachten Drehgestellen.
So
wurden in den Längswangen auf unnötige Knicke verzichtet. Am Aufbau als
geschlossenes H änderte man jedoch nichts. So gesehen hatte die
Loko-motive
ein normales
Drehgestell
erhalten. Der Baustoff für die Drehgestelle war Stahl. Dieser Werkstoff konnte gut geschweisst werden und ver-fügte über eine grosse Festigkeit. Gerade im Be-reich der Laufwerke waren kräftige stabile Rahmen zwingend erforderlich.
Hier war das besonders wichtig, denn die
Lokomo-tive sollte schneller um
Kurven fahren und hohe Geschwindigkeiten bis 230 km/h ausfahren können.
Das in sich stellte eigentlich schon einen Widerspruch dar.
Wenn
wir noch einen schonenden Kurvenlauf erwarten, haben wir alle
Eigenschaften eines
Drehgestells
aufgezählt. Man kann daher behaupten,
dass die Lokomotive 2000 ihre grosse Sensation unter der
Lokomotive und
somit in den Drehgestellen hatte. Mit dem
Drehgestellrahmen
alleine war
das jedoch nicht gemacht. Besonders die Achsen hatten einen sehr grossen
Einfluss auf die Kräfte in den
Geleisen.
Die von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB geforderten Eigenschaften,
wie gleisschonender Kurvenlauf, hohe
Zugkräfte
und eine hohe
Geschwindigkeit mussten mit einer möglichst optimalen Ausführung bei den
Radsätzen und deren
Lagerung umgesetzt werden. Das sollte letztlich dazu
führen, dass die Lok 2000 über sehr gleisschonende
Drehgestelle
verfügte.
Ein Punkt, der kaum mehr erreicht werden sollte.
Damit diese bei der Lokomotive möglichst gering ge-halten werden konnte, wurden die Achsen mit Mono-blocrädern versehen. Diese waren leichter als ver-gleichbare bandagierte Räder.
Sie waren erst noch billiger bei der Anschaffung.
Nur das alleine war nicht ausreichend, so dass man noch einen Schritt
weiter ging. Man reduzierte den Durchmesser der Räder ebenfalls. Hatten sich in den letzten Jahren bei Lokomotiven Durchmesser von 1 250 mm international durchgesetzt, wurden bei der Lokomotive 2000 die Durchmesser auf lediglich 1 100 mm verringert.
Damit hatte die
Lokomotive kleine
Räder, aber auch
sehr leichte
Radsätze erhalten, was für die hohen Ge-schwindigkeiten von
bis zu 230 km/h ideal war. Gelagert wurden diese Achsen in aussen liegenden Rollenlagern. Diese Lager hatten sich seit Jahren be-währt und sie zeigten, dass sie auch bei hohen Ge-schwindigkeiten gut funktionierten und es kaum zu Schäden an diesen Lagern kam.
Daher wurde bei den
Achslagern kein Experiment mit exotischen
Lagereinheiten eingegangen. Die
Lagerung war daher, wie bei allen anderen
Fahrzeugen ausge-führt worden. Bei der Abfederung des Radsatzes gab es jedoch eine Änderung. Man versuchte auch im Drehgestell wo es ging Gewicht zu sparen.
Sparen konnte man, indem
man gewisse Teile wegliess. Dazu gehörte eine
Feder bei den
Achslagern.
Die
Achse wurde daher nur noch mit einer über dem Achslager eingebauten
Schraubenfeder abgefedert. Das reduzierte zwar den verfügbaren Platz, half
jedoch Gewicht zu sparen.
Ein
seitlicher
Dämpfer
bei jeder Achsfeder verhinderte, dass sich die
Achse
wegen der kurzen Schwingungsdauer der verwendeten
Schraubenfedern
aufschaukeln konnte. Die bisher
bei
Lokomotiven immer wieder verwendeten mechanischen Dämpfer
reichten für die hohen Geschwindigkeiten der Lok 2000 nicht aus, so dass
man die
Federn mit einem parallel dazu eingebauten hydraulischen Dämpfer
versehen hatte.
Mit
dem
Radsatz hatte man die ungefederte Masse reduziert. Um einen
gleisschonenden Lauf zu erhalten, wurde die
Lokomotive mit passiv
gesteuerten Radsätzen ausgeführt. Diese bewirkte, dass sich die Radsätze
in der
Kurve innen näherten und aussen entfernten. Damit stand das
Rad im
Idealfall in einem rechten Winkel zum
Gleis. Die
Spurkränze berührten
daher die Flanke der
Schiene kaum mehr.
Die
radiale Einstellung der
Radsätze funktionierte einfach, da die Abweichung
des Winkels vom Kasten zum
Drehgestell dazu genutzt wurde, die inneren
Räder näher zueinander zu schieben. Im Gegenzug wurden die beiden äusseren
Räder nach aussen verschoben. Diese Einrichtung funktionierte dank der
Steuerung durch den Kasten unabhängig der
Zugkraft
und Geschwindigkeit.
Der angegebene Radstand von 2 800 mm galt daher nur im geraden
Gleis.
Letztlich wurden auch die
Drehgestelle selber miteinander verbunden. Mit
Hilfe der schon seit Jahren verwendeten
Querkupplung wurden die Kräfte
beim Kurvenlauf zusätzlich reduziert. Erreichte die
Lokomotive
Re 4/4 II
seinerzeit damit die
Zulassung zur
Zugreihe R, half die Querkupplung der
Lok 2000 zu einem sehr gleisschonenden
Laufwerk. Die Lokomotive verfügte
daher über hervorragende Laufeigenschaften bei allen Bereichen des
Einsatzrayons.
Jedoch sollte dazu bei der
Lokomotive keine
Neige-technik eingebaut werden.
So musste verhindert werden, dass der Kasten bei diesen Geschwindig-keiten
zu sehr ins Wanken geraten könnte. Der Kasten stützte sich deshalb über hoch ange-ordnete Schraubenfedern auf dem Drehgestell ab. Es wurden dabei pro Drehgestell vier Flexicoilfedern eingebaut, die in zwei seitlichen Paketen verbaut wurden.
Dabei waren die
Pakete, die aus je zwei
Federn bestanden, nicht in Längs- sondern in
Querrichtung angeordnet worden. Zusätzliche hydraulische
Dämpfer
verhinderten zudem, dass sich der Kasten aufschaukeln konnte. Diese hohe Anordnung der Federung verhinderte wirksam zu grosse Wankneigungen des Kastens. So dass die Lokomotive 2000 technisch in der Lage war, die Kurvengeschwindigkeiten der Neigezüge zu fahren.
Eine aktive
Neigeeinrichtung, wie sie bei
Neigezügen verwendet wurde, baute man jedoch
nicht ein. Der Lokführer wurde daher ohne entsprechende Mass-nahmen den
höheren Fliehkräften ausgesetzt.
Mit
diesem
Laufwerk war die
Lokomotive sehr gleis-schonend und konnte die
erhöhten Geschwindig-keiten in den
Kurven auch mit den hohen Achslasten
problemlos ausfahren. Der Grund, warum die Lokomotive 2000 nie nach der
Zugreihe N verkehren konnte, lag nicht bei der Maschine, sondern bei der
Tatsache, dass die entsprechenden Wagen im Bestand der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB schlicht fehlten.
Wenn
wir zum
Antrieb kommen, dann erwartet uns gleich die erste Überraschung.
Der
Fahrmotor, der voll abgefedert war, konnte sich zusammen mit dem
zugehörigen
Radsatz ebenfalls durch den Kasten gesteuert anpassen. Damit
gab es im Antrieb keine Änderungen des Winkels. Durch die Verringerung der
Baugrösse fand der Fahrmotor zudem vollumfänglich im
Drehgestell Platz.
Daher mussten beim Kasten keine Aussparungen für die Fahrmotoren
vorgenommen werden.
Dank dieser Ausführung war der
Antrieb
leicht auf geänderte
Übersetzungen
und
Getriebe
umzubauen. Wobei diese
Massnahmen nie verwirklicht werden sollten. Bei den Maschinen kamen zwei unterschiedliche Getriebe zur Anwendung. Während einige Lokomotiven ein gerade verzahntes Getriebe besassen, wurde bei anderen Maschinen ein schräg verzahntes Getriebe verwendet.
Das gerade
verzahnte Getriebe hatte jedoch den Nachteil, dass es etwas lauter war. Es
bot jedoch den Vorteil, dass keine seitlichen Kräfte auf die
Lager der
Zahnräder wirkten. Bei beiden Getrieben betrug die
Übersetzung jedoch
1 :
3.6667.
Der
Flexringantrieb entkoppelte letztlich die
Achse vom restlichen
Getriebe.
In ihm wurde das Drehmoment vom
Fahrmotor mit einem Mitnehmer auf die
Achse übertragen. Der Ausgleich der
Federung erfolgt durch beidseitig
angeordnete Gummi-Sandwich-Elemente, die in einem flexiblen Ring gehalten
wurden. Damit war der
Antrieb vollständig von der
Triebachse entkoppelt
und gegenüber von dieser abgefedert.
Die
Bauteile des
Flexringantriebs an den
Achsen beschränkten sich auf die Mitnehmer,
wodurch das ungefederte Gewicht der Achse nur unwesentlich anstieg. Genau
genommen bewegte man sich im Bereich von wenigen Kilogramm. Gegenüber
vergleichbaren
Antrieben konnte die ungefederte Masse bei diesem Antrieb
weiter reduziert werden. Das hatte zur Folge, dass die Lok 2000 die
kleinste ungefederte Masse vergleichbarer
Lokomotiven hatte.
In
den
Rädern wurde das von den
Fahrmotoren übertragene Drehmoment mit Hilfe
der
Haftreibung zwischen Rad und
Schiene in
Zugkraft
umgewandelt. Diese
Kraft wurde dann über die speziellen Achslenker auf den Rahmen des
Drehgestells übertragen und dort mit der Zugkraft der zweiten
Achse
vereinigt. Dank den Achslenkern konnte die Kraft unabhängig der radialen
Einstellung übertragen werden.
Vielmehr wurde die Kraft unter dem
Drehgestellrahmen auf
Zugstangen und
somit auf den Kasten übertragen. Um möglichst optimale Verhältnisse zu
erreichen, wurde der Angriffspunkt der
Tiefzugvorrichtung so tief wie nur möglich angeordnet. Schliesslich wurde die Kraft im Untergurt auf die Zug-vorrichtungen übertragen. Damit hat die Lokomotive eine optimale Übertragung der hohen Zugkräfte er-halten.
Wobei man hier sicherlich von der jahrelangen
Er-fahrung beim Bau von
Lokomotiven profitieren konnte. Gerade die
Tiefzugeinrichtung war keine neue Bau-gruppe innerhalb des
Drehgestells und
baute auf den Erfahrungen der Lokomotive
Re 4/4 II
auf.
Alle
hier beschriebenen Massnahmen führten letztlich dazu, dass die
Lokomotive
über sehr gute Laufeigenschaften verfügte. Die Forderungen des
Pflichtenheftes wurden im Bereich des
Laufwerkes vollständig umgesetzt und
zum Teil von den getroffenen Massnahmen sogar übertroffen. Trotzdem blieb
bei der Lok 2000 ein Wermutstropfen, denn die ganze mechanische Ausrüstung
wurde gegenüber der Forderung um drei Tonnen zu schwer.
Das
Gewicht der
Lokomotive sollte nach der Montage der elektrischen Ausrüstung
auf 84 Tonnen ansteigen. Diese Überschreitung konnte dank den gut
gestalteten
Drehgestellen problemlos toleriert werden. Bei Messfahrten
wurde festgestellt, dass die Re 460 mit 84 Tonnen immer noch kleinere
Kräfte im
Gleis generiert, als die 80 Tonnen schweren
Re 4/4 II. Diese
durchwegs guten Ergebnisse liessen die 84 Tonnen der fertigen Lokomotive
zu.
Die
Reduktion des Gewichtes der
Lokomotive Re 465 auf lediglich 82 Tonnen war
nicht durch die mechanische Konstruktion bedingt. Vielmehr wirkte sich
dort die Entwicklung der Halbleiter aus, so dass die elektrische
Ausrüstung leichter wurde. Mechanisch gab es zur Lokomotive der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB jedoch keinen Unterschied. Sie haben
daher in den Artikeln nichts verpasst.
Um
bei schlechtem Schienenzustand die
Zugkraft
optimal auf die
Schienen zu
übertragen, mussten zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Wie schon die
Dampflokomotiven, wurde auch die Lok 2000 dazu mit elektropneumatischen
Sander ausgerüstet. Diese Einrichtungen streuten den im Rahmen in dort
eingelassen Behältern lagernde Sand, jeweils vor die erste
Triebachse der
Lokomotive.
Diese
Lösung mit den
Sandern war bei den
Lokomotiven der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB üblich und stellte nur bei der Lötschbergbahn eine
Neuerung dar, da dort vor Jahren auf Sander verzichtet wurde. Jedoch
unterliess man es, eine Verbesserung mit Sander auch vor dem nachlaufenden
Drehgestell zu montieren. Ein Punkt, der von den nachfolgenden Lokomotiven
schliesslich wieder genutzt wurde.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wenn
wir mit der Betrachtung der
Wenn
wir mit der Betrachtung der  Den ruhigen Lauf der
Den ruhigen Lauf der 
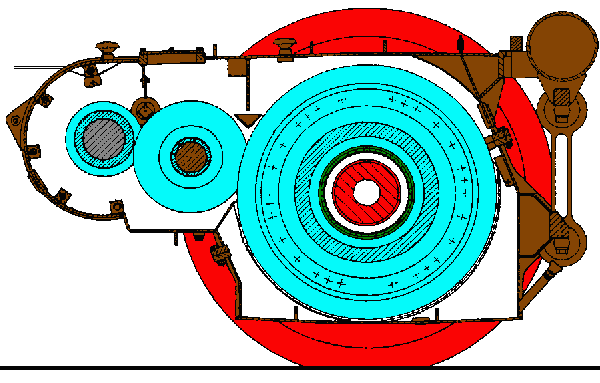 Das im
Das im 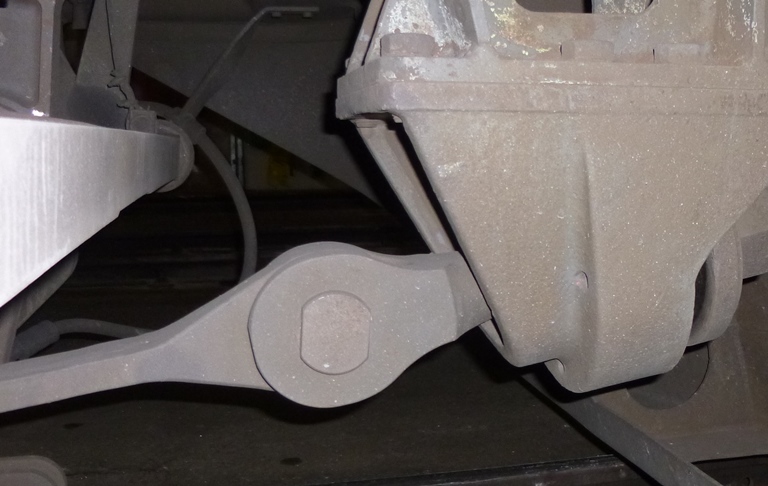 Die
Kraft im
Die
Kraft im