|
Der Kasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beginnen wir auch bei diesen
Lokomotiven mit dem Kasten und somit mit dem Gehäuse. Gerade
bei dieser Lokomotive zeigte sich gut, wie beim Bau von Lokomotiven damals
noch um jedes Gramm gekämpft wurde. Bei der Lok 2000 wurde im
Pflichtenheft
ein Gewicht von 81 Tonnen vorgegeben. Das bedeutete, dass die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB die
Streckenklasse
C3 für die Lokomotive vorgesehen hatten.
Sehr schnell war klar, dass sich beim Gewicht der
Lokomotive
grosse Probleme ergeben würden. Die verlangten
Leistungen
hatten bisher auf vier
Triebachsen
schlicht keinen Platz gefunden. Selbst die Baureihe 120 der DB war mit 84
Tonnen über diesem Limit und dort hatte man nicht diese grosse Leistung
einbauen müssen. Daher war klar, man musste Gewicht sparen, wo es nur
ging. Dabei stand der mechanische Teil im Vordergrund.
Aus diesem Grund wurde nur dort Stahl verwendet, wo das auch
notwendig war und man nicht mit an-deren Materialien arbeiten konnte. An
den anderen Orten und bei den nicht tragenden Bauteilen kam neu auch
Kunststoff zur Anwendung. Der selbsttragende Kasten besass einen massiven Untergurt aus Stahl. Dieser war bei dieser Loko-motive so massiv ausgeführt worden, dass man auch von einer Lokomotivbrücke sprechen konnte. Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird der Un-tergurt, der den Boden des Kastens bildete, immer wieder erwähnt werden.
Grundsätzlich war der Aufbau des Kastens aber nicht die grosse
Attraktion bei der
Lokomotive für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Stabilisiert wurde der Untergurt, der eigentlich nur einen
geschlossenen Ring bildete, durch die Böden des
Maschinenraumes
und durch richtig positionierte Träger. So entstand ein versteifter und
damit stabiler Boden für den späteren Kasten und dessen Einbauten.
Abgeschlossen wurde der Untergurt durch die beiden stirnseitigen
Stossbalken.
Diese waren optisch im Untergurt integriert worden, so dass sie nicht zu
erkennen waren.
Der
Stossbalken
hatte die üblichen Zug- und
Stossvorrichtungen
erhalten. Dabei bestanden die
Zugvorrichtungen
aus dem in der Mitte federnd montierten
Zughaken.
Dieser Zughaken konnte sich dank den angebrachten Führungen seitlich
bewegen. Die Führungen waren nötig, weil hier der Stossbalken zur Aufnahme
einer
automatischen Kupplung vorbereitet wurde. Bei
Lokomotiven
für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB war das schon länger üblich.
Die nicht benötigte
Kupplung
war entwe-der im
Zughaken
aufgehängt oder konnte in einen speziellen Blindhaken abgelegt werden.
Damit hatte diese
Lokomotive, wie in der Schweiz üblich, eine voll-wertige
Kupplung bekommen. Ergänzt wurde diese Zugvorrichtung mit den seitlich angebrachten Puffern, die als Stosselemente dienten. Diese Puffer waren jedoch nicht direkt auf dem Stossbalken montiert worden, sondern wurden über die in einer Nische liegenden Zerstörungsglieder befestigt.
Die
Zerstörungsglieder
erlaubten die Auf-nahme der
Stosskräfte
bei
Anprällen
mit kleinen Geschwindigkeiten ohne Be-schädigungen am Kasten.
Verwendet wurden auch bei dieser
Lo-komotive
die bewährten
Hülsenpuffer.
Gegenüber den älteren Lokomotiven wurden auch hier die
Federn
der
Puffer
etwas kräftiger ausgeführt. Ausgestattet wurden diese Puffer mit
rechteckigen
Puffertellern,
die sich in der Vergangenheit auch bei vierachsigen Lokomotiven immer
öfters durchsetzen konnten. Die Platten waren jedoch ebenfalls kräftiger
ausgeführt worden.
Speziell ausgestattet wurde der linke
Puffer.
Um die unter dem Fenster montierte Steckdose der
UIC-Leitung
zu erreichen, war eine Leiter notwendig. Diese war bei den Re 460 nicht
mehr zu sehen, denn sie konnte über dem Puffer eingeklappt werden. Daher
war dieser Puffer im Gegensatz zu jenem der anderen Seite mit einem
komisch aussehenden Kasten versehen worden. Diese Massnahme verhinderte
die hässlich aussehende Aufstiegshilfe.
Im Vergleich war die vierachsige
Lokomotive
100 mm länger als die Loko-motive der Baureihe
Ae 6/6. Damit entstand eine lange
laufstabile Loko-motive, die sehr gut für die hohen geforderten
Geschwindigkeiten geeignet war. Bisher konnte beim Aufbau des Kastens kein Gewicht eingespart werden. Der Untergurt war das massivste Bauteil der gesamten Lokomotive, denn hier wirkten die Kräfte, die im Betrieb auftreten konnten.
Diese Kräfte mussten beherrscht werden, wollte man nicht bleibende
Ver-formungen an Kasten riskieren. Mit dem weiteren Aufbau des Kastens
änderte sich das nun und man sparte Gewicht, wo es nur ging. Auf dem Rahmen wurden die beiden Seitenwände aus gesickten Blechen auf-gestellt. Diese gesickten Bleche waren ein klarer Konsens ans Gewicht, optisch hätte die Lokomotive mit glatten Seitenwänden sicher besser ausge-sehen.
Nur hätten dann dickere und somit schwerere Bleche verwendet
werden müs-sen. Daher mussten auch hier die schon bei der
Lokomotive Re 4/4 IV verwendeten Sicken benutzt werden.
Die Stabilität der beiden Seitenwände, die selber eigentlich zu
schwach waren, wurde mit den beiden Rückwänden der
Führerstände
erreicht. Im
Maschinenraum
selber wurden keine quer verlaufenden Wände gestellt. Einzig im Bereich
des Daches wurden Querträger zur Stabilisierung der beiden Wände
eingezogen. Es entstand so ein grosser Hohlraum der freizügig als
Maschinenraum genutzt werden konnte.
Damit der Lokführer im Notfall den
Maschinenraum
trotzdem auf einem anderen Weg verlassen konnte, gab es im Dach eine Luke,
durch die man ins Freie und so aus der
Lokomotive gelangen konnte. Eine Lösung, die hier erstmals
angewendet wurde. Abgedeckt wurde der Maschinenraum mit dem darauf aufgesetzten und lösbaren Dach. Wurden früher die Dächer zur Einsparung von Gewicht aus Aluminium gefertigt, kam hier Stahl zur Anwendung.
Diesen musste man verwenden, weil das Dach eben-falls Teil zur
Stabilisierung der Seitenwände war. Die während der Fahrt auftretenden
Kräfte wurden durch das Dach aufgefangen. Daher musste der kräftigere
Stahl verwendet werden. Soweit sind nun die wichtigsten Stahlteile des Kastens bereits aufgezählt worden. Die weiteren Elemente des Kastens, des Daches und namentlich die an-schliessend vorgestellten Führerstände waren aus Kunststoff erstellt worden.
Dieser Werkstoff war leicht, konnte gut geformt werden und bot
dank neuen Erkenntnissen sogar die grössere Festigkeit als vergleichbare
Metalle. Daher war klar, so konnte man sehr viel Gewicht einsparen.
Um den eigentlichen Kasten abzuschliessen, kommen wir nun zu den
beiden
Führerständen.
Auch wenn diese bei den
Lokomotiven immer wieder im Kasten integriert wurden, gehörten
sie eigentlich nicht zur Lokomotive. So konnten die Führerstände, die
schnell beschädigt werden konnten, leicht gewechselt werden. Bei den Lok
2000 sollte das nicht geändert werden. Daher war der Führerstand eine
eigene Baugruppe.
Die beiden
Führerstände wurden aus Kunststoff aufgebaut. Die Haube des
Führerstandes bestand im Wesentlichen aus fünf Schichten mit
unterschiedlichen Kunststoffen. Die beiden Deckschichten waren, wie die
Zwischenschicht aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt worden und
brachten die Stabilität. Dazwischen wurden zwei Schichten mit einem
zähelastischen Schaumkern eingefügt und so eine gewisse Flexibilität
erreicht.
Durch diesen aufwendigen Aufbau der eigentlichen Haube konnten
zwei grundlegende Eigenschaften erreicht werden. Die gute Schutzfunktion
bei hohen Geschwindigkeiten und die gute Isolierfähigkeit wirkten sich auf
den Arbeitsplatz des Lokführers aus. Der gewünschte Nebeneffekt war
jedoch, dass diese Bauweise viel leichter war als eine vergleichbare
Stahlkonstruktion. Genau konnten so pro
Führerstand
800 kg Gewicht eingespart werden.
Die Eleganz der
Lokomotive war daher eine Folge der Bauweise der
Führerstände.
Jedoch trugen diese Massnahmen auch zu den hohen Kosten bei, denn ein
Designer arbeitet bekanntlich nicht gratis. Betrachten wir die Haube der Führerstände etwas genauer. Diese Haube bestand aus den beiden identischen Seitenwänden und der Front. Ich be-ginne dabei bei den beiden identischen Seiten-wänden des Führerstandes.
Diese Wände besassen die
Einstiegstüren,
ein klei-nes Fenster und ein weiteres durch die
Rückspiegel
bedingtes zusätzliches Fenster. Das Fenster konnte nicht geöffnet werden
und war fest mit der Struk-tur verbunden worden.
Die Türe selber bestand ebenfalls aus Kunststoff und sie öffnete
sich nach innen. Im geschlossenen Zustand konnten die Dichtungen der Türe
mit
Druckluft
aufgeblasen werden. Damit schloss die Türe druckdicht ab und konnte nicht
mehr geöffnet werden. Wurde die Türfalle betätigt, entlüftete sich die
Dichtung automatisch. Durch eine Luke in der Türe konnten Dokumente ohne
öffnen der Türe überreicht werden.
Um an die beiden seitlichen Türen des
Führerstandes
und somit in den selbigen zu gelangen, waren die üblichen
Griffstangen
und Trittstufen vorhanden. Nur ging man auch hier einen Schritt weiter.
Die beiden Griffstangen wurden nicht mehr am Führerstand angesetzt,
sondern waren in der Kunststoffhaube enthalten. Daraus ergab sich, dass
die Griffstangen bündig mit der Flucht des Kastens waren. Sie verschwanden
also in Nischen.
Die eckigen und kantigen Lösungen der älteren Ma-schinen waren
damit verschwunden und wichen ele-ganten
Kurven. Besondere Aufmerksamkeit musste der Front-scheibe, die über die ganze Fahrzeugbreite verlief, entgegen gebracht werden. Wo immer es ging, wurde bei der Lokomotive auf Glas verzichtet.
Glas ist schwer und schwere Bauteile wollte man bei der Maschine
nach Möglichkeit vermeiden. So besass der gesamte Kasten kein einziges
Fenster. Die ein-zigen Fenster befanden sich im
Führerstand
und auf diese konnte man bekanntlich nicht verzichten.
Dabei war die
Frontscheibe
das grösste Fenster auch das am aufwändigsten gestalte Exemplar. Durch die
Form der
Lokomotive konnte es nicht flach ausgebildet werden und besass
eine leichte Wölbung, die der
Front
folgte. Das sorgte dafür, dass dieses Fenster sehr teuer in der
Anschaffung war. Flache Gläser wären billiger gewesen, konnten aber mit
dem Design der Lokomotive nicht vereinbart werden. Daher wirkte sich der
Designer auch hier negativ aus.
Die Festigkeit des
Frontfensters
wurde im
Pflichtenheft
durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB vorgegeben und musste
eingehalten werden. Diese Vorschrift besagte, dass die Scheibe einer Kugel
mit einem Durchmesser von zehn Zentimeter und einem Gewicht von einem
Kilogramm standhalten musste. Die dazu massgebende Geschwindigkeit der
angenommen Kugel entsprach der doppelten
Höchstgeschwindigkeit
der
Lokomotive, was ungefähr 500 km/h bedeutete.
Ein weiterer Problempunkt war die
Verbindung
der beiden Hauben mit dem eigentlichen Kasten der
Lokomotive. Dazu wurden jedoch nicht Schrauben benutzt,
sondern die Haube wurde mit einem speziellen elastischen Klebstoff auf dem
Metall aufgeklebt. Sie ahnen es vermutlich bereits, denn damit konnten
auch wieder ein paar Gramm Gewicht gespart werden. Zudem war die Haube so
besser mit dem Kasten verbunden.
Viele Teile der Lok 2000 waren durch Verschalungen und zusätzliche
Schürzen versteckt worden. Die
Lokomotive war daher durch das Design vollständig
durchgestylt worden und alles was irgendwie nach Eisenbahn aussah, wurde
hinter einer Verschalung versteckt. Besonders im Dachbereich war das
augenfällig, denn die gesenkten
Stromabnehmer
verschwanden in einer Nische und waren optisch kaum mehr zu erkennen.
Tief nach unten gezogene seitliche Schürzen deckten die
Drehgestelle
und damit das
Laufwerk
weitestgehend ab. Die Lok 2000 galt dadurch als sehr ruhige
Lokomotive. Jedoch muss klar gesagt werden, dass diese
Verschalungen und das durch einen Designer gestaltete Aussehen der
Lokomotive sehr viel zu den hohen Kosten des fertigen Fahrzeuges
beigetragen hatten. Die elegante Lokomotive war nun mal teurer, als das
kantige Arbeitsgerät.
Die
Lokomotive erhielt unter dem Kasten montierte
Bahnräumer.
Diese waren dank den Verschalungen kaum zu erkennen, da auch sie so
gestaltet wurden, dass sie dem eleganten Fahrzeug entsprachen. Sie hatten
jedoch bei der
Schneeräumung
keine Aufgabe und konnten daher sehr flach gehalten werden. An dem
Bahnräumer angebracht waren die Halterungen für die Schläuche und die
nicht benötigte
Kupplung.
Die Lokomotive hatte somit speziell angepasste Bahnräumer erhalten.
Damit können wir die Betrachtung des Kastens abschliessen. Wir
haben bisher viele Punkte zur Einsparung von Gewicht kennen gelernt, haben
aber auch erfahren, dass nicht unbedingt benötigte Verschalungen vorhanden
waren. Alles in allem kann gesagt werden, dass gerade bei dieser
Lokomotive das Design eines Stardesigners das grösste
Problem war. Dadurch wurde die Lok 2000 schwer und zudem extrem teuer.
Mit weniger Design und damit weniger Schnickschnack hätte Gewicht
eingespart werden können. Wichtiger wäre jedoch für die
Lokomotive gewesen, wenn sie billiger geworden wäre.
Doch man wollte eine elegante schöne Lokomotive schaffen und so den Stolz
präsentieren. Wer das will, muss bekanntlich tiefer in die Geldbörse
greifen, das ist nicht nur bei Lokomotiven so, sondern auch in anderen
Bereichen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
benötigte elektrische Ausrüstung für die Ma-schine hatte ein sehr hohes
Gewicht. Die Folge da-von war, dass der Kasten der
Die
benötigte elektrische Ausrüstung für die Ma-schine hatte ein sehr hohes
Gewicht. Die Folge da-von war, dass der Kasten der
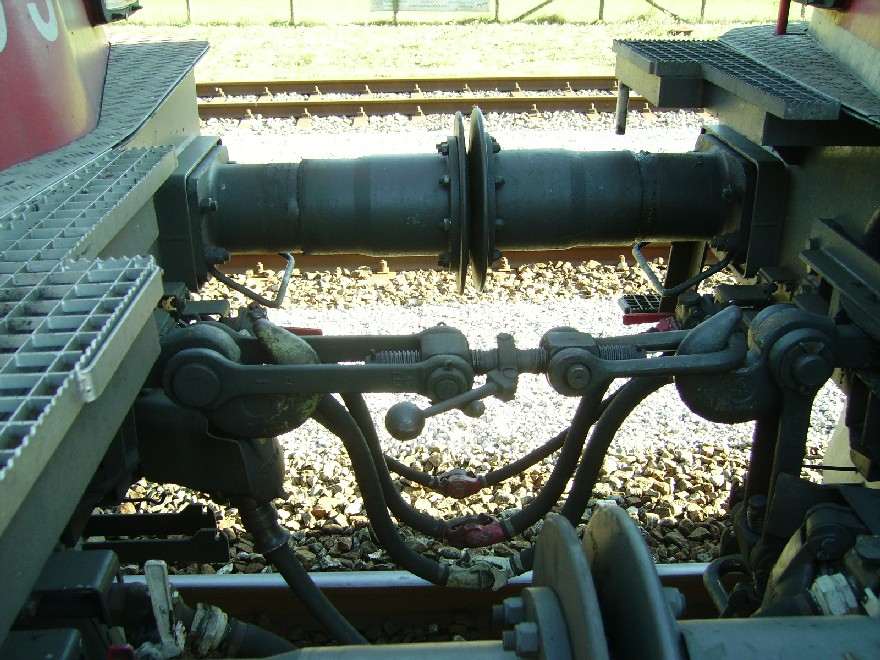 Am
Am
 Damit
können wir die
Damit
können wir die
 Fenster
waren in den beiden Seitenwänden nicht vorgesehen und so waren die beiden
Türen für den Durchgang die einzigen seitlichen Öffnungen des sonst
geschlossen
Fenster
waren in den beiden Seitenwänden nicht vorgesehen und so waren die beiden
Türen für den Durchgang die einzigen seitlichen Öffnungen des sonst
geschlossen  Dank
der Kunststoffbauweise konnte beim
Dank
der Kunststoffbauweise konnte beim  Der
Übergang von den Seitenwänden in die
Der
Übergang von den Seitenwänden in die