|
Das Bahnprojekt |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der Gotthardtunnel war lediglich ein Teil
eines Projektes, das unter dem Titel die
Gotthardbahn bekannt wurde. Es geht nicht, den
Tunnel
zu beschreiben, ohne das Projekt kurz zu betrachten. Begonnen hatte alles
mit dem Erfolg der ersten Bahnen in Europa. Ein wichtiger Punkt war, als
es am Semmering gelang auch stärkere Steigungen zu bewältigen. Damals
gerieten die Alpen und den Vordergrund und erste Projekte entstanden.
Weiter waren Projekte ausserhalb der
Schweiz bereits sehr weit fortgeschritten. Dazu gehörte die Strecke über
den Mont Cenis mit dem langen
Scheiteltunnel.
Selbst die Bahn über den Brenner war damals bereits im Bau. Die Schweiz
lief daher Gefahr, den wichtigen Korridor durch die Alpen zu verlieren.
Deshalb war es wichtig, die Diskussionen schnell zu beenden und sich auf
ein Projekt für die neue Strecke festzulegen. Unter der Leitung von Luzern wurde
letztlich am 06. Dezember 1871 der Gotthardvertrag unterzeichnet und so
der Grundstein für die
Bahnlinie
gelegt. Es wurde deshalb eine Gesellschaft gegründet, die unter dem Namen
«Gotthardbahn»
bekannt werden sollte. Diese Gesellschaft sollte die Bahnlinie durch den
Gotthard bauen. Dazu oblag es der schweizerischen Eidgenossenschaft die
Konzession
für diese neue Bahnlinie zu erteilen. Das Projekt sah eine doppelspurige
Bahnlinie
vor. Diese sollte als Adhäsionsbahn mit Radien von mindestens 300 Meter
und maximalen Steigungen von 25 bis 26‰ gebaut werden. Dabei waren die
steilen Abschnitte jedoch auf den Bereich der direkten Zufahrt zum
Tunnel
zu beschränken. Die Steigungen leitete man von den bestehenden Strecken im
Ausland ab. Gerade in Österreich waren diese als Ideal angesehen worden. Von der Schweiz wurden zudem bestimmte
Normen für die Strecke festgelegt. Dazu gehörte, dass die neue
Bahnlinie
nach den Normalien der bestehenden Bahnen gebaut werden sollte. Damit
waren der Gleisabstand und weitere Normen festgelegt worden. Zudem wurde
geregelt, wie die Strassenkreuzungen zu erfolgen hatten. Angestrebt wurde
dabei ein Winkel von 90°. Dieser konnte in Ausnahmen bis auf 60°
verringert werden.
Es gab ab dem
Bahnhof
zwei mögliche Varianten. Die südliche Strecke hätte vom Bahnhof Luzern aus
in Richtung Stans und weiter in den Raum Becken-ried geführt. Schliesslich
hätten die steilen Hänge am Urnersee zu langen
Tunneln
geführt. Zürich hätte die neue Gotthardbahn über die am 01. Juni 1864 eröffnete Strecke der Zürich-Zug-Luzern-Bahn erreicht. Der Vorteil dieser Lösung war, dass die Strecke insgesamt wesentlich kürzer ausgefal-len wäre, als die Variante Nord. Zudem hätte man weniger Strecken bauen
müssen, da Zug – Goldau weggefallen wäre. Die
Güterzüge
hätten dabei in Luzern eine spezielle
Ver-bindungslinie
genutzt und so den
Kopfbahnhof
umfahren. Der Nachteil war jedoch, dass damit auch
die Stadt Zürich keinen direkten Zugang bekommen hätte. Schliesslich
musste Bern schon über das Emmental und das Entlebuch angeschlossen
werden. Die Idee mit der Variante Süd wurde bereits verworfen, bevor die
Strecke von Zürich nach Luzern gebaut gewesen ist. Gerade der Bankenplatz
Zürich nahm dabei einen grossen Einfluss auf die
Gotthardbahn und konnte sich so durchsetzen. In der mächtigen Stadt Zürich sah man eine
nördliche Lösung und einen direkten Anschluss über Zug vor. Letztlich
entstand so die Lösung mit mehreren Talbahnen, Zufahrten, die sich in
flache und steile Abschnitte aufteilten und einem Haupttunnel. Dieser war
schon sehr früh festgelegt worden und er sollte zwischen Göschenen und
Airolo gebaut werden. Die nördliche Strecke wurde daher auf das Ziel
Göschenen ausgerichtet.
Dazu nutze die
Gotthardbahn die im Hinblick auf die neue Strecke projektierte
Aargauer
Südbahn.
Diese war jedoch nur bis Rotkreuz geplant, so dass noch eine Zufahrt
benötigt wurde. Weiter sollte die Bahnlinie den nördlichen Hängen der Rigi folgen und dabei an Höhe gewinnen. So sollte bei Goldau die durch den Bergsturz entstandene Anhöhe erreicht werden. In Goldau sollte der erste grosse
Bahnhof
ein Anschluss der Strecke aus Zürich ermöglichen. Diese hätte in Zug
begonnen und wäre auf der anderen Seite des Zugersees nach Goldau geführt
worden. Damit hätte Zürich einen direkten Zugang erhalten. Die Strecke sollte anschliessend den Hängen folgend den Talkessel von Schwyz erreichen. Hier waren Lösungen mit einem Bahnhof in der Gemeinde Schwyz dem Hauptort des gleich-namigen Kantons, beziehungsweise Seewen vorgesehen. In jedem Fall hätte man bei Ingenbohl,
genauer beim Ortsteil Brunnen ereneut die Ufer des Vierwaldstättersees
erreicht. Ge-rade in diesem Bereich hätten die Steigungen geringgehalten
werden können. Der Kanton Uri sollte entlang den Ufern des
Urnersee erreicht werden. Das Gelände war in diesem Bereich jedoch nur mit
dem Bau von
Tunnel
zu bewältigen. Diese wurden so kurz wie möglich vorgesehen, da deren Bau
teuer war und man so die Kosten etwas tiefer halten wollte. Grosse
Vielfalt bei den möglichen Lösungen gab es in diesem Bereich jedoch nicht.
Dazu waren die Hänge bis in den Raum Flüelen schlicht zu steil.
Es war klar, dass hier die Züge für die
Bergfahrt bespannt werden sollten und so ein Halt vorgesehen werden
musste. Ziel war jedoch der Beginn der Steigung, der im Raum Silenen oder
Amsteg vorgesehen war. Wie sich die Linie im engen Talkessel der Urner Reuss entfalten sollte, war zu Beginn des Projektes noch nicht festgelegt worden. Lösungen mit Schrägaufzügen oder mit Spitzkehren wurden zusammen mit anderen noch abenteuerlicheren Lösungen diskutiert. Auf jeden Fall sollte die Strecke so den
Weiler Göschenen und damit den
Scheiteltunnel
erreichen. Damit hätte die nördliche Zufahrt von Luzern und Zürich ihr
Ende gefunden. Nicht gelöst war dabei die Zufahrt der Linien im Raum Goldau. Je nach Variante hätten sich andere Radien und damit Geschwindigkeiten ergeben. Zusätzlich wollte man auch das Schuttgebiet nicht unbedingt durchqueren müssen. Sie sehen, es waren durchaus viele offene
Punkte zu klären, aber die Lösungen für die Probleme kamen oft erst
während dem Bau der Strecke und das war beim Gotthard auch nicht anders
gelöst worden. Dazu gehörte nicht nur die Zufahrt zum
Bahnhof
von Oberarth, der später Arth-Goldau genannt wurde. Auch die
Kehrtunnel,
die letztlich die Zufahrten künstlich verlängerten und so die Steigungen
einhalten sollten, gehörten dazu. Gerade diese speziellen
Tunnel
wurden erst während dem Bau entwickelt und ein Versuch in Süddeutschland
bei der Wutachtalbahn (Sauschwänzlebahn) zeigte den Vorteil dieser
Kehrtunnel auf.
Biasca musste man anfahren, denn ab dort
wollte die
Gotthardbahn die Strecke der Tessiner Talbahnen nutzen. Diese
Strecke wurde bereits vorgängig projektiert und befand sich zwischen
Locarno und Biasca teilweise bereits im Bau, als der Gotthard festgelegt
wurde. Dazu war durchaus vorgesehen, dass die Gesellschaft von der
mächtigen Gotthardbahn übernommen werden sollte. Zumal deren Nutzen nur
dank der Alpenbahn erwiesen war. Es war ein Vorstoss des Kantons Tessin,
denn die Talbahnen sollten vorerst nur bis Biasca geführt werden. Ab dort
konnte man später Richtung Gotthard, als auch Richtung Lukmanier
weiterbauen. Sie sehen, dass der Kanton Tessin auf beide Varianten setzte
und so einen Beitrag an die neue Strecke leisten wollte. Diese
Leistung
obwohl damals die Variante Grimsel noch nicht vom Tisch war. Man ging
daher ein grosses Risiko ein. Südlich von Bellinzona, waren wieder neue
Strecken zu bauen. Dabei gab es eine Linie nach Luino und eine über den
Pass des Monte Ceneri nach Lugano, wo man wieder auf die Tessiner
Talbahnen stossen wollte. Diese Strecke war im Projekt enthalten, sollte
jedoch lediglich einen geringen Teil des Verkehrs übernehmen, da auf der
Seite von Bellinzona steile Abschnitte zu Bewältigung der Höhendifferenz
benötigt wurden. Die Hauptlast der Züge sollte nach Luino
geführt werden. Dabei sollte die neue Strecke bei Cadenazzo von den
Tessiner Talbahnen abzweigen und mit flachen Abschnitten dem Lago Maggiore
folgen. Der grosse Vorteil waren die geringen Steigungen und damit der
einfachere Betrieb. Jedoch führten die Reisewege mit den Postkutschen nach
Lugano und Chiasso. Daher standen hier zwei Lösungen zur Verfügung.
Neben neuen Strecken in anderen Bereichen,
die wegen dem Gotthard gebaut wurden, war das Kernstück des ganzen
Projekts der
Scheiteltunnel.
Dieser sollte zwischen Göschenen und Airolo entstehen, einen geraden
Verlauf haben und möglichst frei von Steigungen sein. Auf Grund der
Distanz errechnete man eine Länge für den Tunnel zwischen 14 und 17
Kilometer. Auch hier hing es davon ab, wo die
Portale
gesetzt wurden. Letztlich wurde diese Streckenführung im
Staatsvertrag festgelegt, womit auch die letzten Diskussionen über die
Variante Süd vom Tisch waren. Wobei leichte Abweichungen durchaus noch
möglich waren. Bei der genaueren Planung wurden letztlich die Zufahrten
etwas gestreckter ausgeführt. Die Einführung in den neuen
Bahnhof
Arth-Goldau sollte in einem
Keilbahnhof
erfolgen. Nur so konnte man die minimalen Radien von 300 Meter auch in
diesem Bereich einhalten. Die
Konzession
zum Bau wurde von der Eidgenossenschaft bereits am 1. Juli 1869 erteilt.
Sie war auf 25 Jahre befristet. In dieser Zeit musste die
Bahnlinie
gebaut und dem Betrieb übergeben werden. Ansonsten wäre die Konzession
erloschen. Die Auslegung der Konzession sah eine Anpassung derselben mit
der Eröffnung der Bahnlinie vor. Dabei sollte eine Betriebskonzession
entstehen, die jedoch an der Laufzeit nichts veränderte.
Der Bauunternehmer Louis Favre aus Genève
unterbot die Konkurrenten dabei sowohl bei der Bauzeit als auch beim
Preis. Unterzeichnet wurde der Vertrag am 07. August 1872. Neben dem angenommenen Angebot, stach zudem eines aus England heraus. Die «Machine tunneling Cie» offerierte bei einer Bausumme von lediglich 5.3 Millionen Schweizer Franken eine besondere Lösung. In sechs Jahren sollte der
Tunnel
mit einer Maschine mit Diamantbohrkopf in seiner vollen Grösse
ausgebrochen werden. Damit war bereits 1870 die Idee einer
Tunnelbohrmaschine, wie sie beim
Basistunnel
verwendet wurden, vorgeschlagen worden. Die Dauer der Bauzeit veranschlagte Favre auf acht Jahre. Dabei war der Bauunternehmer ausgesprochen optimistisch. Zudem wurden im Vertrag auch die Bonitäten geregelt, welche Strafen und Belohnungen bei kürzerer oder längerer Bauzeit vorsahen. Spezielle Klauseln über unvorhergesehene
Probleme gab es hingegen nicht. Damit trug letztlich Louis Favre das
gesamte Risiko beim Bau des Gotthardtunnels. Die Strecke der
Gotthardbahn sollte gemäss diesem Projekt eine Länge von nahezu
300 Kilometer umfassen. Dabei mussten viele
Tunnel
und
Brücken
gebaut werden. Das Startkapital wurde daher auf 56 Millionen Schweizer
Franken festgelegt und entsprechend Aktien und Obligationen herausgegeben.
Diese wurden in der Schweiz, in Deutschland und Italien veräussert.
Geregelt war die internationale Emission der Aktien im Staatsvertrag. Nicht Bestandteil im Projekt
Gotthardbahn waren diverse andere für die Anbindung benötigte
Strecken. Diese waren in der Schweiz durch die
Verbindungsbahn
in Basel und durch die Aargauer
Südbahn
sicher zu stellen. In Italien galt es die Zufahrten an die Gotthardbahn zu
bauen. So sollte eine erste internationale
Bahnlinie
in Europa entstehen. Doch bis diese wirtschaftlich genutzt werden konnte,
musste sie zuerst gebaut werden. |
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
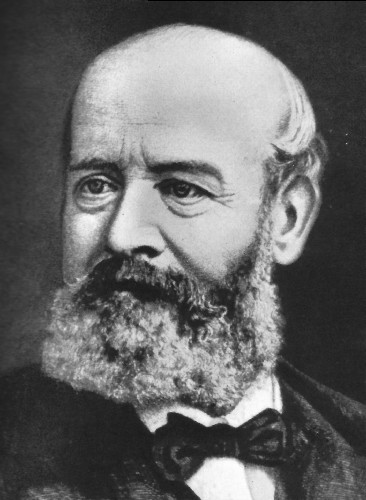 Von
den vielen Ideen dieser Alpenbahnen, gab es in der Schweiz drei
verschiedene Lösungen. Diese querten die Alpen bei den Pässen am
Lukmanier, Gotthard und Grimsel. Wobei letztlich nur noch die Strecken am
Lukmanier und am Gotthard in die engere Auswahl gelangen sollten. Erst das
Umschwenken von Alfred Escher führte dazu, dass das Projekt
Von
den vielen Ideen dieser Alpenbahnen, gab es in der Schweiz drei
verschiedene Lösungen. Diese querten die Alpen bei den Pässen am
Lukmanier, Gotthard und Grimsel. Wobei letztlich nur noch die Strecken am
Lukmanier und am Gotthard in die engere Auswahl gelangen sollten. Erst das
Umschwenken von Alfred Escher führte dazu, dass das Projekt
 Startpunkt
der neuen Strecke der
Startpunkt
der neuen Strecke der
 Die
in Luzern, genauer bei Gütsch, beginnende Strecke, sollte zuerst den Ufern
des Vierwaldstättersees folgend zum Gebiet «Hohle Gasse» führen. Im Raum
Immensee sollte schliesslich die Zuführung der
Die
in Luzern, genauer bei Gütsch, beginnende Strecke, sollte zuerst den Ufern
des Vierwaldstättersees folgend zum Gebiet «Hohle Gasse» führen. Im Raum
Immensee sollte schliesslich die Zuführung der  Im
Urner Talboden führte die Linie in einem leichten Bogen nach dem Hauptort
des Kantons Uri, Altdorf. Altdorf sollte einen standesgemässen
Im
Urner Talboden führte die Linie in einem leichten Bogen nach dem Hauptort
des Kantons Uri, Altdorf. Altdorf sollte einen standesgemässen
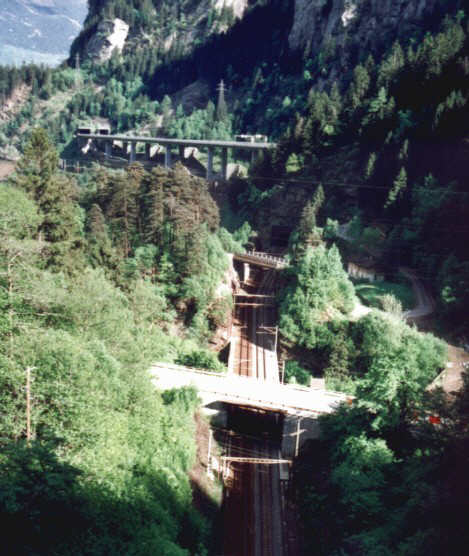 Südlich
vom
Südlich
vom
 Baubeginn
der
Baubeginn
der