|
Entwicklung und Beschaffung |
||||
| Navigation durch das Thema | ||||
| Baujahr: | 1882 | Leistung: | 404 kW / 550 PS |
|
| Gewicht: | 49.4 t | V. max.: | 75 km/h |
|
| Normallast: | 50t bei 40 km/h | Länge: | 10 100 mm |
|
|
Auch wenn man vor der Eröffnung erwartete,
dass die neue Strecke über den Gotthard dem
Güterverkehr
dienen sollte, mussten auch
Reisezüge befördert werden. Solche verkehrten auf
den Tessiner Talbahnen und mit der durchgehenden Strecke sollten auch
Schnellzüge
anzutreffen sein. Um diese zu befördern, musste daher eine kleine Serie
Lokomotiven
beschafft werden, die auf flachen Abschnitten schnell fahren konnte.
Man konnte annehmen, dass man sich auch
erhoff-te, mit der Bespannung auf der
Bergstrecke
bis nach Bellinzona zu fahren. Der flache Abschnitt war schlicht zu kurz
geraten, für einen sinnvollen Wechsel der Bespannung. Für den neuen Abschnitt zwischen Immensee und Erstfeld galt das jedoch nicht. So war hier die Di-stanz deutlich grösser und zudem sollten die Loko-motiven die Züge auch bereits in Luzern abholen können. Auf der bestehenden Strecke wurde damals
schnell gefahren. Wobei sich betrieblich ein Wechsel der Bespannung auch
in Arth-Goldau ergeben könnte. In dem Fall zog eine Maschine der
SCB
den Zug bis zum Wechsel. Auch wenn die Strecke kürzer wurde, die
Lokomo-tiven
konnten damals nicht bis ins Tessin fahren. Das Problem dabei war der
Brennstoff,
denn wurde schon einer grosser Teil der
Kohlen
im
Flachland
verbraucht, konnte diese auf der Strecke über den Berg nicht mehr
ausreichen. Wobei wir hier etwas genauer hinsehen müssen, denn so einfach,
wie es vorher von mir dargestellt wurde, war die Sache keineswegs. Beim Einsatz von
Schlepptenderlokomotiven
hätte man die Strecke durchaus ohne Probleme geschafft. Jedoch hätten dann
viele
Kohlen
verladen werden müssen. Die Folge davon war, dass wir einen schweren
Kohlenwagen
erhalten würden. Dessen Gewicht musste aber von der
Anhängelast
abgezogen werden. Die
Zugkraft
wurde bei der
Lokomotive
erzeugt. Alles, was dann noch angehängt wurde, war Last und so auch der
Tender.
Daher musste eine
Lokomotive
für den Abschnitt Immensee – Erstfeld gesucht und gebaut werden. Die
erwarteten massge-blichen Steigungen sollten nicht mehr als 12‰ betragen,
was durchaus kräftige Modelle verlangte. Jedoch auch ein häufiger Wert in
der Schweiz. Die Verwaltung der Gotthardbahn hätte sich schon bei der ersten Beschaffung grosse Schlepptenderlokomotiven für die Strecke Immensee – Erstfeld gewünscht. Als Muster wurde die Baureihe B der Tessiner Talbahnen gewählt. Diese gab es bereits und so hätte sich ein
Nachbau angeboten. Mit den zwei
Triebachsen
war sie für die Steigungen ideal und auch von der Geschwindigkeit her
hätte sie durchaus gepasst. Das Problem war finanziell begründet. Lokomotiven mit einem Schlepptender sind bei der Beschaffung teuer. Mit anderen Wor-ten, es musste für den kurzen flachen Abschnitt viel Geld ausge-geben werden. Dieses fehlte in den Kassen und man musste
ja noch Maschinen für die neuen
Bergstrecken
beschaffen. Die Baureihe B war da-her im Norden vom Tisch. Im Tessin
reichte die vorhandene Anzahl für den Verkehr aus. Man musste daher ein Betriebskonzept
erarbeiten, das mit anderen
Lokomotiven
auskommen musste. Dabei spielte die Strecke eine ganz bestimmte Rolle, die
wie wir vorhin gesehen haben, sehr unterschiedlich war. Für auf mehreren
Abschnitten durchgehende Lokomotiven war nur die Baureihe B geeignet, aber
die gab es nicht. Trotzdem müssen wir dieses gewünschte Modell genauer
ansehen, denn es war klar, deren Eckdaten galten.
|
||||
| Baujahr: | 1874 | Leistung: | 294 kW / 400 PS |
|
| Gewicht: | 53.4 t | V. max.: | 70 km/h |
|
| Normallast: | 55t bei 30 km/h | Länge: | 14 080 mm |
|
|
Wenn wir diese Eckdaten mit jenen vom
Anfang des Kapitels vergleichen, erkennen wir das Problem des
Tenders.
Die
Lokomotive
war mit geringerer
Leistung
deutlich schwerer. So veränderte sich die
Normallast
auf der maximalen Neigung der Strecke. Auch wenn sie mehr ziehen konnte,
sie war dabei deutlich langsamer als das letztlich beschaffte Modell. Doch
noch war dieses ja gar nicht entwickelt worden.
So konnte man in den Jahren die
Lokomotiven
er-proben und musste nicht lange nach neuen Modellen Ausschau halten.
Verhindert wurde das durch die hohen Kosten für den Bau des Haupttunnels,
da dort mehr Dynamit als berechnet, benötigt wurde. Mit den Eckdaten der Reihe B konnte man durchaus arbeiten. Das obwohl die Maschine bereits ein paar Jahre alt war. Man musste diese nun in eine
Lokomotive
packen, die keinen
Schlepptender
hatte. Eine
Tenderlokomotive
schaffte aber den ganzen Weg nicht mehr. Daher sollte sie nun auf den
flachen Strecken verwendet werden. Dort sollte im Norden etwas schneller
gefahren werden, denn die Strecke war für maximal 75 km/h ausgelegt
worden. Zwar bedeutete das, dass jeder Schnellzug
in Erstfeld und Biasca anhalten musste. Auch die internationalen Züge, die
man erwartete, würden dazu gehören. Ein Konzept, das notgedrungen gewählt
wurde. Schlicht, weil man nicht über das dazu erforderliche Kapital
verfügte. Jedoch erlaubte das auch für die
Bergstrecken
angepasste Maschinen beschaffen zu können. Besonders wenn da auf das
zweite
Triebfahrzeug
verzichtet werden konnte. Die Länge der Strecke von Immensee nach
Erstfeld war gerade kurz genug, dass diese ohne Probleme von
Tenderlokomotiven
befahren werden konnte. Doch damit war erst die Richtung bestimmt worden.
Um eine passende Maschine zu finden, musste man sich auch bei anderen
Bahnen umsehen und davon gab es viele. Irgendwo wird sich wohl ein Muster
für die neue
Schnellzugslokomotive
finden lassen.
Einziger Nachteil, war das Alter, aber für
ein ein-faches Muster sollte das keine Rolle spielen, zumal sich die
Gotthardbahn
keine komplett neu ent-wickelte Baureihe leisten konnte. Sehen wir uns das
Muster an. Bei der Reihe A handelte es sich um eine
Tender-lokomotive
mit zwei Trieb- und zwei
Laufachsen.
Sie war für eine Fahrrichtung ausgelegt worden und daher wurden die beiden
Laufachsen an der Spitze angeordnet. Wir haben deshalb die
Achsfolge
2B erhalten. Mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h war sie für flache
Bahnlinien
ausgelegt worden. Das hatte zur Folge, dass bei Neigungen von 12‰ noch 170
Tonnen mitgeführt werden konnten. Für die
Gotthardbahn
hätte nur ein bisschen mehr
Leistung
vorhanden sein müssen. In Anbetracht der Entwicklung in den letzten Jahren
sollte das kein Problem sein. Mit mehr Leistung hätte die
Höchstgeschwindigkeit
und die
Anhängelast
leicht erhöht werden können. Damit war die eigentlich Entwicklung schnell
abgeschlossen worden, denn wirklich viel Eigenleistung musste das
Direktorium in diesem Fall nicht erbringen. In der Folge wurde von der
Gotthardbahngesellschaft
eine Bestellung ausgelöst. Erwartet würden dabei sechs
Tenderlokomotiven
mit zwei Trieb- und zwei
Laufachsen.
Diese sollte für Schnell- und
Personenzüge
geeignet sein. Ein Einsatz vor
Güterzügen
war hingegen nicht vorgesehen und auch die
Bergstrecke
war nur nebenbei erwähnt worden. Eine Einrichtungslokomotive für die
flachen Strecken im Norden.
Dennoch mit sechs
Lokomotiven
war der mögliche Auftrag für die Industrie recht lukrativ, denn in vielen
Fällen wurden oft nur einzelne Modelle beschafft. Das weil das Geld in den
Kassen fehlte. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Lokomotive sollte bei 75 km/h liegen und war daher für eine Schnellzugslokomotive nicht besonders hoch festgelegt worden. Viele Bahnen hatten Maschinen, die mit bis zu 90 km/h verkehren konnten. Da aber die Zufahrten zur
Bergstrecke
nicht für eine höhere Geschwindigkeit ausgelegt waren, reichte die
geforderte Ge-schwindigkeit problemlos für die
Gotthardbahn aus. Bei den im Tessin bereits erstellten
Strecken sah das anders aus. Hier waren die Anlagen für eine
Höchstgeschwindigkeit
von 90 km/h ausgelegt worden. Gefahren wurden diese Werte jedoch nicht, da
hier ja die alten Modelle der Tessiner Talbahnen verwendet wurden und
diese nicht so schnell fahren konnten. Mit anderen Worten, wegen den
miesen Finanzen wurde nicht das Optimum aus der Strecke geholt. Bei den zulässigen
Normallasten
wurden für die ausgeschriebenen
Lokomotiven
auf Strecken mit
Bahnlinien
von 12‰ mindestens 160 Tonnen verlangt. Bei der entsprechenden
Geschwindigkeit lag man bei 45 km/h. Damit lag man unter dem Muster, aber
der Zug sollte schneller die
Rampen
bezwingen können und das ging nur mit einer etwas geringeren
Anhängelast
für die kleine
Schnellzugslokomotive
der
Gotthardbahn.
Nur leicht sank dabei die Geschwindigkeit,
die nun mit 40 km/h angegeben wurden. Damit war klar, mit der neuen als
Baureihe BI geführten
Lokomotive
sollten in erster Linie im
Flachland
nördlich des Gotthards befahren wer-den. Das wurde bei der Ausschreibung so nicht genannt. Die Anzahl der Maschinen hätte nicht ausgereicht um auch die Bergstrecke zu befahren. Hinzu kam, dass diese kaum für Tenderlokomotiven geeignet war, denn es war eine lange Strecke zu befahren. Das obwohl die Vorräte bei der
Kohle
gleich zu Beginn zu einem grossen Teil aufgebraucht wurden, denn bergab
ging es auch ohne viel Dampf. Bis Erstfeld war es relativ kurz. Von den eingereichten Angeboten entschied sich das Direktorium für die Eingabe der Firma Krauss + Cie aus dem bayrischen München. Man kann annehmen, dass die
Gotthardbahn zumindest zu Beginn die
Lokomotiven
in Deutschland bestellte um die von dort an den Bau gezahlten Gelder zu
kompensieren. Solche Gegengeschäfte waren damals durchaus üblich und die
junge Gesellschaft hatte vermutlich auch keine grosse Wahl. In der Schweiz gab es eigentlich nur die
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur. Die junge
Firma hatte durchaus Aufträge der
Gotthardbahn erhalten und sie lieferte auch an andere Bahnen. Für
ein junges, sich noch im Aufbau befindliches Unternehmen konnten sechs
weitere
Lokomotiven
dazu führen, dass die Lieferfristen nicht eingehalten werden konnten. Das
war hier aber ein wichtiger Punkt.
Dabei kam es zu einem Nachbau der von der
Ma-schinenfabrik in Esslingen gebauten Reihe A, die wir vorher als Muster
angesehen haben und die sich in der Schweiz bereits bewährt hatte. Pikant,
war dabei der Nachbau eines anderen Herstellers. Man bot der Gotthardbahn daher eine bewährte und in der Schweiz bereits eingesetzte Lokomotive an. Auch von der Höchstgeschwindigkeit her passte das Muster gut zur Forderung. Ob man bereits damals ahnte, dass sich die
Maschinen der beiden Bahnen im
Bahnhof
von Luzern durchaus begegnen sollten, entzieht sich meiner Kenntnis. Doch
damit waren die Besonderheiten dieses Auftrages nach München nicht
erledigt. Über den Stückpreis der
Lokomotive
ist wenig bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Maschinen
zwischen 50 000 und 60 000 Schweizer Franken kosteten. Das war durchaus
ein üblicher Preis, der auch dank der Spionage von diesem Hersteller
angeboten werden konnte. Die grössten Kosten waren entfallen, da keine
neue Entwicklung gemacht wurde, was der Teil ist, der eine Lokomotive so
teuer macht. Damit war sie für eine
Schnellzugslokomotive
relativ billig geraten, was natürlich den Kassen der
Gotthardbahn gefiel. Der Grund ist dabei schnell klar, denn hier
wurden normalerweise grosse
Schlepptenderlokomotiven,
wie die bei den Tessiner Talbahnen eingesetzte Baureihe B verwendet. Die
Gotthardbahn bekam aber
Tenderlokomotiven,
die eher zur
Nebenbahn
passten und eigentlich nicht so richtig an den Gotthard gehörten.
Der Grund lag darin, dass die vorhandenen
Modelle durchaus auch einige Jahre für den Verkehr bei den
Reisezügen
ausreichten und weil für die
Berg-strecken
kräftiger Modelle benötigt wurden. Auch zu einer weiteren Lieferung der
Baureihe BI sollte es nicht mehr kommen. Die
Gotthardbahn hatte ihre Maschinen für die
Schnellzüge
und den
Personenverkehr
auf flachen Strecken. Jedoch muss auch erwähnt werden, dass diese Baureihe
bei anderen Bahnen ebenfalls beschafft wurde. Dabei kamen die Muster der
Gotthardbahn nach deren Bau bei der Jura-Simplon-Bahn
JS
ebenfalls in einer grösseren Serie zum Einsatz. Wer sich jedoch bei der
Gotthardbahn etwas auskennt, der weiss, dass der grosse Zuwachs
beim Verkehr in erster Linie die
Güterzüge
betraf. Auf der Strecke verkehrten innerhalb von 24 Stunden lediglich zwei
durchgehende
Schnellzüge.
auch die anderen
Reisezüge verkehrten um 1882 noch nicht so oft, wie
das heute der Fall war. So wurden schlicht in den ersten Jahren auf der
nördlichen Seite keine neuen
Lokomotiven
benötigt. Jedoch sollten im Tessin die Modelle aus
den Anfängen nach der Aufnahme des Betriebes nach wenigen Jahren teilweise
abgelöst werden. Diese waren schon in die Jahre gekommen und für die
langen
Schnellzüge
mussten oft zwei Maschinen verwendet werden. Diese fuhren dann im
gemütlichen Tempo von 70 km/h von Biasca nach Bellinzona, wo dann für die
Rampe
der Linie über den Monte Ceneri neu bespannt wurde.
Ein Wert, der damals in der Schweiz im
Flachland
durchaus üblich war und der erst 1900 übertroffen wurde. Zwar gab es diese
Abschnitte auch im Nor-den, sie waren jedoch nur kurz und wirkten sich
nicht so stark aus. So kam es, dass es um 1890 zu einem Nachbau der Baureihe kam. Jetzt sollten diese aber von der Maschinenfabrik Maffei in München gebaut werden. Das Werk blieb gleich und nur der Name
änderte sich. Das letzte galt auch für die drei neuen
Lokomotiven,
die an die
Gotthardbahn geliefert werden sollte, denn jetzt spielte Geld
keine so wichtige Rolle mehr und in Luzern konnte man sich auch Luxus
leisten. Geführt wurden diese drei für maximal 90
km/h geeigneten Maschinen als Reihe A2. Die Bezeichnung lässt einen
grösseren Unterschied zur Reihe BI vermuten, aber dies rührte von der
Umstellung der Bezeichnungen. Die Nummern 31 bis 33 zeigten klar die
grosse Verwandtschaft. Aus diesem Grund werden wir nun auch diese Modelle
genauer ansehen und dabei auch gleich erfahren, wo sich die Unterschiede
befanden. Zum Schluss bleibt zu erwähnen, dass auch
von der Reihe A2 keine weiteren Modelle mehr beschafft wurden. Das war
eine Folge der neuen Entwicklung von Maschinen mit deutlich mehr
Zugkraft
bei hoher Geschwindigkeit. Die Schnellzüge der Gotthardbahn sollten daher
nach wenigen Jahren durchgehend mit einer
Schlepptenderlokomotive
befahren werden. Für die Beschaffung von älteren
Tenderlokomotiven
gab es keinen Grund.
|
||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
 Wegen
den Kosten sollten die
Wegen
den Kosten sollten die
 Kleinere
Vorräte und dabei an den Schnittstellen der Strecke die Bespannung ändern,
erschien den verantwortlichen Leuten bei der
Kleinere
Vorräte und dabei an den Schnittstellen der Strecke die Bespannung ändern,
erschien den verantwortlichen Leuten bei der
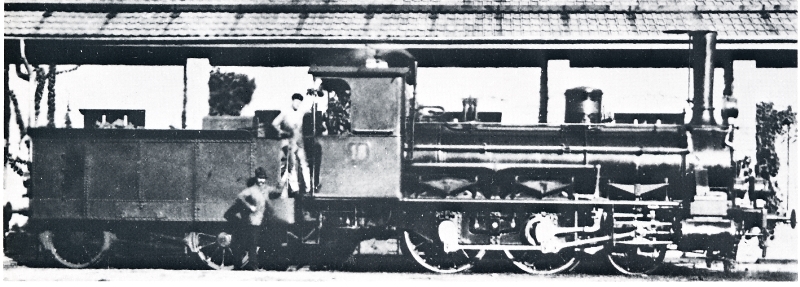 Für
den Verkehr auf den Tessiner Talbahnen war die Baureihe B schlicht zu
gross. Jedoch wurden damals die Maschinen auch für die später durch-gehend
betriebene Strecke beschafft.
Für
den Verkehr auf den Tessiner Talbahnen war die Baureihe B schlicht zu
gross. Jedoch wurden damals die Maschinen auch für die später durch-gehend
betriebene Strecke beschafft.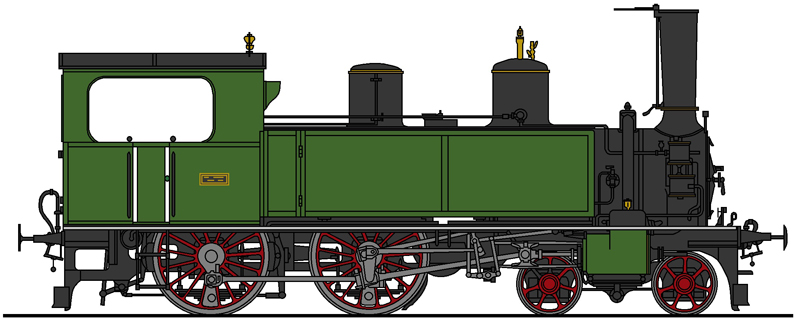 Als
Muster konnte die Reihe A genommen werden die von der Bernischen
Als
Muster konnte die Reihe A genommen werden die von der Bernischen
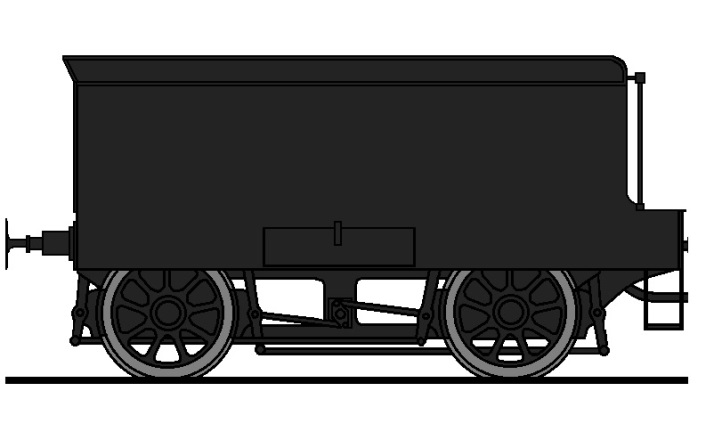 Damit
war klar, die grosse
Damit
war klar, die grosse  Auch
wenn das im Betrieb nicht zu erwarten war, für die
Auch
wenn das im Betrieb nicht zu erwarten war, für die
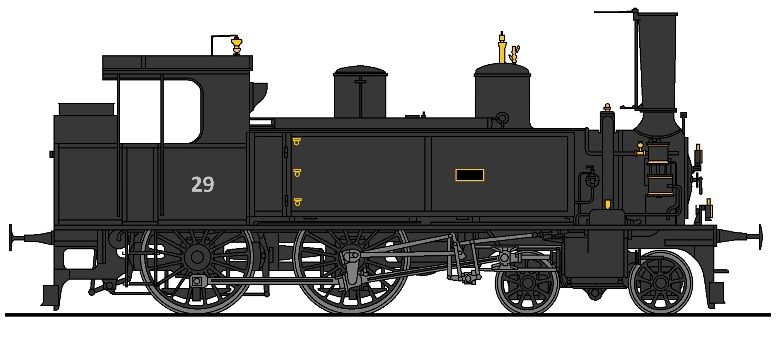 Das
Angebot der Firma Krauss + Cie aus München überraschte jedoch, denn in
Bayern machte man sich das Leben leicht und bot eigentlich nur eine
ang-epasste
Das
Angebot der Firma Krauss + Cie aus München überraschte jedoch, denn in
Bayern machte man sich das Leben leicht und bot eigentlich nur eine
ang-epasste
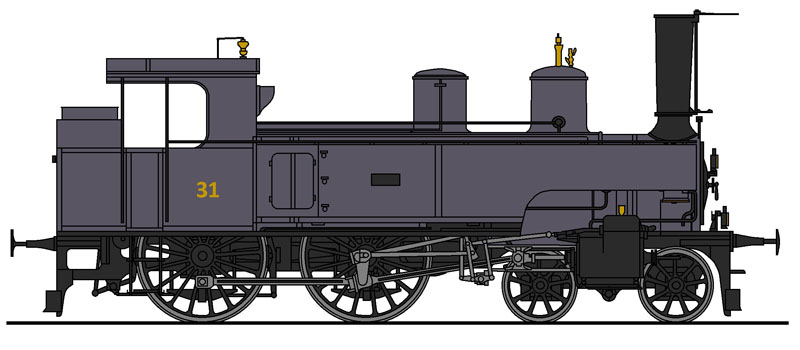 Gerade
die Strecke zwischen den
Gerade
die Strecke zwischen den