|
Mechanische Konstruktion |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Auch wenn es sich bei den Baureihen BI und A2 um
Tenderlokomotiven handelte, die Maschinen waren als Einrichtungsfahrzeug
ausgelegt worden. Wie die grossen Modelle mit
Schlepptender, mussten also
auch sie nach der Fahrt eine
Drehscheibe
aufsuchen. So konnten die
Höchstgeschwindigkeiten nur mit dem
Kamin vorne ausgefahren werden. In der
Gegenrichtung war jedoch nur ein langsameres Tempo zugelassen.
Genau das war der Grund, warum man bei den
Ei-senbahnen oft auf
Tenderlokomotiven
setzte. Nur bei kleineren
Geschwindigkeiten gab es auch vor 1900 Maschinen die für beide
Fahrrichtungen ge-eignet waren. Als tragendes Element war ein aus einzelnen Stahl-blechen aufgebauter Rahmen verwendet worden. Die einzelnen Bauteile dieses Plattenrahmens wur-den mit der Hilfe von Nieten so verbunden, dass ein verwindungssteifes Bauteil entstand. Nur an wenigen Bereichen wurden
Gussteile, oder einfache Stahlprofile verwendet. Es entstand so ein
Rahmen, der damals in der Schweiz bei vielen Baureihen verwendet wurde. Die beiden Längsträger wurden mit den Querträgern so
verbunden, dass ein rechteckiges Bauteil entstand. Als Abschluss dieses
Bauteils war an jedem Ende ein
Stossbalken
angebracht worden. Diese
Stossbalken waren sowohl bei der Höhe, als auch bei der Ausführung bereits
damals genormt worden. Der Grund fand sich in den dort montierten Zug- und
Stossvorrichtungen, die nach den Normen der
UIC ausgeführt wurden. Mittig dieses
Stossbalken wurden die
Zugvorrichtungen
nach den Normen der
UIC montiert. Dazu wurde im Rahmen ein federnd
gelagerter
Zughaken eingebaut. Die kräftigen
Spiralfedern sorgen dafür,
dass der Haken gegen den Stossbalken gezogen wurde. Eine weitere
Möglichkeit dieses Bauteil zu bewegen gab es nicht mehr. Wie damals
üblich, war der Haken mit Ausnahme der Längsrichtung starr geführt worden.
Damit
die Lasche der
Kupplung
in unbenutztem Zustand nicht mit den
Schienen
kollidierte, war ein Hilfshaken vorhanden, in dem die
Schraubenkupplung
abgelegt
werden konnte. Als Alternative wurde sie aber sehr oft in den
Zughaken
gelegt. Nachteilig bei der Schraubenkupplung nach UIC war, dass sie lediglich Zugkräfte, aber keine Stosskräfte aufnehmen konnte. Daher musste sie mit den seitlich am Stossbalken montierten Stossvorrichtungen ergänzt werden. Dazu wurden diese auf der Höhe der
Kupplung am Balken mit der Hilfe von Schrauben befestigt. Schrauben wurden
verwendet, da diese Bauteile im Betrieb oft beschädigt wurden und sie so
den Rahmen schützten. Als Stossvorrichtungen wurden zwei Puffer verwendet. Verbaut wurden übliche Stangenpuffer. Die in Längsrichtung bewegliche Pufferstange nahm die üblichen Stösse auf und diese wurden mit den kräftigen Spiralfedern abgebaut. So wurden nur noch die üblichen
Stosskräfte in den
Stossbalken
abgeleitet. Damit dieser dabei nicht
beschädigt wurde, waren die
Puffer
gegenüber dem
Platten-rahmen mit
Gussteilen abgestützt worden. An der Pufferstange wurden die Kontaktteile
angebracht. Diese
Pufferteller
waren jedoch nicht gleich aufgebaut worden.
Es handelte sich um runde Modelle und dabei wurde beim rechten
Puffer eine
flache Ausführung verwendet. Beim anderen Puffer kam jedoch eine gewölbte
Ausführung zur Anwendung. So war gesichert, dass sich nie zwei identisch
ausgeführte Pufferteller berühren konnten. Auch das war in den Normen
geregelt worden.
Die später gebauten Maschinen der Baureihe A2 wurden jedoch leicht
ge-streckt und hatten daher eine Länge von 10 490 mm erhalten. Ein
Unterschied, der jedoch im
Laufwerk
begründet war, das wir aber später
ansehen. Unter dem tragenden Plattenrahmen wurden wegen dem später noch genauer vorgestellten Laufwerk noch die Halterungen für die Schienenräumer mon-tiert. Dabei wurden diese mit Schrauben daran befestigt
und sie waren nur nach vorne vorhanden. Dank den Schrauben konnten die
Bleche leicht ausge-wechselt, aber auch in der Höhe eingestellt werden. Das
war wichtig, weil hier eine Anpassung an die Abnützung der
Räder erfolgen
musste. Da die beiden Baureihen nur für eine Hauptrichtung
ausgelegt wurden, waren auf der hinteren Seite keine
Schienenräumer
montiert. Trotzdem waren auch hier die Halterungen vorhanden. Jedoch
montierte man an diesen lediglich Reisigbündel. Diese reinigten die
Schienen. Eine Massnahme, die ausreichend war, wenn mit der
Lokomotive
rückwärts gefahren werden musste. Der Grund war die geringere erlaubte
Geschwindigkeit. Wenn wir uns nun den auf dem
Plattenrahmen verbauten
Bauteilen zuwenden, dann werden wir schnell erfahren, dass bei einer
Tenderlokomotive
deutlich mehr vorhanden war, als bei den Modellen, die
mit einem
Schlepptender verkehrten. Der Grund war simpel, denn hier
mussten die Vorräte auf dem Fahrzeug mitgeführt werden und daher nutzten
die Hersteller den verfügbaren Platz so optimal, wie nur möglich aus.
Wichtig war
das, weil hier Arbeiten am
Kessel
aus-geführt werden mussten. Für den
erforderlichen Halt des Personals, war auf dem Umlaufblech eine
Halte-stange montiert worden. Ein einfacher Aufstieg, der in diesem Bereich
damals üblich war. Wechseln wir auf die andere Seite der Lokomotive. Wobei wir nicht bis zum hinteren Stossbalken gehen, denn es wird Zeit, wenn wir uns das Führerhaus ansehen. Dieses war bei beiden Baureihen identisch ausgeführt worden. Beschränkt wurde dieser Aufbau durch das
rück-seitige
Kohlenfach und die davon montierten
Wasser-kästen. Nicht
sichtbar war, dass es um den
Steh-kessel mit der
Feuerbüchse
platziert
wurde. Aufgebaut wurde das
Führerhaus
sehr einfach. Es
bestand aus einer
Frontwand, einem Dach und den beiden identischen
Seitenwänden. Die Seitenwände waren im vorderen Bereich bis auf die Höhe
des Daches geführt worden. Im hinteren Bereich war die Wand jedoch nur bis
zu halben Höhe vorhanden und war oben einfach nur offen. Unterbrochen
wurden die Seitenwände in diesem Bereich durch die beiden seitlichen
Zugänge zum Führerhaus. Der Zugang erfolgte mit einer unter der einfachen
Einstiegstüre montierten Leiter. Bei der Ausführung der Leiter gab es nun
einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Baureihen. Bei der Reihe BI
war die ganze Leiter frei ausgeführt worden. Die Modelle nach dem
Baumuster A2 hatten jedoch noch einen Tritt in der Seitenwand erhalten.
Das war erforderlich, da hier den Fussboden etwas höher gelegt werden
musste.
Besonders bei der Baureihe A2, da diese eine etwas
längere Leiter erhalten hatte, als die älteren Schwestern, die kleinere
Räder hatten. Mit Ausnahme der Türe gab es jedoch keine
Absturzsicherungen. Nach vorne abgeschlossen wurde das Führerhaus mit der quer zur Fahr-richtung eingebauten Frontwand. Diese war um den Kessel angeordnet wor-den und sie war wegen den vor dem Führerhaus montierten Wasserkästen nur im oberen Bereich zu erkennen. Jedoch war dieser Teil
wichtiger, da hier auf beiden Seiten des
Kessels
über den Kästen beidseitig
einfache
Frontfenster verbaut wurden. Im unteren nicht sichtbaren Bereich
war es nur eine Wand. Verschlossen wurden die beiden Frontfenster mit den eingebauten Gläsern. Zum Schutz des Personals war gehärtetes Glas verwendet worden. Dieses hatte den Vorteil, dass es bei einem Bruch keine scharfkantigen Scherben bildete. Wie damals üblich, waren es wirklich
Fenster, denn sie konnten durch das Personal auch geöffnet werden. Ein
Vorteil im Sommer, da so etwas Fahrt-wind in das
Führerhaus
gelangte. Um den Blendeffekt der tief stehenden Sonne etwas zu milderen, wurden über den Frontfenstern Sonnendächer montiert. Wegen den runden Fenstern, wa-ren diese stark gerundet, was sich auf die optische Erscheinung der Sonndächer auswirkte. Das gerundete Blech war so aufgebaut
worden, dass es zur
Frontwand zulief und dabei seitlich bis zur halben
Höhe des Fensters führte. Eine einfache Lösung, die aber gute Ergebnisse
lieferte. Eigentlich fehlt uns nur noch die vierte Wand eines
Führerhauses. Diese war bei beiden Baureihen schlicht nicht vorhanden. Das
zeigte, dass es sich hier um Modelle handelte, die für eine Fahrrichtung
ausgelegt wurden, denn nur bei solchen Maschinen waren diese Führerhäuser
verbaut worden. Diese offene Ausführung wurde damals gewählt, weil die
Wärme von der
Feuerbüchse
abgeführt werden musste.
Um das
Führerhaus abzuschliessen, müssen
wir uns dieses Dach noch etwas genauer ansehen. Wobei wir hier keine
Unterschiede zwischen den beiden Bau-reihen befürchten müssen. Das Dach war seitlich leicht gewölbt worden und es stand auf den Seiten mit einer Wand etwas über diese hinaus. Die Lösung
hatte den Vorteil, dass auf dem Dach kein Wasser liegen blieb und dieses
in jedem Fall seitlich abfliessen und dann auf den Boden tropfen konnte.
Dank dem Überstand tropfte dieses jedoch nicht in das
Führerhaus, so dass
ein ansprechender Schutz vor diesen Auswirkungen des Wetters vorhanden
war. Weil die beiden Seitenwände nur zur Hälfte bis nach
oben geführt wurden, war nach hinten ein sehr grosser Übergang vorhanden.
Dieser konnte dazu führen, dass das Dach durch den Fahrwind ins Flattern
geraten konnte. Um diesen lärmigen Effekt zu verhindern, waren an den
hinteren Ecken des
Führerhauses einfache Abstützungen vorhanden. Dank
diesen können wir die Abmessung dieses Bauteils erkennen.
Hier waren nun aber grössere Unterschiede zwi-schen den beiden Baureihen vorhanden. Daher müs-sen wir etwas genauer hinsehen und dabei beginne ich mit dem hinten verbauten Kohlenfach. Das hinter dem Führerhaus aufgebaute Kohlenfach war nach oben offen, so dass es leicht mit einem Kran beladen werden konnte. Das war jedoch der einzige gleiche Punkt dieses Faches und wir müssen
bereits die beiden Reihen unterscheiden. Bei der älteren Baureihe BI wurde
die Rückwand über dem
Stossbalken senkrecht nach oben gezogen. So konnte
in dem
Kohlenfach ein Vorrat von zwei Tonnen
Kohle mitgeführt werden. Bei der Reihe A2 sollte der mitgeführte Vorrat etwas
erweitert werden. Dazu wurde die Rückwand nach hinten verschoben. Wegen
dem im Bereich der Zug- und
Stossvorrichtungen erforderlichen
Berner Raumes musste die Wand jedoch schräg nach oben geführt werden. Das hatte
zur Folge, dass der Vorrat bei dieser Baureihe lediglich auf 2.3 Tonnen
erweitert werden konnte. Sie sehen, dass der Platz bei
Tenderlokomotive
beschränkt war. Jedoch nur bei der Baureihe BI war der unter dem
Kohlenfach angebaute Kasten für das Werkzeug vorhanden. Dieser
Werkzeugkasten war speziell, da dieser bei den anderen Baureihen der
Gotthardbahn nicht vorhanden war. Für das mitgeführte Material wurde dort
eine Lösung im
Führerhaus gewählt. Hier hatte der Kasten jedoch den
Vorteil, dass das Werkzeug nicht mühsam gesucht werden musste und es von
aussen zugänglich war.
Gemeinsam war, dass diese
beidseitig vor dem
Führerhaus neben dem
Kessel aufgebaut wurden. Für die
weiteren Details müssen wir genauer hinsehen und dabei beginne ich mit der
älteren Baureihe BI, die noch nach dem Muster der Berner
Staatsbahn
aufgebaut wurde. Die Wasserkästen wurden bei der Reihe BI auf beiden Seiten bis in den Bereich der Rauchkammer geführt und sie waren rechteckig ausgeführt worden. In der Höhe waren sie durch die beiden Frontfenster beschränkt worden. Das führte dazu, dass diese
Lokomotiven
einen Vorrat
von 5,4 m3 Wasser mitführen konnten. Zur Kontrolle des
Füll-standes waren unmittelbar von den
Führerhaus drei über-einander
angeordnete Hähne vorhanden. Bei der Baureihe A2 begannen die Unterschiede bereits vor dem Führerhaus. Hier war in der geschlossenen Wand ein Bereich vorhanden, der für die Luftpumpe benötigt wurde. Um den Zugang zu dieser
zu ermöglichen, waren gut sichtbare Tore vorhanden. Das hatte aber zur
Folge, dass die
Wasserkästen
weiter nach vorne geführt werden mussten und
es deswegen zu einem grösseren Problem mit den
Dampfmaschinen kam. Um den mitgeführten Vorrat trotzdem auf einen Wert
von 5,8 m3 Wasser zu erweitern, mussten die
Wasserkästen
bis
ans vordere Ende des
Kessels verlängert werden. Wegen der
Dampfmaschine
waren sie in deren Bereich jedoch nicht so weit nach unten gezogen worden.
Ein optischer Unterschied zur Reihe BI, der sehr leicht erkannt werden
konnte. Auch auf das
Laufwerk sollte das eine Auswirkung haben.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
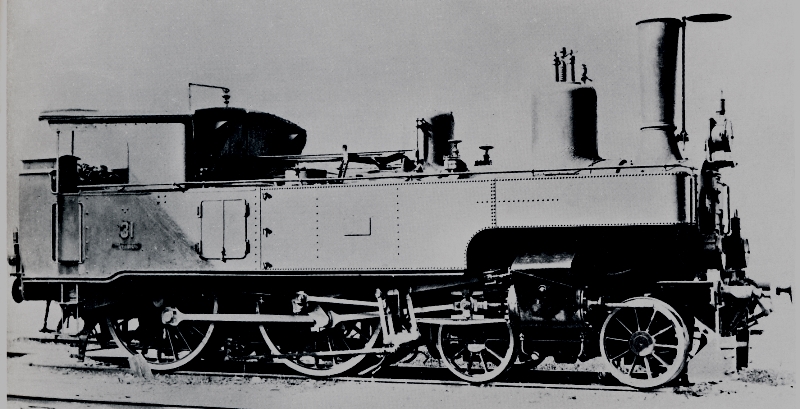 Solche
Solche
 Ergänzt wurde dieser
Ergänzt wurde dieser  Mit den montierten
Mit den montierten
 Auswirkungen hatte das auf das Umlaufblech. Dieses
war hier nur noch im Bereich des vorderen
Auswirkungen hatte das auf das Umlaufblech. Dieses
war hier nur noch im Bereich des vorderen
 Auf beiden Seiten der halbhohen
Auf beiden Seiten der halbhohen
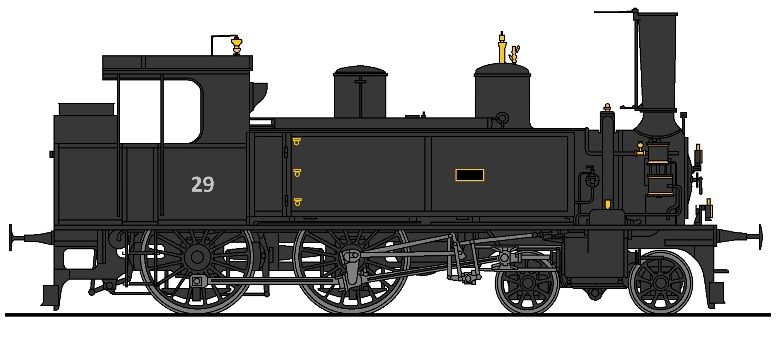 Die
Die
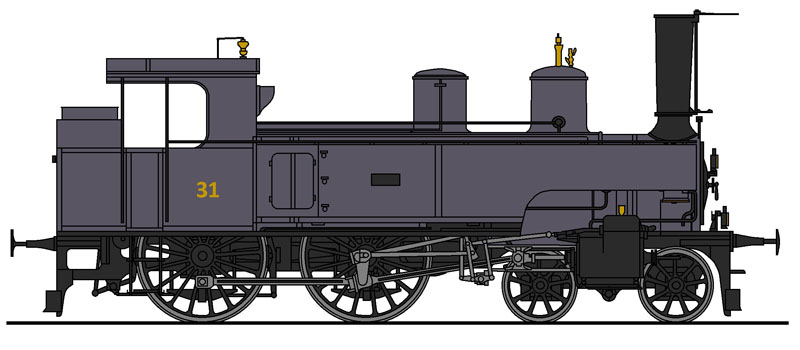 Wichtig ist das, weil wir im Gegensatz zur einer
Wichtig ist das, weil wir im Gegensatz zur einer
 Grössere Unterschiede zwischen den beiden hier
vorge-stellten Baureihen gab es bei der Anordnung der
Grössere Unterschiede zwischen den beiden hier
vorge-stellten Baureihen gab es bei der Anordnung der