|
Die Bremsausrüstung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Ein Punkt, den es bei diesen
Lokomotiven
nicht gab, war ein System für
Druckluft.
Diese wurde nicht benötigt und die Funktionen, die heute damit gelöst
wurden, gab es nicht, oder sie wurden mit Dampf betrieben. Das hatte
jedoch zur Folge, dass diese auch nur bei einem gewissen Vorrat aktiviert
werden konnten. Auch wenn es nicht im Titel erwähnt wurde, müssen wir
diese Bereiche ansehen und das erfolgt in diesem Abschnitt.
Da sie jedoch erst wichtig wurden, wenn mit
dem Dampf das Fahrzeug in Bewegung versetzt wurde, ergaben sich keine
Probleme damit, denn dann funktionierten auch diese Einrichtungen ohne
Probleme. Etwas übertrieben war die Mehrzahl. Es war nur eine Funktion vorhanden, die nicht direkt mit dem Antrieb zu tun hatte und die trotzdem bei jeder Lokomotive benötigt wurde. Die Rede ist von den akustischen Signalen. Diese wurden damals noch recht oft gegeben,
denn die
Bremser
auf den Wagen wurden damit infor-miert, wenn zu bremsen ist. Bei einem
längeren Zug musste also auch am Schluss das Signal gehört werden. Töne wurden mit einer Pfeife erzeugt. Diese war aus Messing aufgebaut worden und sie wurde auf dem Dach des Führerhauses montiert. Eine mechanische Lösung war für die Bedienung vorhanden. Wurde dort am Griff gezogen, öffnete sich
dank der
Zugstange
das bei der
Pfeife
montierte
Ventil.
Die Lautstärke konnte dabei mit der
Zugkraft
an diesem Griff geregelt werden. Je nach Situation, waren daher damit
mehrere Signale möglich. Betrieben wurde die
Lokpfeife
mit Dampf. Dieser wurde dem
Kessel
entnommen und es gab ausser dem erwähnten Ventil keine Beschränkungen.
Daher waren die lautesten Klänge nur möglich, wenn sich im Kessel der
maximale Dampfdruck befand. Bei der Fahrt reichten aber die Klänge immer
aus, dass die
Bremser
den Auftrag auch hörten. Wie diese anzuweisen waren, wurde mit mehreren
Tönen in kurzer Folge erzeugt.
Zudem waren die
Pfeifen
sehr laut und auch damals hatten nicht alle An-wohner Freude an den lauten
Signalen der Dampflokomotiven. Wie das ge-meint war, zeigt eine Anweisung
der
Gotthardbahn. So wurde das Lokomotivpersonal folgendermassen angewiesen: « Das Be-tätigen der Pfeife zwecks Erweckung des Stationspersonals ist in der Station Maccagno ist im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr zu unterlassen.» Sie sehen, auch damals waren die lauten
akustischen Signale nicht überall erwünscht. Wie der
Fahrdienstleiter
in dieser Zeit geweckt werden sollte, das ist im Dokument nicht
überliefert worden und endete wohl in einem Marsch. Es wird nun aber Zeit, wenn wir uns den Bremsen zuwenden. Da diese Bau-reihe auf Bergstrecken verkehren sollte, musste eine gewisse Sorgfalt ange-wendet werden. Wir erinnern uns die
Rampe
von Rivera nach Giubiasco hatte die gleiche Neigung, wie es sie am
Gotthard gab. Bei der Reihe CI hatte man jedoch keinen
Tender,
der mit guten
Bremsen
versehen werden konnte. Die volle
Bremskraft
musste von der
Lokomotive
erzeugt werden. Pneumatische
Bremssysteme
gab es damals noch nicht und daher konnten diese hier auch nicht verbaut
werden. Da die vier nachträglich gebauten Maschinen nur ein Jahr später in
Betrieb genommen wurden, galt das auch für diese
Die
Bremser
waren mit einen geringen Lohn angestellt und wirkten sich daher nicht so
sehr auf die Kassen aus. Zu-mal im flachen Bereich nicht jeder Wagen mit
einem Bremser versehen wurde. Rein theoretisch hätte eine mit Dampf arbeitende Lösung für die Bremsen umgesetzt werden können. Diese war hier sogar vorhanden, nur arbeitete sie mit den Dampfmaschinen und wird daher mit dieser vorgestellt. Die hier verbauten reinen Reibungs-bremsen
wurden deshalb von Hand be-dient und das galt auch für die
Loko-motive.
Wir können deshalb gleich mit dem mechanischen Teil der
Bremsen
beginnen. Um die
Bremsen
bedienen zu können, war im
Führerstand
die entsprechende Einrichtung vorhanden. Dazu wurde nur eine einfache
Kurbel verwendet, die mit verdrehen das angeschlossene Gestänge bewegte.
Solche
Spindelbremsen
waren damals üblich. Dabei war die Kurbel dieser Lösung mit einer
Arretierung versehen worden. Dank dieser konnte die Kurbel auch im
gebremsten Zustand blockiert werden. Wegen dieser Arretierung konnte sich die
Bremse
nicht ungewollt lösen. Daher wurde diese Lösung angewendet, wenn die
Lokomotiven
bei einem längeren Aufenthalt gesichert werden musste. Die Regeln besagten
dazu, dass die Kurbel auf der Lokomotive arretiert werden musste, wenn das
Lokomotivpersonal
den
Führerstand
verlassen wollte. Das galt auch, wenn nur kurz die diversen
Gleitlager
frisch geschmiert wurden.
Ein Prinzip, bei dem bis heute nichts mehr
verändert wurde. Wobei neuste Lösungen sogar auf diese
Bremsge-stänge
verzichten, da es doch ein ansehnliches Gewicht aufweisen. Die eigentliche Bremse war einem gewissen Verschleiss unterworfen. Damit dadurch die Spindelbremse nicht plötzlich funktionslos wurde, konnte das Gestänge nach-gestellt werden. Dazu war ein Bremsgestängesteller vor-handen. Dieser
Gestängesteller
konnte jedoch nur in einer Werk-statt nachgestellt werden. Daher mussten
die Maschinen regelmässig in den Unterhalt um die
Bremsen
neu einzu-stellen. Trotzdem sollten die
Lokomotiven
nicht immer optimal bremsen. Wir sind damit bei der eigentlich Bremse angelangt. Bei dieser Lokomotive wurde eine damals übliche Klotz-bremse verbaut. Diese wirkte mit je einem Bremsklotz pro Rad auf die mittlere und die hintere Triebachse. Es waren daher insgesamt vier
Bremsklötze
vorhanden. Wegen dem
Stangenantrieb
wurde die vordere
Triebachse
auch abgebremst, denn durch die Stangen konnte diese nicht frei drehen und
so waren alle Triebachsen gebremst. Bei der
Klotzbremse
werden die
Bremsklötze
aus Grauguss gegen die
Lauffläche
gepresst. Durch die so entstehende Reibung, wurde das
Rad
an der freien Drehung gehindert. Da nun der Bremsklotz aus einem weicheren
Metall bestand, als die
Bandage,
erfolgte die Abnützung bei den
Bremssohlen. Der Abrieb fiel dabei als
Bremsstaub
an und die winzigen Metallteile konnten dabei durchaus glühend heiss sein. Bleibt nur noch die
Laufachse.
Bei dieser wurde keine
Bremse
verbaut. Damals war das so üblich und in der Schweiz sollte sich bei den
Lokomotiven
in diesem Punkt auch nicht mehr viel ändern. Laufachsen galten immer als
ungebremst und davon gab es auch hier keine Abweichung, zumal das mit
einem
Bremsgestänge
nicht so leicht umgesetzt werden konnte. Da war es durchaus sinnvoll, wenn
bei der
Achse
keine
Handbremse
vorhanden war.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
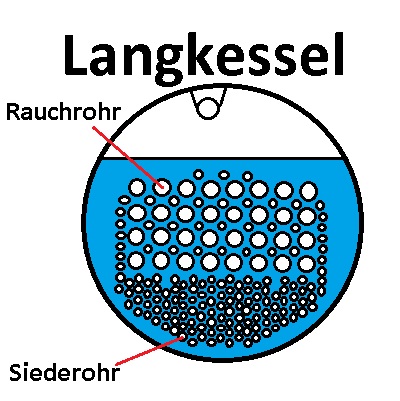 Die
Die
 So
war es leicht möglich, mit einem anderen Signal die Leute entlang der
So
war es leicht möglich, mit einem anderen Signal die Leute entlang der
 Als
diese
Als
diese
 An
der
An
der