|
Dampfmaschine, Steuerung und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Damit die
Dampfmaschinen
der
Lokomotiven
überhaupt ihre Arbeit aufnehmen konnten, musste der Dampf dem
Kessel
entnommen werden. Dazu war beim
Dampfdom
ein
Regulator
vorhanden. Wurde dieser geöffnet, strömte der Dampf vom Kessel zu den
Dampfmaschinen der Lokomotive. Anschliessend wurde er in die
Rauchkammer
geführt und dort über das
Blasrohr
entlassen. Wir haben damit eine klassische Dampfmaschine erhalten.
Bis hier waren alle
Lokomotiven
gleich, bei der weiteren Zuführung des Dampfes zu den einzelnen
Zylindern
gab es aber insbesondere bei den
Prototypen
grosse Unterschiede. Wobei auch die Serie im Bereich der
Dampfmaschinen
kaum einheitlich daher kommen sollte. Sie sehen, wir wenden uns nun einem
spannenden Teil der Lokomotive zu. Beginnen wir bei der Betrachtung der
Dampfmaschinen doch gleich bei der ersten.
Der in der Mitte angeordnete Hochdruckzylinder hatte einen Durchmesser von 440 mm und eine Hublänge von 600 mm erhalten.
Er wurde immer direkt vom
Regulator
über den
Schieberkasten
mit frischem
Nassdampf
aus dem
Kessel
versorgt. Der maximale Betriebsdruck lag daher bei 14
bar. Unter dem Umlaufblech waren die aussen ange-ordneten Niederdruckzylinder montiert worden. Sie hatten hingegen einen Durchmesser von 480 mm erhalten und waren für niederen Druck ausgelegt worden.
Der Kolbenhub blieb mit 600 mm jedoch gleich. Spannend war, dass
die
Schieberkästen
bei diesen
Lokomotiven
über dem Umlaufblech angeordnet wurden und es kein gemeinsames Gehäuse
gab. Das sollte bei diesen Maschinen jedoch grundsätzlich der Fall sein.
Die drei
Zylinder
der
Lokomotive
Nummer 201 wurden unterschiedlich mit Dampf versorgt. Das bedeutete, dass
die zweite
Dampfmaschine
umgeschaltet werden konnte.
Wurde die Lokomotive im
Flachland, also auf den flacheren Strecken mit hohen
Geschwindigkeiten eingesetzt, arbeiteten die
Zylinder
im
Verbund.
Dabei wurde der dem
Kessel
entnommene Frischdampf zuerst dem mittig angeordneten
Hochdruckzylinder
zugeführt.
Dessen Abdampf gelangte anschliessend über den Verbinder in die
beiden aussen liegenden
Niederdruckzylinder.
So wurde der Dampf zweimal zur Erzeugung der
Leistung
genutzt. Diese Lösung ermöglichte bei hohen Geschwindigkeiten eine
wirtschaftliche Ausnutzung des Dampfes. Durch die im Verhältnis kleinen
Niederdruckzylinder sank dabei jedoch die Leistung leicht, was jedoch
vernachlässigt werden konnte.
Für die Fahrt durch die steilen
Rampen
der
Bergstrecke
schaltete man die beiden äusseren
Zylinder
um. Die
Lokomotive
wurde nun zum klassischen Drilling und arbeitete auf alle drei Zylinder
mit Frischdampf ab dem
Kessel.
Sie arbeitete nun nicht mehr so wirtschaftlich, hatte jedoch eine merklich
höhere
Zugkraft
und konnte so die Steigungen des Gotthards und des Monte Ceneri besser
bewältigen. Der Regimewechsel erfolgte bei einem Halt.
Die Kurbelfolge der drei
Zylinder
betrug
dreimal 120° und ermöglichte so einen, auf eine Radumdrehung
gesehenen, gleichmässigen Kraftaufbau. Dadurch ergaben sich bei dieser
Lokomotive
pro Radumdrehung sechs Auspuffschläge. Diese Lokomotive konnte also nicht
nur optisch, sondern auch akustisch von der anderen Lokomotive dieser
beiden
Versuchslokomotiven
unterschieden werden. Der Wechsel des Regimes führte zu keinen
Unterschieden.
Bei der zweiten
Versuchslokomotive,
also der
Lokomotive
mit der Nummer 202, wurde eine andere Lösung gewählt. Ihre
Dampfmaschine
bestand aus vier
Zylindern,
die ausschliesslich im
Verbund
arbeiteten. Es fand also bei dieser Lokomotive keine Umschaltung und somit
keine Unterteilung zwischen
Flachland und
Bergstrecke
statt. Das machte vor allen den Aufbau der Dampfmaschine wesentlich
einfacher.
Die beiden aussen liegenden
Niederdruckzylinder
hatten jedoch eine Bohrung von 530 mm Durchmesser bei gleichem Hub des
Kolbens
erhalten. Bei dieser Lokomotive wurde der Dampf zuerst in den beiden Hochdruckzylindern von 14 bar auf ca. fünf bar entspannt und über den Verbinder, der dieser Bauart den Namen gab, den Niederdruckzylindern zugeführt.
Auf diese Weise gelang es, grosse Dampfmengen zu beherrschen, die
Spannkraft des Dampfes besser auszunutzen und durch die Vermehrung der
Zahl der
Kolben
die Laufruhe der
Dampfmaschine
und somit der
Lokomotive
zu verbessern.
Für schwere Anfahrten in Steigungen und zum Steigern der
Leistung
auf kurzen Streckenabschnitten konnte mit Hilfe eines Wechselventils auch
den beiden aussen montierten
Niederdruckzylindern
Frischdampf zugeführt werden. Dabei war die Anwendung wirklich nur auf
kurze Zeit befristet und nicht für die dauernde Steigerung der
Zugkraft
gedacht. Man könnte diese Schaltung mit modernen Worten als eine Art
Booster
bezeichnen.
Der Versatz der
Zylinder
betrug bei diesen
Lokomotiven
135°. Zusätzlich wurden die beiden Antriebsseiten um 90° versetzt
angeordnet. Das ergab daher auch eine Änderung bei den hörbaren
Auspuffschlägen, die nun aus acht Schlägen pro Radumdrehung bestanden.
Somit konnte diese
Versuchslokomotiven
akustisch von ihrer Schwester unterschieden werden und vermittelte den
Eindruck, gegenüber der anderen Maschine, schneller zu fahren.
Trotz den Unterschieden bei den Durchmessern und der Anzahl der
Zylinder
wurde die
Leistung
der beiden
Prototypen
gleich hoch angegeben. So erzeugten diese
Dampfmaschinen
bei einer Leistung von 1 100 PS eine maximale
Zugkraft
von 66 kN. Damit lag die Zugkraft ungefähr bei der Baureihe C3t. Jedoch
konnten nun auch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, was sich bei
der höheren Leistung der Dampfmaschinen auswirkte.
Nach eingehenden Versuchen mit den beiden
Prototypen
fiel der Entscheid zugunsten der mit vier
Zylindern
ausgerüsteten Maschine mit Verbundantrieb. Dieser Entscheid wurde gefällt,
weil die
Lokomotive
ausgeglichener war und dadurch das Kurbeltriebwerk weniger stark
beansprucht wurde. Die Maschine konnte dank der besseren Dampfnutzung auch
am Berg wirtschaftlicher arbeiten, als die Schwester mit der Nummer 201.
Nicht verändert wurde jedoch der Kolbenhub, der ebenfalls bei 600
mm lag. Damit haben wir aber schon alle Gemein-samkeiten der Baureihe
kennen gelernt. Der Grund waren die
Niederdruckzylinder,
die immer wieder verändert wurden. Bei der ersten Serie mit den Nummern 203 bis 210 kamen Niederdruckzylinder mit einem Durchmesser von 570 mm zur Anwendung. Dadurch konnte die Zugkraft gegenüber den Prototypen auf 72 kN erhöht werden.
Letztlich wirkte sich das auch dank dem etwas höheren Dampfdruck
auf die
Leistung
aus. Sie sehen, dass die Durchmesser der
Zylinder
einen direkten Einfluss auf die Leistung hatten. Das wurde bei den
weiteren
Lokomotiven
berücksichtigt.
Die Nummern 211 bis 220 wurden mit
Niederdruckzylindern,
die einen Durchmesser von 590 mm erhalten hatten, ausgerüstet. Dadurch
stieg die
Zugkraft
auf 74 kN an. Bei den restlichen Maschinen wurde der Durchmesser noch
einmal gesteigert und erreichte nun einen Wert von 600 mm. Bei der
Leistung
wurden für die Nummern 221 bis 224 76 kN angegeben. Die zuletzt gebauten
Lokomotiven
hatten schliesslich sogar eine Zugkraft von 78 kN erhalten.
Auf die erlaubte Geschwindigkeit hochgerechnet entsprach das
ungefähr einer
Leistung
von 1 400 PS. Die anderen
Lokomotiven
siedelten sich irgendwo in der Mitte zu den
Prototypen
an. Hier lohnt sich erneut ein Vergleich und nun rückt plötzlich die D4t,
als die schwere Güterlokomotive in den Fokus. Diese hatte mit 84 kN nur
eine unwesentlich höhere
Zugkraft
erhalten. Deutlicher kann man die Steigerung nicht erkennen.
Bei den Dampflokomotiven in jener Zeit, hatte sich diese Steuerung
durch-gesetzt. Wobei in grossen Teilen von Europa dabei auch von der
Heusinger-steuerung
gesprochen wurde. Die
Gotthardbahn benutzte jedoch die
Wal-schaertssteuerung. Es war eine sehr gut arbeitende Steuerung, die auch den Vorschub der Schieber leicht und sehr genau regeln konnte. Bei den Maschinen der Baureihe A3t, beziehungsweise A 3/5, wurde bis und mit der Nummern 224 für jeden Zylinder eine eigene Steuerung eingebaut.
Die restlichen
Lokomotiven
wurden vereinfacht und hatten dann nur noch zwei
Steuerungen, die über Querwellen auch die inneren
Hochdruckzylinder
ansteuerten. Die Umsteuerung der Dampfzylinder, also die Regelung der Füllzeiten und der Fahrrichtung, erfolgte bei der Drillingsmaschine mit der Nummer 201 mittels zwei gekuppelter Steuerwellen.
Die restlichen
Lokomotiven
erhielten jedoch getrennte Umsteuerungen für die Niederdruck- und die
Hochdruckzylinder.
So konnten diese bei den
Füllzeiten
und somit bei den
Dampfmaschinen
optimaler eingestellt werden.
Wir kommen nun zum
Antrieb.
Dabei wurden die
Hochdruckzylinder
mit einer Neigung von 1:20 im Rahmen montiert.
Sie wurden auch weit unter die
Rauchkammer
geschoben und arbeiteten über die
Kreuzköpfe
auf die erste der gekuppelten
Achsen.
Damit die Kurbel ermöglicht wurden, mussten diese Achsen gekröpft
ausgeführt werden. Eine Lösung, die bei Maschinen mit mehr als zwei
Zylindern
immer nötig war.
Sie lagen hinter dem
Laufdrehgestell
und wirkten auf die zweite
Triebachse.
Diese Anordnung entsprach der modifizierten
Bauart
De-Glehn. Der Vorteil sah man bei den unterschiedlichen Angriffspunkten
der Kraft.
Bei den aussen liegenden
Antrieben
wurde die Bewegung der
Kolbenstange
auf ein doppelt geführtes
Kreuzgelenk
geführt und dort die
Schubstange
zur erwähnten zweiten
Triebachse
und dem dort vorhandenen
Kurbelzapfen
geführt. In der Triebachse wurde die linear Bewegung letztlich mit Hilfe
der
Haftreibung
gegenüber den
Schienen
in
Zugkraft
umgewandelt. Die Bewegung für die Steuerung wurde dabei beim Kreuzgelenk
und beim Kurbelzapfen abgenommen.
Sämtliche anderen
Triebachsen
wurden anschliessend mit waagerecht verlaufenden
Kuppelstangen
verbunden. Das führte dazu, dass die angetriebenen
Achsen
eins und zwei miteinander verbunden wurden und so sich die Kraft der
Dampfmaschinen
vereinigte. Letztlich wurde nur die dritte Triebachse ausschliesslich über
die Kuppelstange mit der zweiten Triebachse verbunden. Es handelte sich
dabei und eine Lösung, die auch bei anderen Maschinen der Baureihe A 3/5
verwendet wurde.
Sämtliche
Gelenke
des
Stangenantriebes
waren als
Gleitlager
ausgeführt worden und sie wurden mit
Öl
geschmiert. Es kamen dabei Nadellager zur Anwendung. Diese mussten bei den
aussen liegenden
Antrieben
vor Ort kontrolliert und allenfalls das
Schmiermittel
ergänzt werden. Die innen liegenden Antriebe waren jedoch an der zentralen
Schmiervorrichtung für die
Achslager
angeschlossen worden.
Um die Reibungswerte der
Lokomotive
bei schweren Anfahrten und bei schlechtem Schienenzustand und bei grosser
Zugkraft
zu verbessern war eine auf die erste und zweite
Triebachse
wirkende
Sandstreueinrichtung
vorhanden. Der dazu benötigte Sandkasten wurde dabei über dem
Kessel
hinter dem
Dampfdom
montiert. Von dort wurde schliesslich der Sand über Rohre vor die
entsprechenden
Achsen
geleitet und dort auf die
Schienen
gestreut.
Bedient wurde die
Sandstreueinrichtung
durch das
Lokomotivpersonal.
Sie wurde daher nur bei Bedarf angewendet. Wobei gesagt werden muss, dass
bei
Dampfmaschinen
sehr oft gesandet werden musste, da gerade bei Anfahrten das
Gleis
durch die geöffneten
Schlemmhähne
benetzt wurde. Die
Lokomotive
sorgte daher oft selber für den schlechten Schienenzustand, daher
überrascht es kaum, dass ein grosser Behälter montiert wurde.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
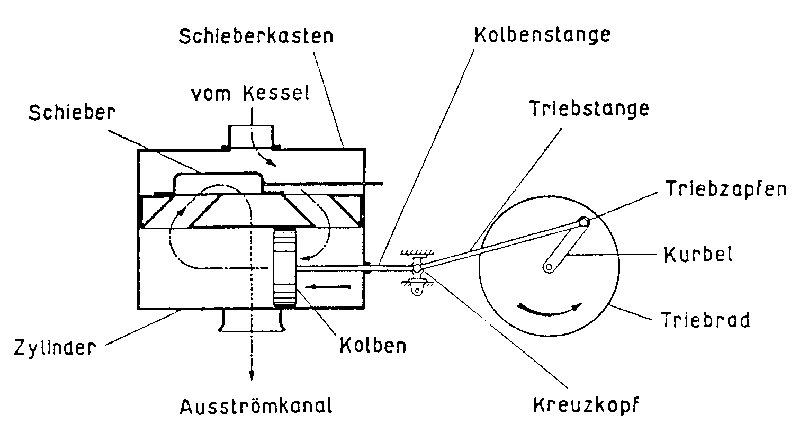 Die
im Aufbau komplizierteste Maschine war die
Die
im Aufbau komplizierteste Maschine war die
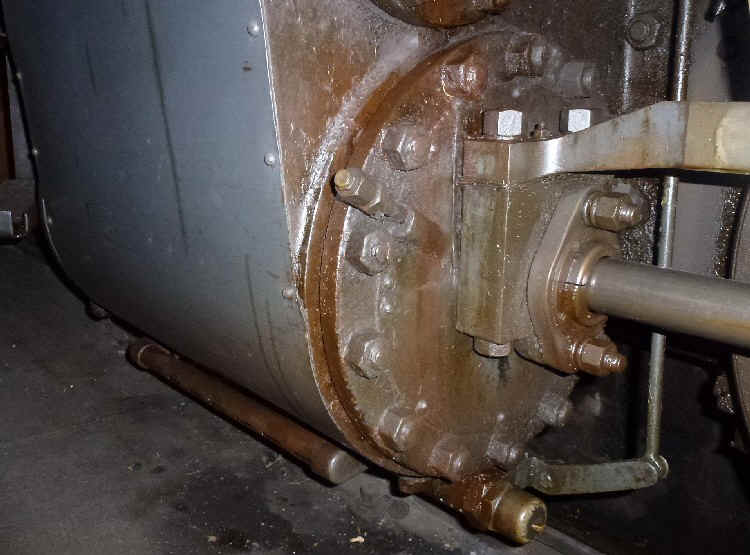 Die
beiden
Die
beiden
 Die
Die  Bei
den
Bei
den
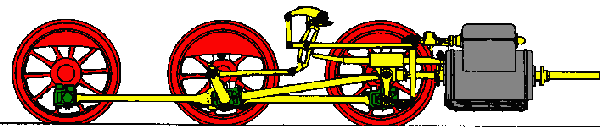 Die
Die