|
Laufwerk und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie bei Baureihen mit
Lokomotivbrücke
üblich, bestand das
Laufwerk
aus zwei unter diesem Rahmen eingebauten
Drehgestellen. Vom Aufbau her gab es zwischen den
beiden Drehgestellen jedoch keinen grossen Unterschied. Wir können uns
daher auf die Betrachtung eines Gestells beschränken. Unterschiede, die
vorhanden waren, werden natürlich erwähnt. Meine Wahl fiel auf das vordere
Modell und die beiden darin verbauten
Achsen.
Dabei kamen gerade in diesem Bereich genaue
Mas-se zur Anwendung. Besonders bei den
Rädern
war die Toleranz sehr gering, da diese auf der Welle mit der
Schrumpftechnik montiert wurden. Eine gäng-ige Bauweise. Aufgeschrumpft wurden zwei identische Räder, die als Monoblocräder aufgebaut wurden. Bei dieser Bauform bildeten sowohl der Spurkranz, als auch die Lauffläche mit einem Radkörper ein gemein-sames Bauteil. Es war daher kein
Radreifen
mehr als Verschleiss-teil vorhanden. Das abgenützte
Rad,
das als Vollrad
ausgeführt wurde, musste daher komplett ausge-wechselt werden. Eine
Bauform, die leichte und billige
Radsätze
erlaubte. Der neue fertig aufgebaute
Radsatz
hatte einen Durchmesser von 1 100 mm erhalten. Damit ent-sprachen diese
Räder
den Modellen, wie sie schon bei der Baureihe Re 460
verwendet wurden. So konnte die Vorhaltung von speziellen Radscheiben
vermieden werden. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB konnte so von einer
geringeren Ausnützung der Lagerflächen profitieren. Ein Punkt, auf den
beim Bau von
Lokomotiven immer wieder geachtet wurde. Um die
Achse
abzuschliessen, müssen wir uns noch die
Lager
ansehen. Diese waren hier als aussenliegende Modelle ausgeführt worden.
Das ergab eine seitlich grosse Stabilität. Besonders im Baudienst mit
provisorisch verlegten
Geleisen
ein Vorteil. Auch bei der Wartung achtete man auf einen geringen Aufwand.
Wobei gerade bei den Lagern nicht mehr viel gemacht werden konnte, da sich
hier seit Jahren die
Rollenlager
durchsetzen konnten.
Die mit solchen Ausführungen versehene
Achsen
konnten daher problemlos bis zur anstehenden
Re-vision
der
Laufwerke
verwendet werden. Sie sehen, dass hier kaum eine weitere Optimierung der
Fahr-werke
vorgenommen werden konnte. Positioniert wurden die beiden in einem Drehgestell verbauten Achswellen in einem Abstand von 2 300 mm. Damit war ein sehr kurzer Abstand der Achsen vorhanden. Das ergab sowohl Vorteile bei engen Kurven, als auch bei den Baustellen mit nur unzureichend verlegten Gleisen. Gerade dieser Punkt war im Baudienst
wichtig und daher musste die
Federung
auf diese Begebenheiten Rücksicht nehmen. Ein Merkmal, das schon das
Muster hatte. Für die primäre Federung wurden seitlichen von jedem Lager am Schenkel der Lagergehäuse einfache Schraubenfedern verbaut. Diese Federn wirkten auf den Drehgestellrahmen. Da diese Federn über eine sehr kurze Schwingungs-dauer verfügten, mussten sie mit zusätzlichen Däm-pfern versehen werden. Hier verwendete man dazu hydraulische
Dämpfer,
die sich schon vor Jahren an der Stelle von mechanischen Lösungen
durchsetzen konnten. Diese
Dämpfer
waren jedoch nicht bei den
Schraubenfedern
eingebaut worden, sondern sie wurden zwischen dem
Achslager
und dem
Drehgestell
an separaten Supporten montiert. Die Bestimmung der Position übernahmen
die waagerecht zwischen
Lager
und
Drehgestellrahmen
eingebauten Achslagerführungen. Diese waren starr ausgeführt worden und
erlaubten keine radiale Einstellung der
Achsen,
was jedoch wegen dem kurzen
Radstand
nicht nötig war.
Wegen den hier auftretenden hohen Kräften,
musste der Rahmen punktuell verstärkt ausgeführt werden. Diese
Verstärkungen erforderten eine sorgfältige Fertigung der
Drehgestelle. Gefertigt wurden die Drehgestelle der Baureihe Am 841 jedoch nicht beim Hersteller in Spanien. Diese wurden in der Schweiz bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur gebaut und anschliessend nach Spanien geliefert. Somit erfolgte zumindest in diesem Bereich
eine Wertschöpfung aus der Schweiz. So konnten die immer noch
aufgebrachten
Gewerkschaften
etwas beruhigt werden, da die einheimische Industrie mitarbeiten konnte. Der einfach aufgebaute Drehgestellrahmen bildete ein offenes H und bestand aus den beiden Längs-trägern und dem in der Mitte angeordneten kräfti-gen Querträger. Stirnseitige Träger, die den Rahmen im
Bereich der
Achsen
etwas stabilisiert hätten, gab es jedoch nicht. Deshalb mussten die
Längsträger im Bereich des Querträgers verstärkt werden. Das führte jedoch
zu einem ungewöhnlich aussehenden, aber sehr funktionalen
Drehgestell. Der massive Querträger nahm den
Drehzapfen
auf. Dieser diente zur Bestimmung des Drehpunktes und übertrug die
Zugkräfte
auf den Rahmen. Dabei wurde der Zapfen am
Drehgestell montiert. Er griff so in einen am Querträger
der
Lokomotivbrücke
eingelassenen Support. Es war daher ein fester Drehpunkt vorhanden, der es
dem Drehgestell jedoch erlaubte, sich in allen Richtungen im Winkel
gegenüber der Lokomotivbrücke zu verändern.
Der Vorteil lag dabei bei der
Schmierung.
Hier wurde deutlich weniger
Schmiermittel
benötigt, was in Anbetracht der verschärften Umweltvorschriften in Bezug
auf den Ver-lust von Schmierstoffen ein Vorteil war. Um die seitliche Stabilität der Abstützung zu verbessern, wurden am Drehgestell spezielle Supporte angeschweisst. Daher war eine sehr breit ausgelegte Abstützung vorhan-den. Ein wichtiger Punkt bei im Baudienst eingesetzt Lokomotiven. Diese verkehrten oft auf nur schlecht
verlegten
Geleisen
und neigten daher immer wieder dazu, seitlich zu kippen, was zu einer
Entgleisung
führen konnte. Ein Punkt der klar zeigt, dass der Hersteller mit dem
Muster viel Erfahrung gesam-melt hatte. Auch die
Lokomotivbrücke
war gegenüber dem
Drehgestell abgefedert worden. Dabei kamen für die
Sekundärfederung
spezielle
Schraubenfedern
zur Anwendung. Da der Aufbau die sekundären
Federn
auf Torsion beanspruchte, mussten für diese zweite Federstufe die dazu
geeigneten
Flexicoilfedern
verbaut werden. Diese liessen die Winkeländerungen des Drehgestells
gegenüber der Lokomotivbrücke zu, ohne dass sie dabei beschädigt wurden. Wie die
Schraubenfedern
der
Achsen
verfügen auch die
Flexicoilfedern
über eine sehr kurze Schwingungsdauer. Aus diesem Grund musste auch hier
eine Dämpfung vorgesehen werden. Auch jetzt kamen hydraulische
Dämpfer
zur Anwendung. Diese wurden zwischen dem
Drehgestellrahmen
und dem Querträger der
Lokomotivbrücke
eingebaut. Daher mussten auch sie sich den veränderten Winkeln anpassen
können, was bei dieser Bauform kein Problem war.
Die Gefahr von
Entgleisungen
konnte reduziert wer-den. Wir können nun aber erneut zum Messband greifen
und die Höhe bestimmen. Diese betrug 4 275 mm und wurde ohne die Antennen
gemessen. Es wird daher Zeit, dass wir aus den Achsen, die vier Triebachsen der Lokomotive machen. Wie wir aus der Achsfolge entnehmen können, besass die Diesellokomotive für jede Achse einen eigenen Fahrmotor. Da auch hier keine Unterschiede gemacht
wurden, können wir uns auf die Betrachtung einer
Achse
beschränken. Welche das ist, spielt keine so grosse Rolle. Meine Wahl fiel
auf die
Triebachse eins, auch wenn es die vierte hätte sein können. Jede
Achse
wurde mit einem eigenen
Fahrmotor
versehen. Dieser stützte sich auf die
Triebachse ab und war mit elastischen Elementen am
Drehgestellrahmen
montiert worden. Dieser Aufbau war als
Tatzlagerantrieb
bekannt geworden. Die
Tatzlagertechnik
konnte hier problemlos verwendet werden, da sich die verlangte
Höchstgeschwindigkeit
bei 80 km/h befand. In Fachkreisen galt dieser Wert als das Maximum für
diese
Antriebe. Da es sich bei der Baureihe Am 841 um die
letzte
Diesellokomotive
mit elektrischen Motoren handelte, kann gesagt werden, dass nahezu
sämtlichen Dieselmaschinen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit diesen
Motoren ausgerüstet wurden. Der Vorteil des
Tatzlagerantriebes
lag bei der einfachen Konstruktion und beim damit sehr geringen Aufwand.
Das half auch die Kosten für die
Lokomotive etwas zu senken, was dem Kunden gefiel.
Das war bei den oft befahrenen nicht
optimal verlegten und noch nicht geschliffenen
Schienen
ein Vorteil. Es zeigte sich auch hier, dass das Muster bereits in diesem
Bereich eingesetzt wurde. Das im elektrischen Fahrmotor erzeugte Drehmoment wurde mit einem Getriebe auf die Achse übertragen. Dieses hatte die Aufgabe, die Drehzahl der Triebachse an jene des Motors anzupassen. Somit hatte das schräg verzahnte
Getriebe
eine
Übersetzung
von
1 :
6.3125 erhalten. Die Veränderung der Drehzahl hatte jedoch bei
unverändertem
Drehmoment
auch eine Auswirkung auf die an der
Achse
erzeugte
Zugkraft.
Diese werden wir uns jedoch später noch ansehen. Das
Getriebe
war in einem geschlossenen Gehäuse montiert worden und wurde mit
handelsüblichem
Öl
geschmiert. Das Schmieröl lagerte an der tiefsten Stelle in einer im
Gehäuse integrierten
Ölwanne.
Das grosse
Zahnrad
lief dabei durch dieses Ölbad und nahm damit das
Schmiermittel
auf. So wurde das Öl auf das Ritzel übertragen. Durch die Fliehkraft wurde
das Schmiermittel an die Wände geschleudert und lief anschliessend wieder
in die Wanne. In den beiden
Rädern
wurde das
Drehmoment
der
Fahrmotoren
mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen
Lauffläche
und
Schiene
in
Zugkraft
umgewandelt. Die so erzeugte Kraft wurde über die
Achslager
und deren Führung auf den Rahmen des
Drehgestells übertragen. Im
Drehgestellrahmen
wurden schliesslich die Zugkräfte der beiden
Achsen
gebündelt. Es war deshalb in diesem Bereich eine übliche Bauweise
vorhanden. Diese hatte jedoch den Nachteil, dass das
Drehgestell dazu neigt, zu kippen. Dieser unerwünschte
Kippeffekt des
Triebdrehgestelles
konnte jedoch mit den waagerecht verbauten Achslagerführungen gemildert
werden. Das hatte zudem den Vorteil, dass die Längsträger im Bereich der
Achsen
vom Kraftfluss entbunden wurden. Diese konnten daher schwächer ausgeführt
werden. Was beim verfügbaren Platz im Bereich der
Lager
ein grosser Vorteil war. Die Kraftübertragung vom
Drehgestell auf die
Lokomotive erfolgte schliesslich über den
Drehzapfen.
Dabei waren jedoch keine weiteren Massnahmen vorhanden, die der Entlastung
der ersten
Achse
entgegengewirkt hätten. Eine
Tiefzugvorrichtung
gab es daher nicht. So entstand eine einfache Kraftübertragung, die
ausschliesslich über den Drehzapfen erfolgte. Schliesslich wurde die Kraft
der beiden Drehgestelle in der
Lokomotivbrücke
vereinigt und den
Zugvorrichtungen
zugeführt. Besonders bei schlechtem Zustand der
Schienen
konnte die
Zugkraft
jedoch die
Adhäsion
überragen. Gerade bei neuen rostigen Schienen ein grosses Problem. Daher
wurde das
Laufwerk
der
Lokomotive mit
Sandstreueinrichtungen
ergänzt. Diese wirkten in jedem
Drehgestell immer auf die vorlaufende
Achse
und wirkte vor deren
Rädern.
Somit waren insgesamt acht Sanderrohre vorhanden. Es war deshalb eine
umfangreiche Anlage vorhanden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Eingebaut
wurden normale
Eingebaut
wurden normale
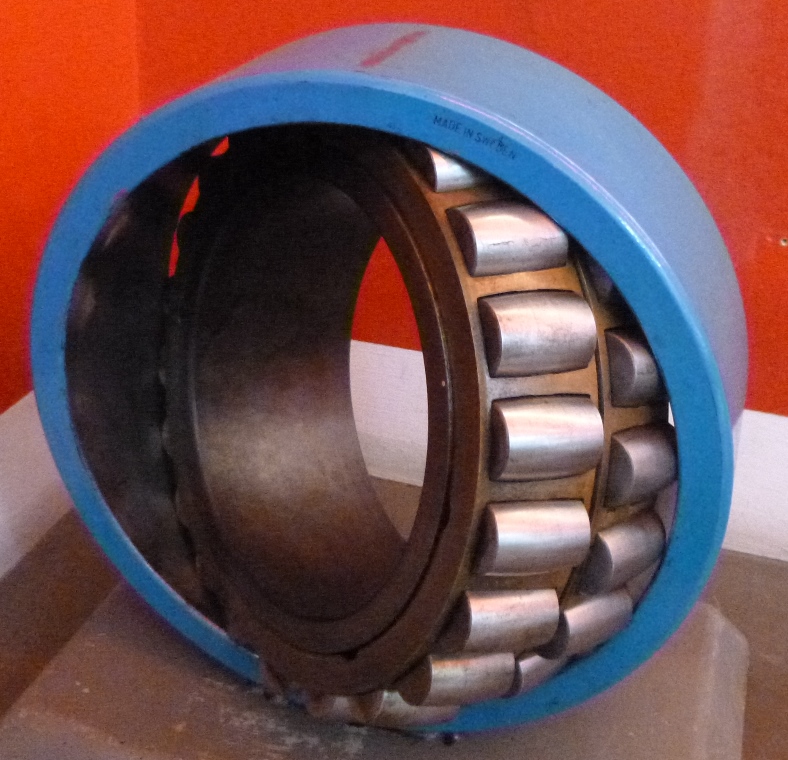 Die
doppelreihigen
Die
doppelreihigen
 Damit
kommen wir zum
Damit
kommen wir zum
 Abgestützt
wurde die
Abgestützt
wurde die
 Zum
Schluss muss noch erwähnt werden, dass die
Zum
Schluss muss noch erwähnt werden, dass die
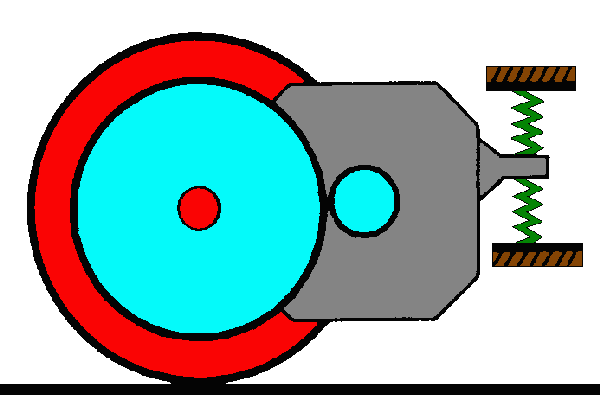 Um
die
Um
die