|
Schlussworte |
|||
| Navigation durch das Thema |
|
||
|
Wie war das nochmal. Der Schweizer Lokführer erklärte bei einem Treffen einem Kollegen aus Deutschland sehr zur Verwunderung der anderen Gäste, dass in der Schweiz selbst die Diesellokomotiven elektisch seien. Die hier vorgestellte Lokomotive war nur so zu ermöglichen und das obwohl man auf dem restlichen Kontinent fast ausschliesslich auf hydraulische Lösungen setzte. Wenn wir an die Eisenbahnen in der Schweiz
denken, meinen wir oft, dass diese elektrisch betrieben werden und somit
hier keine thermischen
Lokomotiven existieren. Das ist eine direkte Folge der
umfassenden Elektrifizierung. Die letztlich mit 99.9 % nahezu das ganze
Netz umfasste. Ausser Museumsbahnen, war da nur noch die Bahn von Brienz
auf das Rothorn. Dort fuhr man jedoch in erster Linie mit
Dampfmaschinen.
Deren Ausfall sorgt dafür, dass man immer
wieder zu
Lokomotiven greifen muss, die auch ohne
Fahrleitung
fahren können. Blickte man mit offenen Augen durch die
Bahnhöfe
erkannte man schnell mal eine Dampflokomotive, die irgendwelche Wagen
verschob und sich so nützlich machte. Diese rauchenden Relikte aus vergangenen
Tagen hatten sogar noch Strecken, die sie ausschliesslich bedienten. Die
elektrischen Eisenbahnen der Schweiz waren damals noch sehr weit entfernt,
doch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB wollten diese Dampflokomotiven
loswerden. Sie passten nicht zum Bild der modernen Eisenbahn. Dazu musste
aber passender Ersatz beschafft werden, dieser Ersatz sollte mit
Diesellokomotiven
bewerkstelligt werden. Man wusste aber sehr genau, dass man die
Vielzahl dieser
Lokomotiven sehr gering halten wollte. Die elektrischen
Lokomotiven hatten den Vorrang und nur dort, wo es nicht anders ging,
sollte eine Diesellokomotive
verwendet werden. Die Idee mit drei unterschiedlichen Klassen war schon
bald revolutionär und könnte in der heutigen Zeit ablaufen, aber die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB planten 1950 schon so und sie waren damit
sehr gut gefahren. Dabei war die
Lokomotive für den schweren
Rangierdienst
die erste, die abgeliefert wurde. Damit hatte die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB jedoch auch gleich ein internationales Zeichen gesetzt.
Die Maschine verfügte über zwei
Dieselmotoren.
Das war eigentlich keine besondere Sache, hätte man nicht eine Regelung
eingebaut, die es erlaubte einen Motor einfach auszuschalten und, sofern
er benötigt wurde, ihn wieder zu starten.
Ähnliche Lösungen gab und gibt es auch in
den USA und dort werden heute Diesellokomotiven
gebaut, die über vier kleine
Dieselmotoren
ver-fügen. Powerpacks, die zu- oder abgeschaltet werden können. Die Lokomotive arbeitete damit und trotz der grossen Leistung, verkehrte sie recht sparsam, denn wenn nur ein Motor arbeitet, verbraucht der andere keinen Treibstoff. Der Verbrauch sank auf den Wert einer mit-telklassigen Lokomotive und war daher für die Grösse der Lokomotive sehr gering ausge--fallen. Auch hier war die Bm 6/6 sicherlich eine
gute bis sehr gute
Lokomotive geworden. Die Er-bauer hatten gute Arbeit
geleistet. Dazu brauchte es nicht einmal strenge
Umweltvorschriften. Man wollte weniger Energie verbrauchen, also suchte
man eine Lösung. Man war lediglich bei zwei
Dieselmotoren.
Je mehr, desto besser hätte man die Maschine anpassen können. So gesehen,
kann man diese
Lokomotive als kleines Wunderwerk sehen. Die Bm 6/6 konnte
sich damit sicherlich bei vielen internationalen Ausstellungen den
Bewunderern stellen. Nur dazu kam es nicht, wenn die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB dort eine
Lokomotive zeigen konnten, war es sicher nicht ein
innovativer
Diesel,
sondern der neuste Schrei einer elektrischen Lokomotive. So blieb die
Diesellokomotive
immer im Schatten der elektrischen Maschinen. Verdient hatte sie es
sicherlich nicht, aber es war in der Schweiz das Schicksal von
Diesellokomotiven zudem hatte sie noch mit interner Konkurrenz zu kämpfen. Die Baureihe hatte einen grossen Nachteil.
Sie machte relativ lautstark auf sich aufmerksam. Die zur Verbesserung
montierten
Schalldämpfer
reichten schlicht nicht aus, denn dazu waren sie zu klein. So röhrten die
Lokomotiven durch die
Bahnhöfe
und verbreiteten ihren eigenartigen Geruch. Nur das war ein Problem, das
nicht den Einsatz verhinderte. Es war die Maschine selber, die nicht
vollständig fertig konstruiert wurde.
Dieser Vorteil hatte die kleinere Bm
4/4, so dass die Kleine besser ein-gesetzt werden konnte und so
der Grossen den Rang ablief. Sie wurde und nicht die grosse Schwester zum
Star auf Schweizer
Schienen. Das war ein
Dämpfer
für die gute
Diesellokomotive.
Sie hatte im eigenen Stall eine gleichaltrige Konkurrentin und die war
doch noch ein bisschen besser. Die Bm 6/6 konnte nur noch mit der
Leistung
und vor allem mit der Anpassung dieser Leistung trumpfen. Arbeitete man
mit einem Motor, verbrauchte die Bm 6/6 in der Stunde weniger
Treibstoff
als die Bm 4/4. Das war
einzigartig, denn bei einer nominalen Leistung von 1 300 PS erwartete man
einen viel höheren Verbrauch. So kam es, dass die Bm 6/6 immer ein wenig
im Schatten der
Bm 4/4 war. So konnte sie sich
keinen Namen machen, denn die grosse Verbreitung fand die
Bm 4/4. Man kannte die Bm 6/6 im Raum Basel, in Chiasso und an
einer Strecke in der Ostschweiz. Mehr war nicht, die Einsätze bei Umbauten
von Strecken oder ähnlichem blieben aus, da kam dann... eben die andere
zum Einsatz. Ein schweres Schicksal, dass die gute
Lokomotive zu tragen hatte. So überraschte es auch nicht, als die
Lokomotive verschwand, dass man bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB kaum grossen Wind um die
Ausrangierung
machte. Die Bm 6/6 verschwanden von der Bildfläche ohne grossen Lärm zu
machen. Die verantwortlichen Stellen mussten sich entscheiden und da war
die Bm
4/4 erneut besser geeignet, als die grosse Bm 6/6, die zwar sehr
viele Neuerungen brachte, aber immer nach der kleineren Bm 4/4
genannt wurde. So könnte man, wenn man einen Nachruf
erstellen müsste, von der
Lokomotive sprechen, die viele verblüffende Lösungen hatte
und die immer ihrer Arbeit gewachsen war. Nur sie stand in ihrem ganzen
Leben immer im Schatten einer anderen
Diesellokomotive.
Wir werden die Bm 6/6 sicher nicht vergessen, aber vermissen werden wir
sie auch nicht gross, denn wir hatten ja... genau die Bm 4/4.
Umso schöner ist es deshalb, dass eine Bm 6/6 erhalten blieb.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
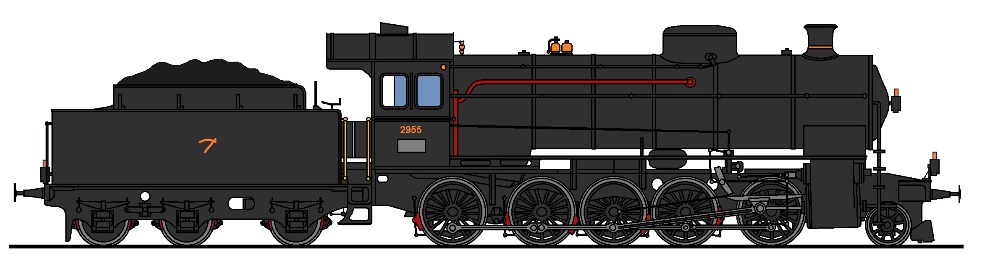 1950
war die Situation je-doch etwas anders und so ist es eigentlich auch heute
noch. Es gibt Abschnitte, wo schlicht keine
1950
war die Situation je-doch etwas anders und so ist es eigentlich auch heute
noch. Es gibt Abschnitte, wo schlicht keine
 Die
Die
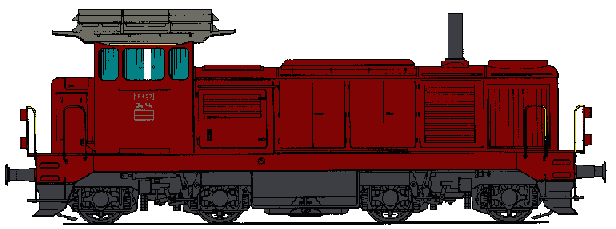 Die
Bm 6/6 hatte, wie man dann nach Erhalt der Baureihe
Die
Bm 6/6 hatte, wie man dann nach Erhalt der Baureihe