|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Kommen wir zum
Fahrwerk.
Wie die Typenbezeichnung bereits erkennen lässt, waren bei diesem Fahrzeug
nicht alle
Achsen
angetrieben. Das war ein Markenzeichen der Leichttriebwagen und verhalf
diesen auch zum geringen Gewicht. Doch mit der Lesart der Schweiz lässt
sich kaum herausfinden, welche der acht Achsen denn nun angetrieben war.
Was wir wissen, dass es deren vier waren, aber die Position fehlt uns
noch.
Dabei war vermutlich für die meisten Leser die grosse
Überraschung, dass sich die
Triebdrehgestelle
nicht im Bereich der
Vorbauten
befanden. Jedoch war das schon bei der Baureihe
Re 2/4 so ausgeführt worden. Auch
hier lag es bei den
Achslasten.
Bei der Aufschlüsselung der
Achsfolge
fallen die Striche auf. Daher waren die
Achsen
grundsätzlich in
Drehgestellen eingebaut worden. Wenn man solche verwendet,
müssen diese über einen eigenen Rahmen verfügen. Dabei sind hier durchaus
andere Bedingungen vorhanden, als das beim Kasten der Fall war. Es lohnt
sich, wenn wir etwas genauer hinsehen und dazu müssen wir die Schürzen
entfernen, denn nur so war das
Laufwerk
erkennbar.
Verwendet wurde ein kastenförmiger Rahmen aus Stahlblech, das
verschweisst wurde. Dank dem Hohlträger, konnte sehr viel Gewicht
eingespart werden und das war die Idee bei den Leichttriebwagen. Zudem
wurde der
Drehgestellrahmen
noch gekröpft ausgeführt. Das hatte den Vorteil, dass der Fussboden
gesenkt werden konnte. Bei den angetriebenen Varianten, boten sich so noch
zusätzliche Vorteile bei der Übertragung der
Zugkraft.
Der so entstandene Rahmen war leicht und wurde schon bei den
Triebwagen
der Baureihe
Re 2/4 verwendet. Die bei
der Baureihe Re 8/12 gemachten
guten Erfahrungen bei hohen Geschwindigkeiten erübrigten eine neue
Entwicklung. Dabei erinnern wir uns, dass mit dem
Triebzug
eine Geschwindigkeit von nahezu 200 km/h gefahren wurde. Ein Zeugnis für
das
Fahrwerk,
das rechtfertigte, dass es auch hier verwendet wurde.
Auf der Achse selber wurden schliesslich die Sitze für die Räder und die Lager mit Hilfe von Drehvor-richtungen ausgebildet.
Bevor wir uns den
Achslagern
zuwenden, müssen wir aber noch die
Räder
montierten, denn die konnten nachträglich nicht mehr eingebaut werden. Bei den beiden auf der Achse aufgeschrumpften Rä-dern, handelte es sich um die gleichen Modelle, wie sie schon bei der Baureihe Re 8/12 verwendet wurden.
Das half sicherlich in diesem Bereich die Lagerung von speziellen
Ersatzteilen zu vermeiden. Ein Punkt, den die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB sicher-lich gewünscht hatten, denn so ein exotisches
Triebfahrzeug
sollte nicht noch bei den Ersatzteilen für ein Chaos sorgen.
Sowohl der
Radkörper,
als auch die
Lauffläche
mit
Spurkranz
waren bei diesen
Monoblocrädern
in einem Guss erstellt und anschliessend bearbeitet worden. Dadurch fielen
einige Bauteile weg, was das
Scheibenrad
insgesamt leichter werden liess. Da zudem der Durchmesser auf 900 mm
reduziert wurde, entstanden leichte
Achsen.
Bisher waren die bei den Wagen gemachten Erfahrungen mit diesen
Rädern
sehr gut.
In jedem
Drehgestell wurden zwei solche
Achsen
eingebaut. Sie hatten dabei einen Abstand von 2 700 mm erhalten, was der
Lösung bei den Leichttriebwagen entsprach. In der Position gehalten wurden
die beiden Achsen mit den am Achslagergehäuse angebrachten Führungen. Eine
Querfederung, oder gar eine radiale Einstellung in den
Kurven
war jedoch nicht vorhanden. Es war daher eine starre Führung, die für hohe
Tempi geeignet war.
Daher erübrigte sich während des Betriebes eine re-gelmässige
Nachschmierung, wie sie bei den bis-herigen
Gleitlagern
erforderlich war. Das
Fett
konnte im regelmässigen Unterhalt ausgewechselt werden. Gegenüber dem Drehgestellrahmen wurde jedes La-ger mit zwei Schraubenfedern abgefedert. Diese wa-ren für hohe Geschwindigkeiten geeignet, da sie auch Stösse in kurzer Folge aufnehmen konnten.
Der Nachteil der
Federung
war hingegen die kurze Schwingungsdauer. So konnte sich die
Feder
auf-schaukeln, was zu unkontrollierten Situationen füh-ren konnte. Um das
wirksam zu verhindern, mussten diese Federn mit
Dämpfern
ergänzt werden. Es wurden mechanische Dämpfer verwendet. Dabei wurde hier jedoch nicht mehr eine Dämpfung mit der Reibung der Achslagerführung verwendet. Der Betrieb der Reihe Re 2/4 hatte gezeigt, dass die-se Führungen deutlich weniger Verschleiss hatten, wenn sie mit Öl geschmiert wurden.
Die Stabilität der
Achsewar
so besser gewährleistet. Zudem bedeutete der
Dämpfer
nicht viel mehr Ge-wicht. Eine Lösung, die sich durchsetzen sollte.
Soweit entsprachen die
Drehgestelle der Baureihe
Re 2/4. Es gab auch
keine Unterschiede zwischen den angetriebenen
Achsen
und den
Laufachsen.
Ein Punkt, der auch den Unterhalt vereinfachen sollte und beim Einbau der
Drehgestelle in das Fahrzeug wurden auch die Lösung des Musters gewählt.
Wobei jedoch die verbesserte Lösung der kleinen Serie umgesetzt werden
sollte. Das war aber auch schon bei den beiden
Re 8/12 so.
Bei der Art des Einbaues gab es jedoch keinen Unterschied und so
griff der
Drehzapfen
vom Kasten in den
Drehgestellrahmen
und erlaubte diesem dabei die freie Bewegung. Die Abstützung erfolgte auf einen quer zur Fahrrichtung eingebauten Wiegebalken. Dieser war gegenüber dem Kasten beweglich, so dass er der Drehung des Drehgestells folgen konnte.
Dazu waren spezielle Pfannen eingebaut worden, die ein Ölbad
besassen und so geschmiert waren. Diese Pfannen wurden zudem so
konstruiert, dass der Verlust von
Schmiermitteln
auf ein absolutes Minimum reduziert werden konnte. Auch hier war keine
Nachschmierung erforderlich.
Ebenfalls gefedert war die Abstützung des Kastens. Dazu waren in
Längsrichtung
Blattfedern
eingebaut worden. Diese waren nicht zu erkennen, da sie in einer Mulde des
Rahmens versteckt wurden. Diese Lösung ermöglichte letztlich auch den
tiefen Fussboden und dank den
Federn,
waren auch keine
Dämpfer
erforderlich. Die hier auftreten
Stösse
konnten von der Feder problemlos aufgenommen werden. Die Hemmung
verhinderte zudem ein Aufschaukeln.
Der Kasten war so verhältnismässig weich gefedert und gleichmässig
abgestützt worden. Ein Punkt der den Komfort steigerte. Jedoch das
Drehgestell nicht bei der Drehung hemmte. Diese Hemmung war
jedoch erforderlich, weil bei zunehmender Geschwindigkeit das Drehgestell
dazu neigte ins Schlingern zu geraten. Um das zu verhindern und umso die
Höchstgeschwindigkeit
von 150 km/h zu ermöglichen, mussten
Dämpfer
verbaut werden.
Der Vorteil war, dass es bei den
Schlingerdämpfern
ein-facher war, diese optimal einzustellen. Das war nötig, da wegen der
Zugreihe R
die Dämpfung nicht zu gross sein durfte.
Bisher gab es bei den
Drehgestellen keinen Unterschied, das ändert sich
nun. So wurden die
Laufdrehgestelle
mit einem Träger für die Bauteile der
Zugsicherung
verse-hen. Dabei wurde mittig ein Magnet platziert. Seitlich befand sich
dann der Empfänger für die Übertragung. Dabei war bei jedem Drehgestell
immer nur die Einrichtung für eine Fahrrichtung vorhanden. Das war
erforderlich, da der
Triebzug
mit 46 200 mm für eine zentrale Montage zu lang war.
Die beiden mittleren
Drehgestelle
wurden mit einem
Antrieb
versehen. Dabei wurde jede
Achse
von einem eigenen
Fahrmotor
angetrieben. Diese Motoren waren von der Grösse her so verkleinert worden,
dass sie im verfügbaren Platz des
Drehgestellrahmens
fest eingebaut werden konnten. Daher waren sie gegenüber dem
Drehgestellrahmen nicht gefedert worden. Der mechanische Antrieb musste
daher die
Federung
der Achsen ausgleichen.
Die Konstruktion der
Antriebe
war eigentlich eine Angelegenheit des Mechanikers. Trotzdem wurden die
neuen modernen Antriebe von den drei Elektrikern entwickelt und eingebaut.
Bei diesem Fahrzeug kamen die schon bei den
Triebwagen
Re 2/4 Nummer 202
bis 207 verwendeten Antriebe der Firma Brown Boveri und Co BBC zur
Anwendung. Es lohnt sich, wenn wir diesen neuen
Federantrieb mit Hohlwelle etwas genauer ansehen.
Um den Verschleiss zu mildern, wurden die Zahnflanken mit
Öl
geschmiert. Dabei lagerte das
Schmiermittel
in einer
Ölwanne.
Diese war Bestandteil des geschlossenen Gehäuses. Die Schmierung selber erfolgte passiv. Dabei lief das grosse Zahnrad durch das Schmiermittel und nahm dieses auf. So übertrug sich das Öl auch auf das Ritzel.
Da sich die
Zahnräder
jedoch sehr schnell drehten, entstanden hohe Flieh-kräfte. Diese sorgten
dafür, dass das
Schmiermittel
an das Gehäuse ge-schleudert wurde und an den Wänden entlang wieder in die
Wanne lief. Eine
Schmierung,
die sehr gut funktionierte. Nicht auf der Triebachse, sondern auf einer Hohlwelle, die um diese herum angeordnet war, wurde das grosse Zahnrad montiert. Dadurch war sowohl das Getriebe, als auch die Welle gegenüber der Achse abgefedert worden.
Der erforderliche Ausgleich der
Federung
erfolgte daher zwischen dem Ende der Hohlwelle und dem
Rad.
Dabei wurde an der
Triebachse
nur ein Mitnehmer montiert, was eine sehr geringe ungefederte Masse ergab.
Zwischen der Hohlwelle mit dem Mitnehmer und dem Gegenstück am
Rad
wurden
Federn
eingebaut. Diese
Schraubenfedern
sorgten dafür, dass das
Drehmoment
ungeachtet der
Federung
auf die
Triebachse
übertragen wurde. Eine Lösung, die kaum Unterhalt erforderte und daher in
diesem Punkt besser war, als die Ideen der Firmen MFO und SAAS. Daher
verwundert es nicht, dass dieser
BBC-Federantrieb
nicht nur hier, sondern bei über 500 Fahrzeugen verbaut wurde.
Die zwischen der Lauffläche und der Schiene vorhandenen Haftreibung reichte auch bei nassen Schienen aus, um die maximale Kraft zu erzeugen.
Der Grund dafür war, die geringe eingebaute
Leistung,
die gegenüber von
Lokomotiven
eine Vereinfachung beim Aufbau und somit eine Reduktion beim Gewicht
ermög-lichte. Deshalb mussten hier keine Sander mehr verbaut werden. Ein Vorteil der zur Mitte hin eingebauten Triebdrehge-stelle, da die Laufachsen die Schienen reinigten.
Da bei den Roten Pfeilen die
Sandstreueinrichtungen
auch bei der Bremsung genutzt wurde, war das überraschend. Jedoch hatten
gerade die
Triebzüge
Re 8/12 gezeigt,
dass vorlaufende
Achsen
einen ähnlichen Effekt, wie der
Quarzsand
erzeugen konnten, daher war der Verzicht kein Wunder.
Die so erzeugte Kraft wurde über die Achslagerführungen auf den
Drehgestellrahmen
übertragen. Von dort gelangte die
Zugkraft
der ersten
Achse
zusammen mit der zweiten
Triebachse
mit Hilfe des
Drehzapfens
auf den Kasten. Der tief eingebaute Drehzapfen verhinderte, dass durch die
Zugkraft im
Drehgestell
eine Kippbewegung entstehen konnte. Da hier keine Wagen mitgeführt wurden,
reichte diese Lösung problemlos aus.
Weil auch nur das Gewicht des Fahrzeuges befördert werden musste,
konnte die meiste
Zugkraft
in Beschleunigung umgesetzt werden. Bei vier
Triebachsen
ergab das bei einem 93 Tonnen schweren Fahrzeug eine gute Beschleunigung.
Doch mehr dazu erfahren Sie bei der Vorstellung der elektrischen
Versorgung der Motoren und der Betrachtung der Kenndaten. Hier wird es
Zeit, dass etwas Farbe aufgetragen wird, denn das war wichtig.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
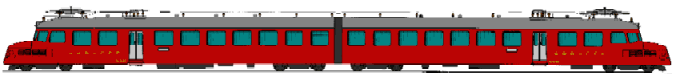 Wer
genauere Angaben über das
Wer
genauere Angaben über das
 In
jedem
In
jedem
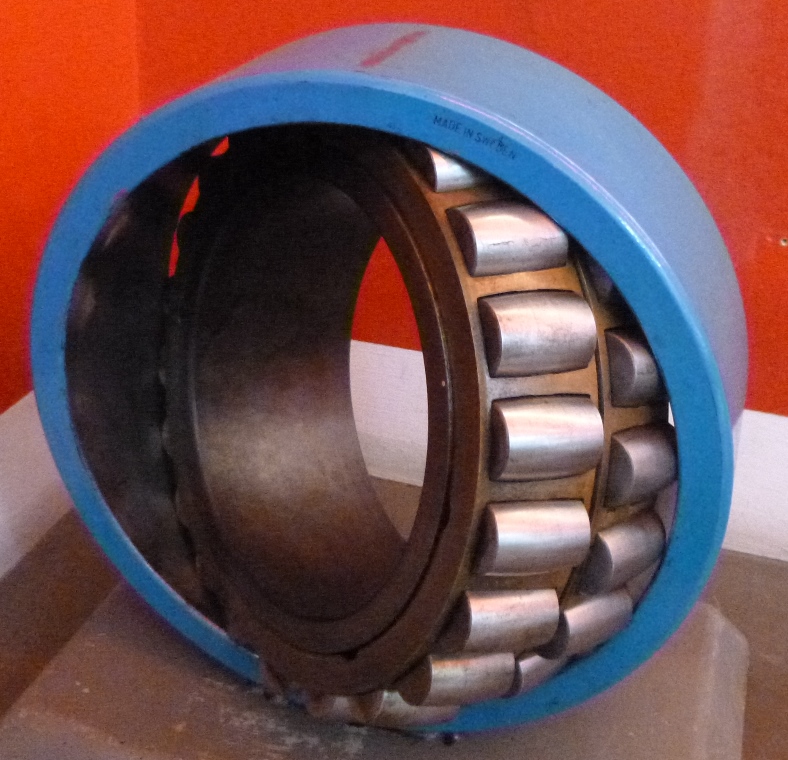 Für
das
Für
das
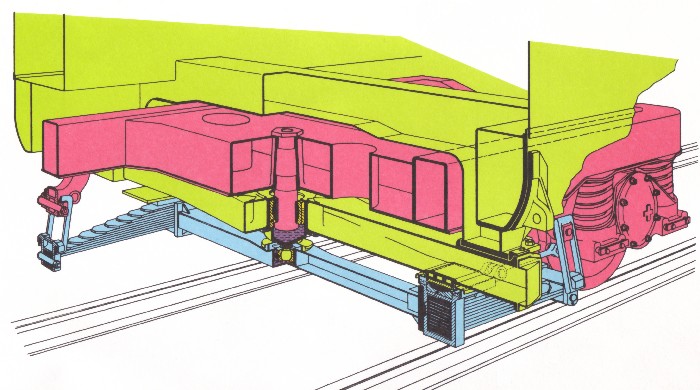 In
der Position gehalten wurden die
In
der Position gehalten wurden die
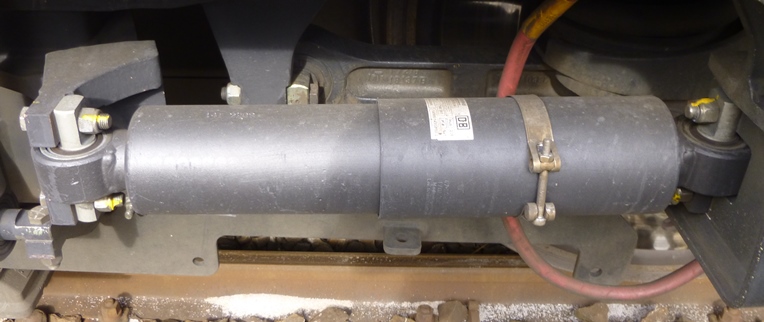 Die
hier verbauten
Die
hier verbauten
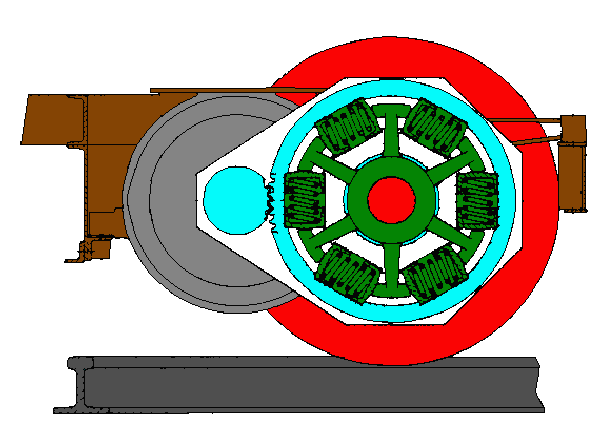 Das
Das
 Das
so auf die
Das
so auf die