|
Laufwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im
vorherigen Kapitel haben wir erfahren, dass die SIG in Neuhausen am
Rheinfall nur für den Aufbau des Kastens verantwortlich war. Mit dem
Wechsel zum
Laufwerk kommen wir nun zu den Bereichen, die von der
Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur gebaut
wurden. Dabei handelte es sich bei diesem
Triebwagen um ein Fahrzeug mit
Drehgestellen. Diese Bauweise hatte sich bei solchen Fahrzeugen
durchgesetzt.
Diese wurde mit Bo’ + (A1A) angegeben. Damit erkennen wir, dass hier zwei unter-schiedliche Drehgestelle ver-baut wurden.
Diese
hatten ihren Ursprung zudem bei zwei bereits gebauten, oder sich noch im
bau befindlichen Fahrzeugen. Das waren die an die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB gelieferten
Baureihen
Ce 4/6 und
Fe 4/4.
Die
Drehgestelle
unterschieden sich daher im Aufbau. Aber auch die Abstützung
konnte nicht bei beiden Modellen identisch ausgeführt werden. Das galt
sogar teilweise auch gegenüber den erwähnten Mustern. Für uns bedeutet das
nun aber, dass wir die Drehgestelle getrennt ansehen müssen, denn nur so
werden wir auch die grossen Unterschiede kennen lernen. Wie schon beim
Kasten beginne ich beim
Führerstand eins.
Im Gegensatz
zu den anderen
Baureihen beginne ich hier zuerst mit der Abstützung des
Kastens auf den
Drehgestellen. Das erleichtert die Beschreibung des
Aufbaus und verhindert hier im Artikel, dass gewisse Punkte doppelt
erwähnt werden müssen. Wie vorher erwähnt, machen wir den Anfang mit dem
Drehgestell eins, das mit zwei
Achsen versehen wurde. Daher konnte eine
einfache Abstützung umgesetzt werden.
Die
Abstützung des Kastens gegenüber dem
Drehgestell
erfolgte auf quer zur
Fahrrichtung eingebaute
Blattfedern. Insgesamt waren davon sechs Stück
montiert worden und sie konnten sehr gut erkannt werden. Hier wurde der
Vorteil dieser
Federn genutzt, denn diese hatten eine lange
Schwingungsdauer und konnten so die langsamen
Stösse des Drehgestells sehr
gut aufnehmen. Eine Lösung, die auch beim Modell
Fe 4/4 benutzt wurde.
Um die
Position zu bestimmen, musste noch ein mittig eingebauter
Drehzapfen
verwendet werden. So war das
Drehgestell
von der Position her fixiert,
konnte sich aber in den gewünschten Richtungen frei bewegen. Wenn wir nun zum zweiten Drehgestell wechseln, können wir diese Abstützung nicht mehr verwen-den. Da sich hier der Maschinenraum befand, lastete ein deutlich höheres Gewicht auf dem Drehgestell.
Um die
Achslasten einhalten zu
können, musste daher eine
Laufachse verwendet werden. Mit den nun im
Drehgestell
vorhandenen drei
Achsen, war die Lösung mit den mittigen
Blattfedern schlicht nicht möglich.
Beibehalten
wurde der in der Mitte angeordnete
Drehzapfen. Dieser fand im Gegensatz zu
den quer verbauten
Blattfedern über der
Laufachse genug Platz. Wegen den
Rädern der mittigen
Achse musste die
Sekundärfederung geändert werden.
Dabei fand man eine ganz einfache Lösung, denn es wurde schlicht keine
zweite Federstufe vorgesehen. Der Kasten stützte sich nur mit den
Gleitplatten auf den Rahmen ab.
Der Verzicht
war nötig, weil im Rahmen schlicht der Platz für eine
Federung fehlte. Die
beim Muster der
Staatsbahnen verwendete Lösung, hatte dort für schlechte
Laufeigenschaften geführt. Mit der hier verwendeten Lösung wollte man eine
Verbesserung erzielen. Das so etwas härtere Verhalten des
Drehgestells
erachtete man bei den Herstellern nicht als Problem, da sich über diesem
Drehgestell bekanntlich der
Maschinenraum befand.
Um diese zu verbinden und um so den
Drehgestellrahmen
zu schaffen, waren
Nieten verwendet worden. Auch hier
galt, dass Schrauben nur dort verbaut wurden, wo oft Teile ersetzt werden
mussten. Neben den Kosten sprach hier auch noch die Festigkeit für die
Nieten. Bevor wir uns den eingebauten Achsen zuwenden, sehen wir noch die anderen Anbauteile an. Zu diesen gehörten die auf der Aussenseite des Fahrzeuges angebrachten Schienenräumer.
Für diese wurde am Rahmen des
Drehgestells
ein Support
befestigt. An diesem Support waren die
Schienenräumer mit Schrauben
befestigt wurden. Die Schrauben wurden verwendet, da diese Bleche in der
Höhe verstellt werden mussten.
Gerade die
Höhenverstellung war sehr wichtig, denn nur so konnte der Schutz der
Schienenräumer gewährleistet werden. Auf den
Schienen liegende Gegenstände
wurden durch die Blech seitlich abgeleitet und kam so nicht zum
Laufwerk.
Um zu verhindern, dass der Support beschädigt werden konnte, waren die
Schienenräumer eines
Drehgestells mit einer Stange verbunden worden. So
war wirklich ein guter Schutz vorhanden.
Es versteht
sich, dass bei grösseren Gegenständen diese Bleche leicht beschädigt
werden konnten. Auch deswegen waren Schrauben benutzt worden. Zudem wurden
Modelle eingebaut, die schon bei anderen
Baureihen vorhanden waren. Das
erleichterte die Vorhaltung von Ersatzteilen, denn auch wenn der
Schienenräumer klein aussah, in einem Magazin war das Blech nicht leicht
zu handhaben und es benötigte Platz.
Soweit waren alle
Achswellen identisch, denn die Unterschiede zwischen den beiden
Drehgestellen gab es nur bei den beiden aufgezogenen
Rädern. Diese
unter-schieden sich beim Durchmesser deutlich. Jedes Rad bestand aus dem auf der Welle aufgezogenen Radkörper. Dieser war als Vollrad ausgeführt worden. Als Verschleissteil wurde schliesslich noch ein Radreifen aufgezogen. Sollten Sie sich nun fragen, warum keine Speichenräder verbaut wurden, kann ich das mit den Reisezugwagen vergleichen.
Dort wurden schon seit Jahren
Scheibenräder verwen-det. Der
Vorteil war, dass diese kräftiger waren und auch billiger hergestellt
werden konnten. Wie sehr sich die eingebauten Achsen an den Wagen orientierten, erkennen wir, wenn wir zu den Durch-messern kommen. Dieser war wichtig, weil der Radreifen mit der Lauffläche und dem Spurkranz versehen war. Daher war diese Bandage im Betrieb einer Abnützung unter-worfen.
Wie Sie bei ihrem
Auto, musste auch ein
Triebwagen regelmässig neue
Radreifen abholen. Nur die
Unter-scheidung zwischen Winter und Sommer gab es nicht.
Damit kommen
wir zu den Durchmessern. Bei den
Triebachsen wurde ein Wert von 1 040 mm
angegeben. Damit waren hier
Räder verwendet worden, die auch bei den
meisten Wagen angewendet wurde. Um das Gewicht der
Laufachse geringer zu
halten, wurde bei dieser der Durchmesser auf 850 mm verringert. Auch hier
konnten daher
Bandagen aus den Beständen verwendet werden. Lediglich der
Radkörper war anders.
Der Rahmen
des
Drehgestells war entsprechend aufge-baut worden. Die
Achse verschwand
deshalb nach dem Einbau zu einem grossen Teil im
Drehgestellrahmen. Eine
Bauweise die möglich wurde, da hier kein
Stangen-antrieb vorhanden war. Jeder Radsatz hatte zwei Achslager erhalten. Diese teil-ten sich wiederum die das Rotationslager und in das lineare Lager auf. Der lineare Teil befand sich dabei zwischen dem Gehäuse des Lagers und dem Drehgestell-rahmen.
Hier
wurde ein einfaches
Gleitlager verwendet, das mit Stahl auf Stahl
arbeitete und zur Verringerung der Reib-ung mit
Öl geschmiert werden
musste. Unterschiede gab es jedoch bei den Führungen.
Bei den
Triebachsen waren die Führungen so aufgebaut worden, dass sich die
Achse
nur in der vertikalen Richtung bewegen konnte. Beim langen
Drehgestell
zwei musste jedoch wegen der dritten Achse eine andere Lösung verwendet
werden. Dabei bleiben die Triebachsen identisch und nur die mittig
eingebaute
Laufachse konnte sich zusätzlich auch zur Seite bewegen. Damit
war es möglich, auch enge
Kurven zu befahren.
Bevor wir
uns den
Rotationslagern zuwenden, greifen wir zum Messband. Beim
Drehgestell
eins wurde der Radstand mit 2 700 mm angegeben. Bei der zweiten Lösung mit
der
Laufachse betrug der Radstand zwischen den Triebachsen 3 300 mm. Da
die Laufachse seitlich beweglich war, sprach man hier auch von einem
festen
Radstand. Das war bei den Drehgestellen jedoch nur wichtig, wenn
mehr als zwei
Achsen eingebaut wurden.
Diese
Gleitlager waren damals üblich und sie funktionierten gut. Gerade wegen
der
Lagerschalen war eine sehr geringe Reibung vorhanden. Diese mit der
Drehzahl kombiniert, erzeugte jedoch zu viel Wärme für das
Weissmetall. Um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, musste das Lager gekühlt werden. Dazu wurde die Reibung mit einer Schmierung mit Öl verringert. Dieses Schmiermittel übernahm dabei auch die Kühlung.
So wurde das Schmieröl
verbrannt und aus dem
Lager getrieben. Zusammen mit dem Schmutz bildete
sich am Rahmen dann eine zähe schwarze Paste. Auch wenn diese sehr gut
klebte, nicht alles
Öl wurde darin gebunden. Die auf den Radsatz wirkenden Stösse und Schläge mussten gegenüber dem Rahmen abgefedert werden. Besonders wichtig war das beim Drehgestell zwei, wo ja nur diese Federung vorhanden war.
Dazu wurde über dem Gehäuse des
Achslagers eine
Blattfeder verwendet. Deren Enden waren jedoch nicht
direkt im
Drehgestell gehalten, sondern sie stützten sich mit
Schraubenfedern auf den Aufnahmen am Rahmen ab. Es war so eine damals bei Reisezugwagen übliche Federung vorhanden. Diese arbeitete sehr gut und sie sorgte auch dafür, dass der Drehgestellrahmen sich nicht auf der Achse abstützte. Vielmehr wurde das Drehgestell an der Achse aufgehängt.
Das führte dazu, dass die Vibrationen der
Radsätze nicht auf
das
Drehgestell übertragen wurden. Gerade beim langen Drehgestell war das
wichtig, weil hier ja die zweite Federstufe fehlte.
Auch jetzt
sehen wir uns ein paar Masse an. Der Abstand der beiden
Drehzapfen
betrug
13 600 mm. Jedoch können wir nun auch die Höhe bestimmen. Diese betrug
3 745 mm bis zum Dach. Obwohl wir die dort vorhandenen Aufbauten und die
elektrische Ausrüstung nicht berücksichtigt haben, können wir feststellen,
dass das
Lichtraumprofil eingehalten werden konnte. Jedoch haben wir
bisher noch keinen
Triebwagen, da der
Antrieb noch fehlt.
Da alle
Triebachsen den gleichen
Antrieb bekommen haben, können wir uns auf einen
davon beschränken. Dabei wurde der
Fahrmotor sowohl auf der
Achse, als
auch im
Drehgestellrahmen befestigt. Um die
Federung nicht zu behindern,
erfolgte die Abstützung im Rahmen über Gummielemente. Wir haben daher
einen damals üblichen
Tatzlagerantrieb erhalten. Wegen dem im
Drehgestell
verfügbaren Platz, war damals keine andere Lösung vorhanden.
Der Unterschied fand sich bei der
benutzten
Übersetzung, denn diese musste verändert werden, da nicht
überall bei den Motoren die gleichen Daten vorhanden waren. Daher müssen
wir diesen Punkt etwas genauer betrachten. Bei den Triebwagen mit den Nummern 721 bis 723 kam ein Getriebe zum Einbau, das eine Übersetzung von 1 : 3.60 hatte. Für die restlichen Modelle wurde jedoch eine Änderung vorgenommen.
Daher hatten diese einen Wert von
1 :
3.89 erhalten. Das hatte jedoch auf die
Höchstgeschwindigkeit und auf die
Zugkraft keine negativen Auswirkungen. Mehr dazu werden wir erfahren, wenn
wir die elektrische Ausrüstung be-trachten.
Die
Zahnräder des
Getriebes waren sehr empfindliche Teile. Daher mussten sie
geschützt und geschmiert werden. Deshalb wurde ein Getriebekasten
ver-wendet, der am unteren Ende mit einer
Ölwanne ergänzt wurde. In dieser
lagerte das
Öl, das vom drehenden Zahnrad aufgenommen und auf das Ritzel
übertragen wurde. Wegen der auf das
Schmiermittel einwirkenden Fliehkraft
wurde das Öl an die Wand geschleudert und lief wieder in die Wanne.
Wir haben
mit dem
Getriebe das
Drehmoment umgewandelt, so dass eine geringere
Drehzahl vorhanden war. Damit
Zugkraft entstehen konnte, musste das Moment
umgewandelt werden. Diese Umwandlung erfolgte mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen der
Lauffläche und der
Schiene. Die so entstandene Zugkraft wurde
über den
Drehgestellrahmen,
den
Drehzapfen und dem Rahmen des Kastens auf die
am
Stossbalken
montierten
Kupplung übertragen.
Da bei
schlechtem Zustand der
Schienen die
Adhäsion für die Erzeugung der
Zugkraft nicht ausreichend sein konnte, musste die
Haftreibung verbessert
werden. Dazu wurden bei den
Drehgestellen
Sandstreueinrichtungen montiert.
In einem Behälter wurde der
Quarzsand gelagert und dieser mit der Hilfe
von
Druckluft
auf die Schienen vor der ersten
Achse des
Drehgestells
geblasen. Es waren daher vier Anlagen vorhanden.
Von einem
Führerstand aus konnten jedoch nicht alle
Sandstreueinrichtungen aktiviert
werden. Es wurden so immer nur die
Ventile geöffnet, die sich in der
Fahrrichtung vor dem
Drehgestell befanden. Es war daher eine gute Lösung
vorhanden, die dafür sorgte, dass auch in diesem Fall eine gute Ausnützung
der
Haftreibung vorhanden war. Die Reibungswerte blieben daher auch bei
nassen
Schienen nahezu gleich.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
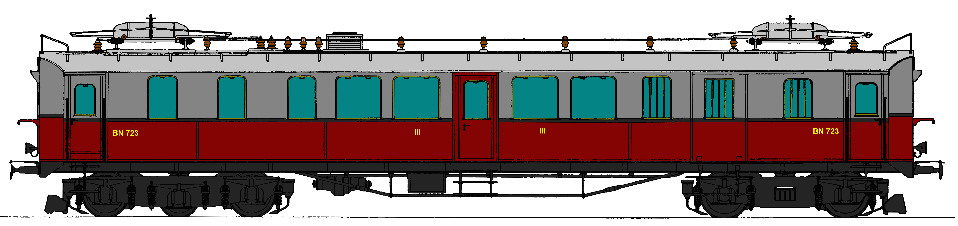 Um den
Aufbau des
Um den
Aufbau des  Mit der
Abstützung war jedoch die Position noch nicht bestimmt worden, denn der
Kasten war wirklich nur abgestützt worden und konnte sich gegenüber dem
Mit der
Abstützung war jedoch die Position noch nicht bestimmt worden, denn der
Kasten war wirklich nur abgestützt worden und konnte sich gegenüber dem
 Kommen wir
zum Aufbau der beiden
Kommen wir
zum Aufbau der beiden  Somit können
wir zum
Somit können
wir zum
 Es wird
Zeit, dass wir diese
Es wird
Zeit, dass wir diese
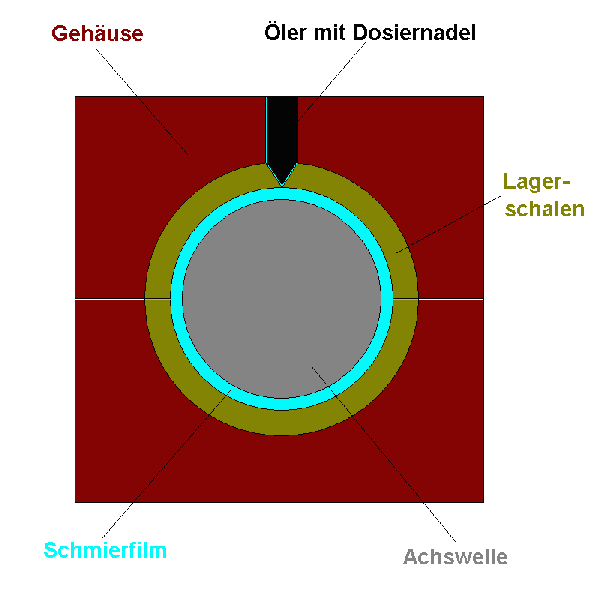 Die
Die
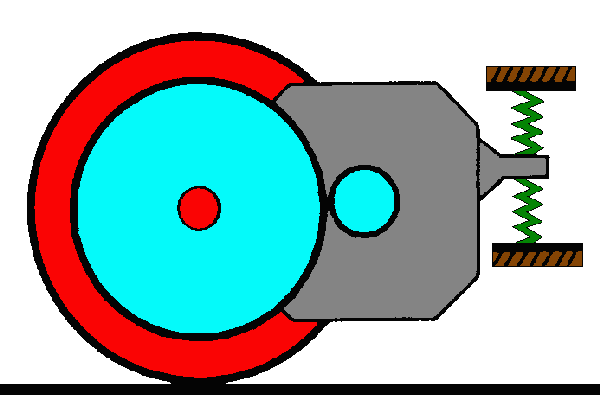 Um das vom
Um das vom