|
Laufwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir nun
zum
Laufwerk mit den
Antrieben kommen, erkennen wir, dass hier auf eine
einfache Lösung gesetzt wurde, die jedoch zur
Lokomotive passte. So wurde
die
Achsfolge mit Co angegeben. Wir erkennen daher, dass jede
Achse mit
einem eigenen Antrieb versehen wurde und dass die drei
Triebachsen im
Rahmen gelagert wurden. Beginnen wir die Betrachtung mit der Montage der
Achsen, die im
Lokomotivrahmen gehalten wurden.
Diese
doppelreihigen Modelle hatten sich bei den an-deren Baureihen seit Jahren
bewährt und daher war deren Anwendung kein besonderes Problem. Die
Achslager waren mit einem sehr geringen Aufwand bei der Wartung verbunden. Auch diese Rollenlager mussten zur Verminderung der Reibung und zur Reduktion der Wärme ge-schmiert werden. Es kam Fett zur Anwendung, dass in das geschlossen ausgeführten Lager gepresst wur-de.
Durch diese spezielle bei
diesen
Lagern übliche Aus-führung, ging kein
Schmiermittel im Betrieb
verloren. Daher erreichten diese Modelle eine grosse Lauf-leistung, ohne
dass eine entsprechende Wartung ausgeführt werden musste. Geführt wurden die Achsen jedoch mit den Federn. Dazu waren seitlich von jedem Achslager die ent-sprechenden Aufnahmen und Führungen vorhanden. Es wurden Gummirollfedern verwendet.
Deren Vorteil lag bei der niedrigen Bauweise.
Durch die Führung der
Lager in diesen Federpaketen waren die
Achsen sowohl
in der Längs-, als auch in der Querrichtung elastisch. Das erlaubte es der
Loko-motive auch enge
Kurven ohne grosse Probleme zu befahren.
Auch wenn
das Problem mit dem Aufschaukeln bei dieser
Federung nicht so gross wie
bei den
Schraubenfedern war, bestand die entsprechende Gefahr auch hier.
Aus diesem Grund wurden zwischen dem Gehäuse des
Achslagers und dem
Längsträger hydraulische
Stossdämpfer eingebaut. Diese berücksichtigten auch
die etwas weichere Ausführung der Federung bei der mittleren
Achse. Das
war nötig um
Kuppen und
Senken auszugleichen.
Der feste
Radstand wurde mit 5 000 mm angegeben. Dabei waren die drei
Achsen
gleichmässig verteilt worden. Durch die bewegliche Führung der
Lager
konnten sich die Achsen jedoch dem
Gleis anpassen. Um den Verschleiss der
Räder trotzdem zur verringern, wurde eine
Spurkranzschmierung
verbaut. Diese war auch bei anderen Baureihen in der Schweiz üblich und
die
Schmierung
der
Spurkränze erfolgte mit speziellen für diesen Zweck entwickelten
Fetten.
Die beiden
Räder wurden auf der
Achse im Schrumpfverfahren montiert. Der für die
Spurweite erforderliche Abstand war mit der Ausarbeitung der Aufnahmen an
der Achse angebracht worden. Das war eine übliche Bauweise, die es
erlaubte, dass die
Radsätze in einer Werkstatt schnell und einfach gewechselt
werden konnten. Ein Punkt, der besonders bei kleineren Serien verhindert,
dass zu lange Standzeiten eingehalten werden mussten.
Der Durchmesser wurde mit 1040 mm angegeben. Das entsprach den meisten bei Wagen verwendeten Radsätzen, so dass hier keine speziellen Räder vorge-halten werden mussten. Ein schneller Austausch der Achse war daher kein Problem. Ausgelegt wurde dieses Laufwerk für eine Geschwin-digkeit von 60 km/h. Die bei der Baureihe Eea 3/3 geforderte Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit konnte jedoch mit leichten Anpassungen erreicht werden.
Diese Veränderungen waren
auch bei den später ge-bauten Modellen der Baureihe Ee 3/3 vorhanden, so
dass auch diese mit maximal 75 km/h verkehren konnten. Für eine
Rangierlokomotive waren das jedoch erstaunliche Werte. Bei allen hier vorgestellten Lokomotiven lag der mini-mal befahrbare Radius bei 55 Metern. Daher konnten problemlos auch Anschlussgleise mit besonders engen Bögen befahren werden.
Ein Umstand, der nicht so überraschend war, wurde
dieses Modell in der ursprünglichen Konstruktion als
Rangierlokomotive
konzipiert. Das zeigte sich auch bei der
Zulassung, denn sämtliche
Maschinen waren für die
Zugreihe A ausgelegt worden. Da wir die Lokomotive nun auf ihre Räder gestellt haben, können wir auch die Höhe bestimmen. Diese wurde bei gesenktem Stromabnehmer mit 4 500 mm angegeben.
Wobei dieser auch gleich den höchsten Punkt markierte. Das Dach des
Führerhauses lag jedoch auf 3 930 mm. Damit wurde auch in diesem Punkt das
für die Schweiz massgebende
Lichtraumprofil eingehalten. Es ergaben sich
so keine betrieblichen Beschränkungen.
Bisher haben
wir jedoch nur ein Fahrzeug erhalten. Um daraus ein
Triebfahrzeug zu
machen, mussten die drei
Achsen angetrieben werden. Dazu wurde bei jeder
Achse ein eigener
Antrieb verwendet. Da dessen Ausführung bei sämtlichen
Triebachsen identisch war, können wir uns bei der Betrachtung auf eine
Achse beschränken. Die Wahl fiel dabei auf die mittlere Achse, da sie am
einfachsten aufgebaut war. Wie das gemeint ist, erfahren wir später.
Das für den
Antrieb erforderliche
Drehmoment wurde in einem
Fahrmotor erzeugt. Dieser
wurde mit den Motorträgerhaltern von unten an der Bodenplatte verschraubt.
Diese Lösung erlaubte es den Motor bei einem Defekt mit Hilfe einer
Hebebühne nach unten auszubauen. Die Montage erfolgte dabei auf eine
Weise, dass die Vibrationen des Motors nicht auf den Rahmen übertragen
wurden. Somit war der Motor jedoch auch von der
Federung entkoppelt.
Diese speziellen Wellen hatten sich im Bereich des Stras-senverkehrs durchgesetzt und sie vereinfachten den Auf-bau des Antriebes.
Jedoch bedeutete das auch, dass
das eigentliche
Getriebe nicht gefedert war. Bei der geringen
Höchstgeschwindig-keit war das jedoch ein Problem, das man vernachlässigen
konnte.
Erst
anschliessend erfolgte die Anpassung der Drehzahlen mit einem gewöhnlichen
schräg verzahnten
Getriebe. Dabei liefen die
Zahnräder, wo dies
erforderlich war, in einfachen mit
Fett geschmierten
Kugellagern. Um die Zahnflanken zu schmieren und um die empfind-lichen Zahnräder zu schützen wurde ein geschlossenes Ge-häuse verbaut.
Dieses Gehäuse besass eine
Ölwanne, wo das entsprechende
Schmiermittel gelagert wurde. Das sich
drehende
Zahnrad lief dabei durch das
Öl und nahm dieses auf. So wurde
auch die
Schmierung der anderen Zahnräder gesichert. Durch die Fliehkraft
wurde das Schmiermittel weggeschleudert und lief an den Wänden entlang in
die Wanne.
Da bei
dieser Lösung die
Achse vom Gehäuse umfasst wurde, waren auch dort
Lager
verbaut worden. Hier kamen einfachere Lösungen zur Anwendung, die mit
Schikanen verhinderten, dass
Schmiermittel austreten konnte. Dadurch war
auch in diesem Punkt dem Umweltschutz Rechnung getragen. Der Nebeneffekt
für den Betreiber lag darin, dass der Ölstand in der Wanne nur noch im
regelmässigen Unterhalt kontrolliert und allenfalls ergänzt werden musste.
Die
Achsgetriebe
waren nicht bei allen
Lokomotiven identisch aufgebaut worden. Bei den
Modellen mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde eine
Übersetzung von 1:12.012 verwendet. Da bei den schnelleren Maschinen der
gleiche
Fahrmotor verwendet wurde, musste das
Getriebe angepasst werden.
Daher besassen die mit 75 km/h fahrenden Fahrzeuge eine Übersetzung von
1 :
9.6. Das war jedoch der einzige Unterschied.
Diese besagten jedoch auch, dass
der erzeugten Kraft eine andere Kraft entgegenwirkt. Diese hätte auf Grund
der Konstruktion beim SLM-Achsgetriebe zu einer Verdrehung entgegen der
Fahrrichtung geführt. Damit das nicht geschehen konnte, musste daher eine zusätzliche Abstützung des Getriebes eingebaut werden. Dazu wurden Drehmomentstützen verwendet. Diese waren am tiefsten Punkt des Getriebes beweglich am Gehäuse angeschlossen worden und stützten sich an einem Support gegenüber dem Längsträger ab.
So
wurde wirksam verhindert, dass sich das
Achsgetriebe auf der
Achse verdrehen
und so die
Kardanwelle beschädig-en konnte. Um die Federung der Achse auszugleichen, besass die Drehmomentstütze eine einfache Teleskopfederung. Damit war das Achsgetriebe immer noch frei beweglich, konnte sich jedoch nicht zu stark verdrehen.
Damit war das
Problem gelöst und man hatte erst noch einen optimalen Angriffspunkt der
im
Rad erzeugen Kraft erhalten. Deren Pfad müssen wir uns daher ebenfalls
noch etwas genauer ansehen, denn der war geteilt worden.
Um die mit
Hilfe der
Adhäsion erzeugte
Zugkraft auf das Fahrzeug zu übertragen,
wurden die Befestigungen der
Gummifedern bei den
Achslagern und die
jeweilige Drehmomentstütze benutzt. Wobei die Stütze in diesem Fall sowohl
auf Zug- als auch auf
Druckkraft beansprucht werden konnte. Zudem gab es
innerhalb der
Federung Scherkräfte, die aber durch deren Konstruktion
ausgeglichen werden konnten. Es war daher eine optimale Lösung vorhanden.
Von dort wurde die
Zugkraft schliesslich auf die jeweiligen
Zugvorrichtungen ge-leitet. Nicht
benötigte Zugkraft wurde jedoch in den
Rädern in Beschleunigung
umgewandelt. Daher war auch diese direkt von der
Adhäsion abhängig. Damit kommen wir noch zu den beiden äusseren Triebachsen. Diese wurden zur Verbesserung der Haftreibung bei schlechtem Zustand der Schienen mit einer nur auf der Seite des jeweiligen Stossbalkens vorhandenen Sandstreueinrichtung ver-sehen.
Dabei wirke das Sanderrohr unmittelbar vor die
Lauffläche, so
dass der mit
Druck-luft auf die
Schiene geblasene
Quarzsand die
Adhäsion
verbesserte und zu einem feinen Staub zermahlen wurde. Diese Einrichtung wurde mit Quarzsand betrieben. Dabei wurde dieser in einem Behälter mitgeführt. Der Behälter war am Längsträger montiert worden und er konnte von der Seite mit Sand befüllt werden.
Dabei war der Vorrat so
ausgelegt worden, dass er im normalen Einsatz durchaus über längere Zeit
reichte. Trotzdem musste der Vorrat vom Fahrpersonal regel-mässig
kontrolliert werden. Allenfalls wurde in einem
Depot Sand nachgefüllt.
Spannend ist
diese Einrichtung nur bei der Baureihe Eea 3/3. Da bisher bei den
Lokomotiven der BLS-Gruppe solche
Sandstreueinrichtungen nicht angewendet
wurden, war dies eine Neuerung. Jedoch wurde diese Tatsache auch dem
Muster geschuldet, da die
Sander besonders im
Rangierdienst immer wieder
gute Dienste verrichteten. Sie sehen, die Gürbetalbahn GBS übernahm
wirklich die meisten Punkte vom Muster.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
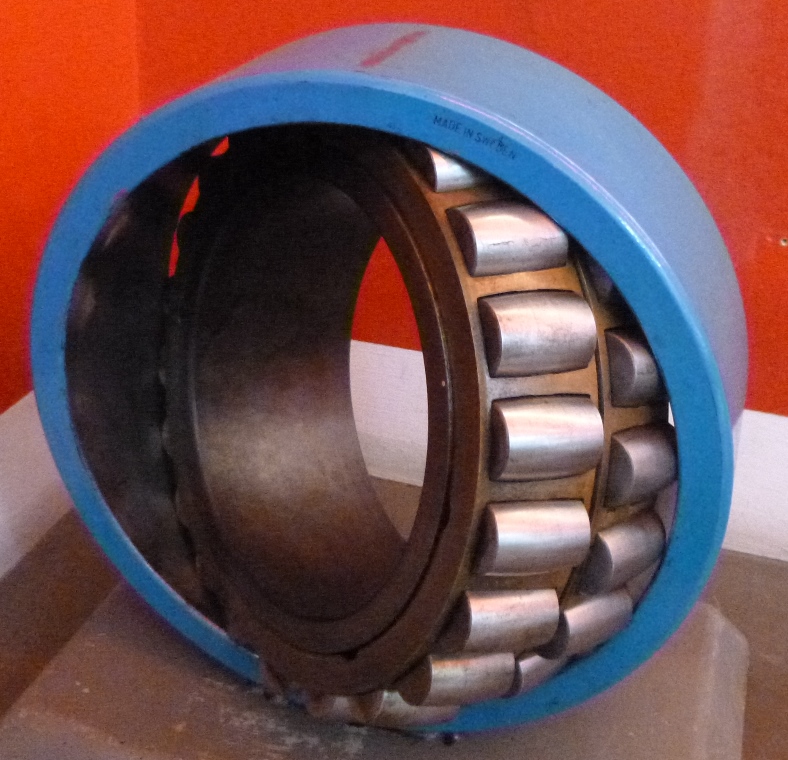 Es kamen
übliche aus Stahl aufgebaute
Es kamen
übliche aus Stahl aufgebaute  Diesem
Umstand wurde auch bei der Ausführung der
Diesem
Umstand wurde auch bei der Ausführung der
 Damit die
Damit die
 Das so auf
die
Das so auf
die
 Es war daher
eine optimale Übertragung der erzeugten Kraft auf die Längsträger
vorhanden. In diesen Trägern verbanden sich die Kräfte der drei
Es war daher
eine optimale Übertragung der erzeugten Kraft auf die Längsträger
vorhanden. In diesen Trägern verbanden sich die Kräfte der drei