|
Die neue Lokomotive |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Man hatte zumindest theoretisch die passende
Lokomotive
gefunden. Es ging nun darum aus den Ideen eine Lokomotive zu machen.
Damals wählte man dazu immer ein Muster auf dem die neue Maschine
aufgebaut werden konnte. Wirklich neue Konstruktionen waren daher selten.
Im Bestand der
Gotthardbahn
fand man jedoch schlicht kein passendes Modell, denn zu gross sollte der
Unterschied zu den vorhandenen Maschinen sein.
Aus der Idee sollte nun eine
Lokomotive
für die
Gotthardbahn
werden. Wir können schon jetzt sagen, dass damit auch international neue
Mass-stäbe gesetzt werden sollten, denn
Schnellzugsloko-motiven
mit drei
Den namhaften Herstellern im In- und Ausland wurde daher ein
Entwurf eines Projekts für eine Tal- und Bergbahnlokomotive mit drei
gekuppelten
Damit war klar, man wollte mit der Maschine schlicht ans Limit
gehen. Doch bevor wir uns intensiver damit befassen, müssen wir wissen,
was damit bei der
Gotthardbahn
gemeint war, denn so ausgedrückt, ist alle etwas wage.
Auf der
Gotthardbahn
war man bei den
Achslasten
und der Länge auf Grund der Bauweise beschränkt. Für die
Die neue
Lokomotive
sollte zusammen mit dem
Tender
über 100 Tonnen schwer werden. Dieses Gewicht war damals ein grosser
Schritt beim Bau von Lokomotiven. So eine schwere Lokomotive gab es bei
der
Gotthardbahn
und den anderen Bahnen in der Schweiz bisher schlicht noch nicht. Selbst
die grossen Güterlokomotiven der Gotthardbahn waren noch nicht so schwer
konstruiert worden. Es sollten daher Rekorde gebrochen werden.
Nun sollte erstmals die magische Grenze von 100 Tonnen
überschritten werden. Wer ausser der
Gotthardbahn
sollte so eine riesige Maschine beschaffen? Eigent-lich hätte sie nur zur
JS
gepasst, aber dort hatte man ja die neue A2t. Sie sehen, jetzt setzte man erneut neue Massstäbe beim Bau von Lokomotiven und das galt sogar auch International, denn niemand benötigte solche Modelle. Den Grund finden wir bei den grossen Steigungen der Gotthardbahn.
Hier verkehrten die schweren
Express-züge
und die mussten gezogen werden. Dazu wollte man möglichst schnell fahren
können. Es war daher ein Abwägen zwischen
Zugkraft
und
Höchstgeschwindigkeit.
Aus den Erfahrungen mit der missglückten
Lokomotive
der
Bauart
Mallet wurde gelernt, so dass ein grosser
Kessel
mit hohem Dampfdruck gefordert werden musste. Gerade dieser Punkt muss man
bedenken, denn das grösste Problem bei der D6 war, dass ihr auf der Fahrt
der Schnauf ausging. Das durfte mit der neuen Maschine für
Schnellzüge
schlicht nicht mehr passieren und so sorgte man gleich zu Beginn dafür.
Zur Verbesserung der Laufeigenschaften wurde ein führendes
zweiachsiges
Laufdrehgestelll
analog der Baureihe A2t der
JS
verlangt. So kam es zu einer
Lokomotive
mit der
Achsfolge
2C. Eine solche Maschine existierte zwar in Europa, aber mit den Eckdaten
der
Gotthardbahn
konnte diese Lokomotive nicht mehr mithalten. Im
Güterverkehr
kannte man selbst bei der Gotthardbahn mehr
Triebachsen,
aber nicht bei
Schnellzügen.
Schneller konnte man auf der Strecke damals schlicht noch nicht
fahren, denn zu viele
Kurven
waren dazu schlicht zu eng gebaut worden. Im Ausland waren die Strecken
lange gerade, so dass dort bereits von bis zu 120 km/h gesprochen wurde.
In der Schweiz damals nahezu undenkbar. Bei den mitgeführten Lasten erwartete man Anhängelasten von 120 Tonnen auf Strecken mit bis zu 26‰ Steigung. Die massgebende Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Damit setzte man bei der Anhängelast zwar keine neuen Massstäbe, aber bei der damit gefahrenen Geschwindigkeit.
Rechnerisch war dazu eine
Leistung
von rund 1 000 PS erforderlich. Damals arbeitete man noch mit PS, daher
wird auch hier diese Einheit verwendet. Das benötigte
Adhäsionsgewicht
wurde auf 45 Tonnen festgelegt. Somit waren die Eckdaten für die neue Maschine festgelegt worden. Das führte dazu, dass in der Schweiz die neue Baureihe A3t entstehen sollte. Die Forderungen der Gotthardbahn waren damit für damalige Zeiten durchaus zeitgemäss.
Insbesondere für die
Leistung
und das Gewicht der fertigen
Lokomotive.
Ohne
Tender
sollten dabei rund 65 Tonnen erreicht werden. Mit Tender stieg das Gewicht
auf über 100 Tonnen an.
Auch der
Tender
musste grösser werden als die vorhandenen Modelle. Schliesslich sollte
eine
Schnellzugslokomotive
nicht auf jedem zweiten
Bahnhof
Wasser fassen müssen. Die mitgeführten
Kohlen
sollten auch für Fahrten über längere Abschnitte ausreichen. Das bedingte
beim Tender eine zusätzliche
Achse,
so dass der dreiachsige Tender der A2t übernommen werden sollte. Bisher
kannte man bei der
Gotthardbahn
nur zweiachsige Modelle.
Zudem erwartete man zwei
Lokomotiven,
die als
Prototypen
bezeichnet wurden und die unterschiedlich gebaut sein sollten. Man wollte
dabei die Unterschiede zwischen den Lokomotiven mit Mehrlingsmaschinen und
solche mit
Verbund
herausfinden. Gerade Lokomotive mit
Dampfmaschinen
im Verbund waren neu, hatten aber bei der
Gotthardbahn
mit der D6 bereits Einzug gehalten. Daher erhoffte man sich auch hier
einen Vorteil.
Unter den von den Herstellern vorgeschlagenen Modellen waren
eigentlich nur die Modelle der Schweizerischen Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM in Winterthur interessant. Dabei bot diese Firma
jedoch zwei
Lokomotiven
mit Maschinen im
Verbund
an. Eine Maschine sollte drei, die andere vier
Zylinder
erhalten. So sollten die Unterschiede aufgezeigt werden. Die reine
Anwendung von
Hochdruckzylindern
erachtete man als unwirtschaftlich.
Gemeinsam war dabei bei den beiden Maschinen nur die
Achsfolge,
die mit zwei
Laufachsen
und drei
Trieb-achsen
vorgegeben war. In den Details gab es aber grosse Unterschiede bei den
beiden
Lokomotiven.
Bei der
Gotthardbahn
gab man den neuen Maschinen die Bezeichnung A3t und die Nummern 201 und
202. Sie waren nach der amerikanischen
Bauart
Ten-Wheel gebaut worden und entsprachen weitestgehend den Vorgaben. Dabei
sollte die Maschine mit der Nummer 201 drei
Zylinder
erhalten und jene mit der Nummer 202 deren vier. Geliefert wurden diese
beiden Maschinen im Jahre 1894 und damit nur zwei Jahre nach der A2t der
JS.
Man machte mit den beiden
Lokomotiven
so gute Erfahrungen, dass nach kurzer Zeit eine erste Bestellung von acht
Lokomotiven nach dem Muster der Nummer 202 erfolgte. Dabei wurden die mit
den beiden
Prototypen
gemachten Erfahrungen umgesetzt, so dass die Eckdaten der Maschine noch
einmal erhöht werden konnten. Der Kaufpreis für diese Lokomotiven lag bei
106 300 Franken. Damit waren sie etwas billiger als die Prototypen.
Diese Maschinen kamen 1897 in Betrieb. Gleichzeitig erfolgte die
Bestellung von weiteren zehn
Lokomotiven.
Damit war nach nur wenigen Jahren der Bestand auf
insgesamt 20 Exemplare angestiegen. Die Baureihe A3t bewährte sich und
nach der Ablieferung dieser Maschinen erwartete man eigentlich keine
Bestellungen mehr, denn das Schweizer Stimmvolk hatte die Verstaatlichung
der
Gotthardbahn
per Abstimmung beschlossen.
Beim Preis wurde nun aber auch ein Wert von 117 500 Franken
erreicht. Die Steigerung des Preises war jedoch eine Folge der neuen
Gesetze in der Schweiz, die soziale Abgaben der Arbeitgeber vorsahen und
daher den Preis leicht erhöhten. Geändert hatte sich mit diesen Maschinen auch die Bezeichnung von Lokomotiven in der Schweiz. Die neu gegründeten Schweizerischen Bundesbahnen SBB führten ein geändertes System für die Bezeichnungen ein, das auch von der Gotthardbahn übernommen wurde.
So wurden diese als A3t bestellten Maschinen bereits als Baureihe
A 3/5 in Betrieb genommen. Diese Bezeichnung sollte auf die weiteren
Lokomotiven
angewendet werden.
Mit der 1905 abgelieferten vierten Serie stieg die Anzahl der
Lokomotiven
auf einen Wert von 30 Exemplaren an. Diese letzten Maschinen der Baureihe
A 3/5 hatten nun einen Preis von 109 800 Franken. Damit wurden diese
Maschinen, die der dritten Serie entsprachen, wieder etwas billiger. Was
jedoch geblieben war, war die Tatsache, dass diese als letzte Lokomotiven
der
Gotthardbahn
mit den eigenen Nummern abgeliefert wurden.
Es wurden daher total 30 Stück dieses ersten Typs bestellt. Den
ausschliesslich in Winterthur gebauten
Lokomotiven
wurden die Fahrzeugnummern 201 bis 230 zugeordnet. Die Kosten für eine
Lokomotive beliefen sich auf 106 300 bis 117 500 Franken. Zusätzliche
Maschinen sah man wegen der anstehenden Verstaatlichung nicht mehr vor.
Die weitere Entwicklung sollte den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
übertragen werden.
Die hier beschriebenen Lokomotiven A3t (A 3/5) der
Gotthardbahn
sollten nicht die letzten dampfbetriebenen
Schnellzugslokomotiven
am Gotthard sein. Als letztlich die Schweizerischen Bundesbahnen SBB 1909
die
Lokomotiven
der Gotthardbahn übernahmen, kam es auf der Gotthardstrecke auch zu
Einsätzen der schnelleren Lokomotiven aus dem Bestand der
Staatsbahnen.
Wobei gerade diese Einsätze überraschenderweise sehr selten waren.
Da sich die weiteren
Lokomotiven
mit dieser
Achsfolge
deutlich von den ursprünglich als A3t abgelieferten Maschinen der
Gotthardbahn
unterschieden, werden diese in diesem Artikel nicht weiter behandelt
werden. Dabei werden die anderen Baureihen, die als
A 3/5 abgeliefert
werden sollten auf separaten Seiten vorgestellt werden. Sie können diese
Baureihen nun auswählen, oder sich dem Aufbau dieser Baureihe zuwenden.
|
|||||||||||
|
GB A 3/5 Nr. 931 - 938 |
SBB A 3/5 Nr. 601 - 649 |
SBB A 3/5 Nr. 701 - 811 |
|||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
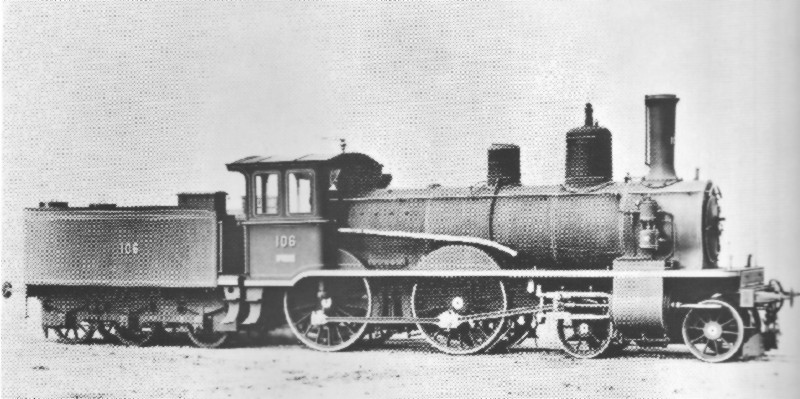 Die
Die
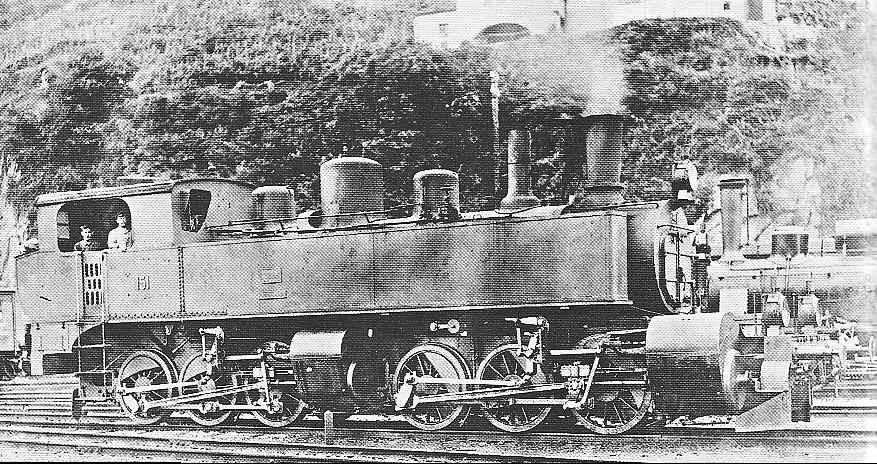 Vergleichen
wir die neue
Vergleichen
wir die neue
 Die
Die
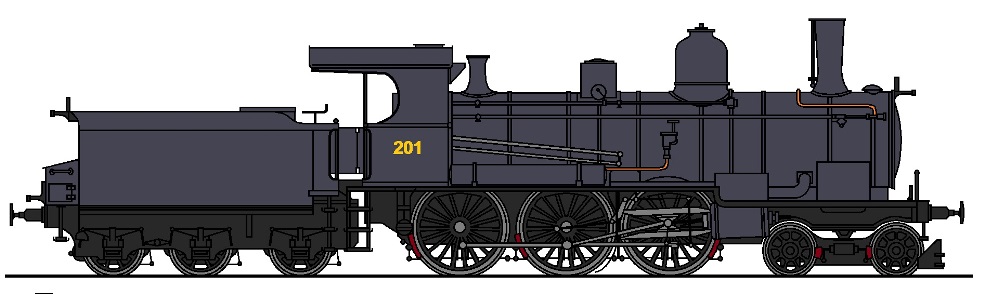 Die
Die
 Dennoch
erfolgte 1902 die Ablieferung von vier weiteren
Dennoch
erfolgte 1902 die Ablieferung von vier weiteren