|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir nun das Thema
Druckluft
aufnehmen, dann kann eigentlich erwähnt werden, dass diese nicht vorhanden
war. Wenn wir jedoch so arbeiten würden, dann wären wir nicht korrekt. Die
Aussage kann nur auf die sechs
Prototypen
und die Maschinen mit den Nummern 51 bis 66 angewendet werden. Die anderen
Lokomotiven
dieser Baureihe kamen nach dem Jahr 1890 in den Betrieb und daher änderte
sich vieles.
Wir werden uns daher in den nächsten
Abschnitten nur mit diesen neueren Maschinen befassen. Die älteren Modelle
dieser Baureihe kommen dann spä-ter bei den mechanischen Bauteilen hinzu. Wie gross die Auswirkungen der neuen Bremsen war, zeigte sich bereits bei der Vorstellung des Auf-baus. Da für die neuen Bauteile Platz benötigt wurde, musste ab der Nummer 67 auf die Wasser-kästen verzichtet werden. Diese hatten durchaus einen Vorteil, der
aber nicht mehr umgesetzt werden konnte, weil nun die
Druckluft
erzeugt und gespeichert werden musste. Der Platz fand sich also nur auf
deren Kosten. Um die Druckluft erzeugen zu können, wurde vor dem Führerhaus auf der linken Seite eine Luftpumpe montiert. Diese wurde mit Dampf über einen Regu-lator in Gang gesetzt. Dabei war der
Regulator
aber so ausgelegt worden, dass der Druck des Dampfes auf einen Wert von
acht
bar
verringert wurde. Das war erforderlich, da die weiteren Bauteile für die
Druckluft
nicht für einen höheren Wert ausgelegt worden waren. Durch die Reduktion des Dampfdruckes kam es
zur Situation, dass die
Luftpumpe
bei offenem
Regulator
einfach stehen blieb, wenn der
Luftdruck
im pneumatischen Teil den gleichen Wert erreichte. So wurde wirksam
verhindert, dass bei einem im Betrieb vergessenen Regulator, die
Druckluft
so stark anstieg, dass es zu einem Platzen der Leitungen kommen konnte.
Ein Schutz, der ein
Überdruckventil
nicht mehr erforderlich machte.
Um dieses Problem zu verhindern, wurde vor
der
Luftpumpe
ein Druckluftbehälter auf dem Umlaufblech montiert. Dessen Volumen war
genug gross bemessen worden um das Problem zu verhindern. Eine Einrichtung, die es erlaubt hätte in dem Behälter die Druckluft zu speichern, war jedoch nicht vorhanden. Eine Dampflokomotive konnte man ohne diesen Vorrat in Betrieb nehmen. Wenn der Dampfdruck im
Kessel
für die Fahrt hoch genug war, konnte auch die
Druckluft
erzeugt werden. So waren auch die pneumatischen
Bremsen
bereit, wenn losgefahren wurde. Bevor wir dazu kommen, noch ein Punkt, den
wir ansehen wollen. Es handelt sich um einen Punkt, bei dem immer wieder ange-nommen wurde, dass er bei Lokomotiven mit Druckluft durch diese betrieben wurde. Das war jedoch bei den Dampflokomotiven nicht der Fall, da man dazu den Dampf nutzen konnte. Um diesen Punkt aber zu behandeln, baue ich
diesen hier ein. Das Thema waren die akustischen Signalmittel der
Lokomotive,
die natürlich bei allen Modellen dieser Baureihe vorhanden waren. Um akustische Signale zu erzeugen, war auf dem Dach des Füh-rerhauses eine Lokpfeife montiert worden. Diese wurde mit den Druck im Kessel betrieben und konnte mit einem mechanischen Gestänge nach den Wünschen des Lokomotivpersonals geöffnet werden. So konnte das Personal also je nach
Zugkraft
ein lauteres oder leiseres Signal erzeugen. Je grösser der Dampfdruck
jedoch war, desto lauter sollte auch akustische Signal sein. Da es bei dieser Baureihe zwei
unterschiedliche Werte für den Dampfdruck gab, hatten nicht alle
Lokomotiven
das gleich laute akustische Signal erhalten. Die Werte werden wir später
bei der Vorstellung der
Kessel
noch ansehen. Hier behandeln wir die
Druckluft
und diese wurde auf den damit ausgerüsteten Modellen nur für einen Bereich
benötigt. Diesen müssen wir nun ansehen und daher sind wir wieder bei den
Nummern 67 bis 83. Es wurden zwei
Bremssysteme
bei den
Druckluftbremsen
verbaut. Diese wirkten immer auf die mechanischen Bauteile der
Lokomotive
und des
Tenders.
Wobei nicht beide Systeme die gleiche wirkweise hatten. Ich beginnen die
Betrachtung mit der etwas einfacheren Lösung, die auf die mechanischen
Bremsen
des Tenders und der Lokomotive wirkte. Daher konnte jetzt die volle
Bremskraft
genutzt werden. Einfacher im Aufbau war die direkt wirkende
Regulierbremse
nach der
Bauart
Westinghouse.
Bei dieser wurde eine Leitung über das
Regulierbremsventil
mit einem veränderlichen
Luftdruck
gefüllt. Dabei konnte in der Leitung maximal ein Druck erzeugt werden, der
bei 3.5
bar
lag. Damit war diese
Bremse
auch aktiv, wenn der Vorrat bei der
Druckluft
unter dem Regeldruck von acht bar lag. Doch nun zur Leitung. Bezeichnet wurde die Leitung als
Regulierleitung
und sie wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt. Dort stand sie dann in zwei
Luftschläuchen
bereit. Diese Schläuche hatten spezielle
Kupplungen
und sie waren mit einem am Stossbalken montierten
Absperrhahn
versehen worden. Dank den Kupplung lösten sich die Schläuche bei einer
Zugstrennung
und damit kommen wir auch gleich zur Wirkung der
Bremse.
Diese spezielle Eigenschaft gab der
Bremse
den Namen. Sie hatte jedoch einen Nachteil. Bei einer
Zugstrenn-ung
entwich die
Druckluft
aus der Leitung und es war keine Bremswirkung mehr vorhanden. Daher musste
ein zweites System verbaut werden. Beim zweiten Bremssystem der Lokomotive handelte es um eine indirekt wirkende Bremse. Wegen den hier verbauten Bauteilen wurde von der Westinghouse-bremse gesprochen. Auch jetzt wurde eine Leitung mit Druckluft gefüllt. Dazu war das im
Führerstand
montierte
Führerbrems-ventil
W4
vorhanden. Mit diesem konnte in der als
Hauptleitung
bezeichneten Leitung ein maximaler Druck von fünf
bar
erzeugt werden. Die Hauptleitung war ebenfalls zu den beiden Stoss-balken geführt worden. Dort endete sie in zwei Luftschläuchen, die mit lösbaren Kupplungen und dem am Stossbalken montierten Absperrhahn versehen wur-den. Damit die
Kupplungen
nicht mit jenen der
Regulier-bremse
vertauscht werden konnten, waren andere Lösungen verwendet worden. Damit
wirkte auch diese
Bremse
auf die
Anhängelast
und wir müssen die wirkweise ansehen. Bei der
Westinghousebremse
galten die
Bremsen
als gelöst, wenn der
Luftdruck
in der
Hauptleitung
einen Wert von fünf
bar
hatte. Um damit eine
Bremsung
zu bewirken, musste der Luftdruck in der Hauptleitung abgesenkt werden.
Dadurch wirkte diese Bremse auch auf der
Anhängelast,
wenn es zu einer
Zugstrennung
gekommen ist. In diesen Zusammenhang wurde fachlich oft auch von einer
Sicherheitsbremse gesprochen.
Wir müssen uns daher die Wirkung dieses
Steuerventils
ansehen. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass dieses
Ventil
nur auf der
Lokomotive
verbaut wurde. Das Steuerventil W1 von Westinghouse war ein einlösiges Ventil. Wurde der Druck in der Hauptleitung abgesenkt, steuerte des Ventil um und leitete Druckluft in den Bremszylinder. Dabei war nun ein maximaler Druck von 3.9 bar vorhanden. Wurde nun aber der
Luftdruck
in der
Hauptleitung
wieder erhöht, löste sich die
Bremse
voll-ständig. Dabei spielte es keine Rolle, ob wieder der Regeldruck von
fünf
bar
erreicht wurde. Benutzt wurde diese Westinghousebremse um mit einem Zug eine Abbremsung vorzunehmen. Dabei war die Leitung zum Bremszylinder so aufgebaut worden, dass eine allenfalls wirkende Regulierbremse überlagert wurde. Da der
Tender
nur die
Regulierbremse
besass, war dort der leicht höhere
Luftdruck
im
Bremszylinder
nicht vorhanden. Eine Lösung, die bei Dampflokomotiven durchaus üblich war
und die gut funktionierte. Die beiden Bremszylinder bei der Lokomotive und beim Tender wurden mit Druckluft ausgestossen und bewegten so das angeschlossene Bremsgestänge. Wurde die Luft wieder reduziert sorgte eine Rückholfeder dafür, dass die Bremse auch sicher gelöst wurde. Mit dem
Bremsgestänge
haben wir nun den pneumatischen Teil abgeschlossen. Mit dem Wechsel zu den
mechanischen Bauteilen kommen nun auch die älteren Modelle dazu. Wir werden nun also die mechanischen
Bremsen
aller
Lokomotiven
ansehen. Dabei muss gesagt werden, dass diese nicht bei allen Maschinen
identisch ausgeführt wurden. Dabei gilt aber in jeden Fall, dass die
mechanische Bedienung auf bei den Maschinen mit
Druckluftbremse
immer wirkte und dort sogar den
Bremszylinder
überlagern konnte. Damit galt, dass die mechanische Wirkung jederzeit
vorhanden war. Die
Bremsgestänge
des
Tenders
und der
Lokomotive
konnten aus dem
Führerhaus
mit einer
Handbremse
bewegt werden. Dabei gilt jedoch zu erwähnen, dass diese bei den Modellen
mit
Druckluftbremse
nur noch beim Tender vorhanden war. Der Grund lag dabei in der Tatsache,
dass diese Bedienung dort nur noch zum sichern der abgestellten Lokomotive
genutzt wurde. Dazu reichte die Wirkung des Tender problemlos aus. Wir werden nun die beiden Fahrzeuge
getrennt ansehen. Dabei beginne ich mit der
Lokomotive.
Das
Bremsgestänge
konnte mit einem manuellen
Gestängesteller
an die Abnützung der
Bremsklötze
angepasst werden. Diese
Bremsgestängesteller
waren erforderlich, da die Lokomotive mit einer
Klotzbremse
ausgerüstet worden war. Bei der Anordnung der einzelnen Bremsklötze gab es
nun einen Unterschied, denn wir ansehen müssen.
Da die
Bremsklötze
aus Grauguss bestanden, erfolgte an diesen die Abnützung, die in Form von
Bremsstaub
anfiel. Der Unterschied bei den Maschinen bestand nun aber bei den
ge-bremsten
Achsen. Bei den sechs Prototypen mit den Nummern 41 bis 46 wirkte jeweils ein Bremsklotz von vorne auf die Räder der Achsen eins und zwei. Die hier leicht nach hinten verschobene mittlere Triebachse war eine direkte Folge der verbauten Bremse.
Nur so war ausreichend Platz vorhanden. Die dritte
Achse
wurde nur über den starren
Stangenantrieb
gebremst. Das bedeutete, dass die
Bremskraft
verteilt werden konnte. Am letzten Grundsatz änderte sich bei den Lokomotiven der beiden Serien nichts. Auch hier wirkte die Klotzbremse auf zwei Achsen. Jedoch wurden die Bremsklötze anders angeordnet. Sie wirkten nun auf die mittlere und die
hintere
Triebachse.
Dabei erfolgte dies bei der mittleren
Achse
von hinten und bei der hinteren von vorne. Mit anderen Worten, die
Klotz-bremsen
waren unmittelbar bei einander angeordnet worden. Wenn wir nun zu den mechanischen Bremsen des Tenders kommen, ändert sich beim Gestänge nichts und hier waren alle Kohlenwagen gleich ausgerüstet worden. Auch hier war ein manueller Bremsgestängesteller verbaut worden. Das Gestänge wirkte nun aber auf alle
Räder
und diese wurden von beiden Seiten mit einem
Bremsklotz
an der freien Drehung gehindert. Das bedeutet, dass hier somit acht Klötze
vorhanden waren. Das führte nun dazu, dass der
Tender
über eine gute
Bremskraft
verfügte. Das ist auch der Grund, warum die
Spindelbremse
bei den
Lokomotiven
mit pneumatischer
Bremse
nur noch hier vorhanden war und bei der Maschine entfernt wurde. Die
Kurbel konnte, wie bei allen anderen Modellen dieser Baureihe beim Tender
arretiert werden. Deshalb war hier eine Stillhaltebremse vorhanden, die
ausreichte um das ganze Fahrzeug zu sichern.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
Die
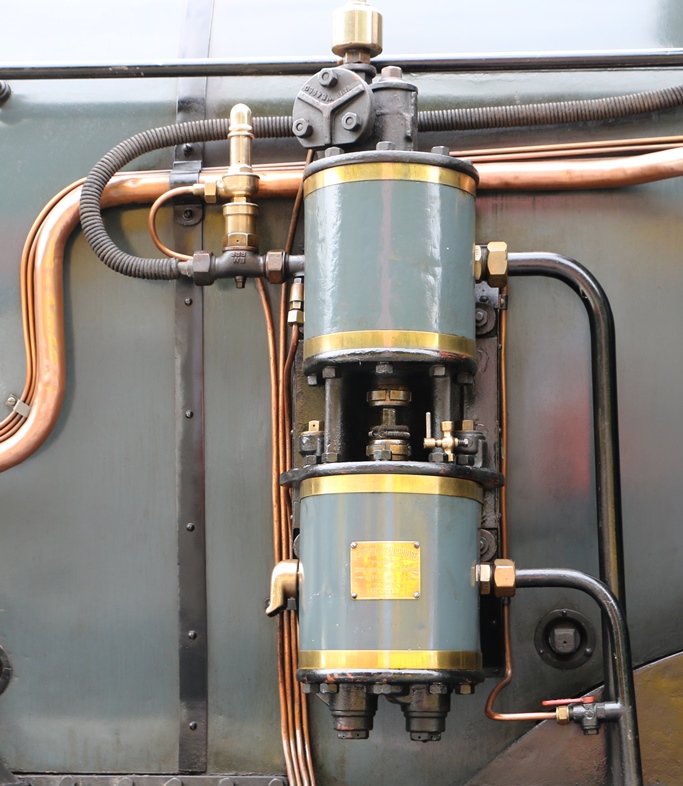 Das
Problem der
Das
Problem der
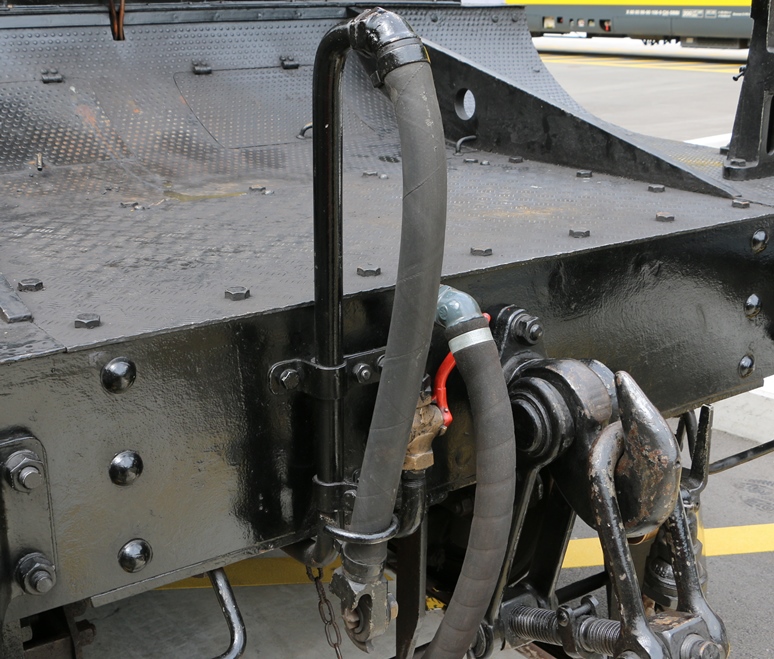 Die
Die
 Im
Im
 Die
Die