|
Dampfmaschine, Steuerung und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der dem
Dampfdom
entnommene und im
Überhitzer
erzeugte
Heissdampf
wurde anschliessend einem einfachen Dampfrohr zugeführt. Dieses Rohr
leitete den Dampf bei den in Serie gebauten
Lokomotiven über die beiden
Schieberkasten
zu den beiden innen liegenden
Dampfmaschinen.
Bei den
Prototypen
galt das auch für die aussenliegenden
Zylinder.
Daher sprach man bei diesen beiden Maschinen auch von einem Vierling.
Der massgebende Durchmesser dieser
Zylinder
war mit 470 mm angegeben worden. Bei den beiden
Prototypen
galt dieser Durchmesser von 470 mm auch für die aussen liegenden
Maschinen. Hier erfolgte keine Unterteilung der Zylinder, da diese
parallel betrieben wurden. Die innen liegenden Zylinder waren dabei massgebend für die maximale Grösse. Diese konnten daher gegenüber bereits vorhandenen Maschinen nicht mehr gesteigert werden.
Der Grund dafür war simpel, denn innerhalb des Rahmens fehlte
schlicht der Platz für eine Erweiterung. Die in einem Zylinderblock
montierten
Zylinder
benötigten um die Kräfte zu beherrschen eine gewisse Wandstärke. So wurde
der Platz optimal ausgenutzt.
Bei den beiden
Prototypen
mit den Nummern 2901 und 2902 haben wir die ganze Angelegenheit mit den
Dampfmaschinen
eigentlich schon erledigt. Der Abdampf von den vier Maschinen wurde einem
Sammelrohr zugeführt, das in die
Rauchkammer
geleitet wurde und dort im
Blasrohr
endete. Damit wurde der nur einfach genutzte Dampf über den
Kamin
ins Freie geblasen. Ein Vorgang, der bei Mehrlingen nicht anders gelöst
werden konnte.
Kommen wir zu den
Lokomotiven der Serie. Dort wurde die Sache jedoch
anders ausgeführt. Der Dampf von den
Hochdruckzylindern
wurde einem Rohr zugeführt, das Verbinder genannt wurde. Dieses Rohr, das
im
Schieberkasten
der äusseren
Dampfmaschinen
endete, gab der
Bauart
Verbund
letztlich den Namen. Damit konnte eine weitere Ausnutzung der Kraft
erfolgen, was eine wirtschaftlichere Ausnutzung des Dampfes darstellte.
Diese
Niederdruckzylinder
mussten, wollte man genügend Kraft aufbauen, deutlich vergrössert
ausgeführt werden. Daher bekamen die in Serie gebauten
Lokomotiven gegenüber den
Prototypen
riesige
Zylinder.
Man konnte so die Lokomotiven gut unterschieden. Der Durchmesser für die Niederdruckzylinder war nicht bei allen Maschinen gleich. So wurden die Lokomotiven mit den Nummern 2951 bis 2953 mit Zylindern von 710 mm Durchmesser ausgerüstet.
Grössere
Niederdruckzylinder
sollte es in der Schweiz nicht mehr geben. Selbst die weiteren
Lokomotiven dieser Baureihe begnügten sich mit
690 mm. Wobei das natürlich auch mächtige Niederdruckzylinder waren, die
der Lokomotive ein markantes Gesicht gaben. Durch die unterschiedlichen Zylinder konnte man die Verbundlokomotiven mit einem Booster ausrüsten. Dazu wurde im Verbinder ein Wechselventil eingebaut.
Über dieses
Ventil
konnte nun Frischdampf vom
Kessel
den beiden
Niederdruckzylindern
zugeführt werden. Diese Methode war schon bei den
A 3/5
der
Gotthardbahn
verwendet worden. Die Verbundlokomotive wurde zum normalen Vierling und
hatte eine etwas höhere
Anfahrzugkraft.
Wechselventile waren bei
Lokomotiven mit zusätzlichem Zahnradantrieb sehr
oft verwendet worden, weil man so
Zylinder zu oder abschalten konnte. Als
Nachteil dieses
Boosters galt bei dieser Maschine jedoch, dass er extrem
viel Dampf aus dem
Kessel
benötigte. Das hatte zur Folge, dass der Druck
im Kessel schnell absackte. Daher wurde diese Umschaltung eigentlich nur
als Anfahrhilfe bei schweren Anfahrten verwendet.
Mit den
Dampfmaschinen
haben wir auch den für die
Leistung der
Lokomotive
bestimmenden Teil kennen gelernt. Dabei wurden für die Serie eine Leistung
von 1 620 PS aufgeführt. Nach heutiger Lesart wären das 1 190 kW. Die als
Vierling ausgeführten
Prototypen waren mit 1 460 PS oder 1 074 kW etwas
schwächer. Hier zeigte sich zudem auch der etwas geringere Druck des
Dampfes. Bei allen Maschinen wurde die massgebende Geschwindigkeit bei 25
km/h festgelegt.
Bei
den Inneren
Hochdruckzylindern aller
Lokomotiven wählte man ein Neigungsverhältnis
von
1 :
8. Aussen wurde das Verhältnis bei allen Maschinen mit
1 :
40
angegeben. Die steile innere Montage war wegen der ersten
Triebachse
wichtig. Der beim Stangenantrieb erforderliche Versatz der Dampfmaschinen wurde mit den Steuerungen umgesetzt. Dabei wurden die einzelnen Triebwerke einer Seite mit einem Versatz von 90 Grad eingebaut.
Die beiden Seiten waren
hingegen um 180 Grad versetzt eingebaut worden. Das war eine bei
Lokomotiven mit vier
Zylindern übliche Anordnung der
Dampfmaschinen
und
ermöglichte der Lokomotive einen ruhigen Lauf. Unterschiedlich war die Folge der Auspuffschläge. Pro Radumdrehung kam es bei den beiden Prototypen wegen dem Vierling zu acht Auspuffschlägen.
Bei
den in Serie gebauten Verbundmaschinen kam es jedoch nur zu vier
Auspuffschlägen. Da sich bei den beiden
Prototypen zwei Auspuffschläge
überlagerten, hatten alle
Lokomotiven im hörbaren Bereich die gleiche
Anzahl Auspuffschläge. Es gab daher keinen akustischen Unterschied.
Gesteuert wurden die
Dampfmaschinen
mit Hilfe einer vom
Stangenantrieb
beeinflussten Steuerung. Dabei wurden die inneren
Zylinder der in Serie
gebauten
Lokomotiven mit einer Steuerung nach
Joy versehen. Bei den beiden
Prototypen wurde jedoch auf den Einbau einer eigenen Steuerung für die
innen montierten Zylinder verzichtet. Eine Lösung, die bisher bei vielen
Lokomotiven mit vier Maschinen so umgesetzt wurde.
Die Lösung nach
Walschaerts
war eine
Entdeckung, die im gleichen Zeitraum auch von
Heusinger gemacht wurde.
Daher wurde die Lösung mit einer gebogenen Schmiege überall in der Welt
verwendet, hatte aber nicht in allen Ländern die Bezeichnung
Walschaertssteuerung. Um die Fahrrichtung der Lokomotive zu ändern, musste man die Schmiege der Steuerung umlegen. Dadurch wurden die Dampfzylinder geändert mit Dampf versorgt.
War die Schmiege in der Mitte, lief die
Dampfmaschine
im
Leerlauf und wurde nicht mit Dampf versorgt. Durch die unterschiedlichen
Stellungen waren auch unterschiedliche Füllmengen möglich, wodurch die
Zugkraft
optimal reguliert werden konnte. Das Triebwerk der Lokomotive bestand aus vier einzelnen Antrieben. Dabei waren optisch nur die beiden äusseren, bei der Serie mit Niederdruck-zylindern betriebenen, Antriebe zu erkennen.
Wir beginnen die
Betrachtung jedoch mit den inneren nicht zu sehenden
Antrieben mit
Hochdruckzylinder. So erhalten wir bei den
Triebwerken wieder die gleiche
Reihenfolge, wie wir sie von den einzelnen
Dampfmaschinen her kennen.
Der
Zylinder des inneren
Triebwerkes arbeitete mit einem Kolbenhub von 640
mm mit der
Kolbenstange auf das
Kreuzgelenk. Dieses war beidseitig geführt
und lenkte die Bewegung auf die
Schubstange um. Diese wiederum war mit der
zweiten
Achse, die gekröpft ausgeführt worden ist verbunden. Da mit den
Triebstangen den Weg über die erste Achse genommen werden konnte, erfolgte
der Einbau der Zylinder hoch und in einem relativ steilen Winkel.
Die
Lager dieses
Antriebes wurden als übliche
Gleitlager ausgeführt und
sie verfügten über Lagerschalen aus Weissmetall, das eine gute
Eigenschmierung hatte. Die notwenige Zufuhr des zusätzlich benötigten
Schmiermittels erfolgte über eine damals übliche Nadelschmierung, die von
der zentralen Schmierpumpe mit
Öl versorgt wurde. Diese Lösung war nötig,
weil auf der Fahrt keine Nachschmierung dieser Lager möglich war.
Wir haben damit den sehr einfach aufgebauten inneren Teil des
Antriebes
kennen gelernt. Daher können wir nun zu den äusseren
Triebwerken wechseln.
Dabei betrachten wir auch hier nur eine Seite der
Lokomotive. Mit Ausnahme
des Versatzes waren diese identisch ausgeführt worden. So können wir uns
eine Seite getrost ersparen, was die Angelegenheit bei diesem sehr
aufwendigen Triebwerk deutlich vereinfacht.
Das war eine durchaus übliche Lösung bei Zylindern, deren Kolben zum Abknicken neigten. Für den Antrieb hatte das jedoch nichts zu bedeuten, so dass wir uns der Kolbenstange und dem Kreuzgelenk zuwenden können.
Das
Kreuzgelenk des äusseren
Triebwerkes war einseitig geführt worden. Es
lenkte die Kraft der
Dampfmaschine
von der
Kolbenstange auf die
Triebstange
um. Damit trotz der einseitigen Führung ein stabiles
Kreuzgelenk vorhanden war, wurde eine massive und damit schwere Führung
verwendet. So war gesichert, dass die Kraft optimal auf die an der
Schubstange angeschlossene dritte
Triebachse übertragen wurde.
Diese
Bauart war nach De Glehn ausgeführt worden. So wurden bei dieser
Bauart zwei
Achsen der
Lokomotiven direkt angetrieben. Dabei kam hier
eigentlich gegenüber den üblichen, so gebauten Lokomotiven einfach eine
vorlaufende
Triebachse hinzu. Das war eine direkte Folge der Tatsache,
dass hier an Stelle des bisher verwendeten
Laufdrehgestelles
lediglich eine
Laufachse vorhanden war. Daher fehlte schlicht der Platz.
Mit einer einfachen
Triebstange
wurden die beiden
Achsen verbunden. Ein
abknicken der
Kuppelstange war in diesem Bereich jedoch nicht möglich, so
dass wir hier zwei fest verbundene
Triebachsen erhalten haben. Daher war
auch der Knickpunkt der
Lokomotive vorgegeben, denn auch diese kippte beim
Befahren von Kuppen um diese beiden Achsen. Entsprechend ausgelegt wurde
daher die
Federung der einzelnen Triebachsen.
Dadurch
war aber bei der dritten
Achse ein grosses Gewicht angebaut worden. Dieses
wurde mit einem massiven Gegengewicht im
Rad ausgeglichen. Wegen den
kleinen
Triebrädern wirkte dieses Gewicht noch wuchtiger, als es war.
Damit haben wir einzig die vorlaufende erste
Triebachse nicht mit den
beiden Triebachsen verbunden. Hier wurde die Sache bei den meisten
Maschinen etwas komplizierter. So musste das Stangenlager eins bei den
Lokomotiven mit dem
Krauss-Helmholtz-Drehgestell längs verschiebbar
ausgeführt werden. Nur so wurde die radiale Einstellung der Triebachse
nicht behindert. Bei den anderen Maschinen waren einfachere
Lager
verwendet worden.
Alle
Triebstangen
und deren
Gelenke waren als
Gleitlager mit Lagerschalen
aus Weissmetall ausgeführt worden. Diese
Lager mussten mit
Öl zusätzlich
geschmiert werden. Dieses
Schmiermittel wurde über eine Nadelschmierung
dem Lager zugeführt. Diese Lösung war bei Triebstangen üblich und da hier
ein leichter Zugang erfolgen konnte, wurde der Vorrat an Öl unmittelbar
beim Lager vorgesehen. Dabei kamen jedoch unterschiedliche Volumen zur
Anwendung.
Somit haben wir den
Antrieb fertig aufgebaut und können uns nun den
Zugkräften zuwenden. Dabei wurde die Kraft der
Dampfmaschinen über die
Triebstangen
und die
Kurbelzapfen auf die
Triebachse übertragen. Dort
wurde wiederum mit Hilfe der
Haftreibung zu den
Schienen eine Zugkraft
erzeugt. Die Zugkraft dieser
Lokomotiven war mit 145 kN sehr hoch
ausgefallen und führte dazu, dass diese Baureihe die kräftigste
Dampflokomotive der Schweiz war.
Um auch bei schlechtem Schienenzustand diese damals gigantischen
Zugkräfte
auf die
Schienen übertragen zu können, mussten bessere Reibungswerte
erreicht werden. Daher erhielt die
Lokomotive eine
Sandstreueinrichtung,
die vor den
Triebachsen eins und zwei wirkte. Diese Lösung reichte
durchaus und mehr
Sander
waren damals gar nicht nötig. So können wir hier
von einer normalen Ausführung der Einrichtung sprechen.
Der Sand wurde über dem
Kessel in einem Sandkasten gelagert. Bei diesen
Lokomotiven erhielten der
Dampfdom und der Sandkasten ein gemeinsames
Gehäuse, so dass kein Sandkasten erkennbar war. Durch Rohrleitungen
gelangte der
Quarzsand vor die
Räder der beiden
Triebachsen. Die
Einrichtung funktionierte dabei lediglich mit der Hilfe der Schwerkraft
und war nicht mit
Druckluft unterstützt worden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
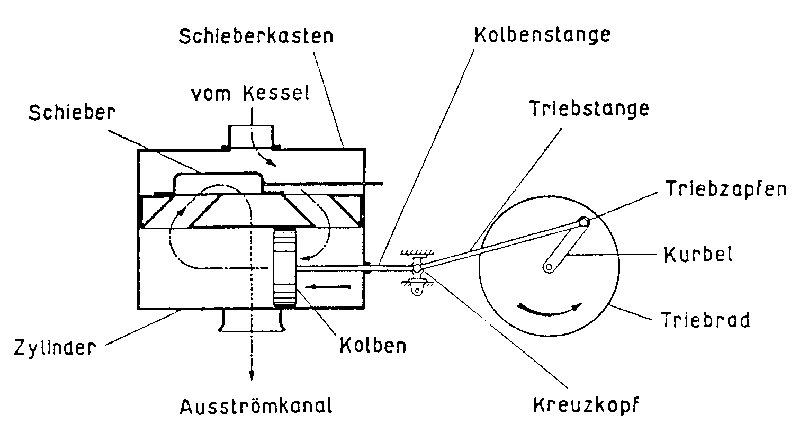 Die
inneren
Die
inneren
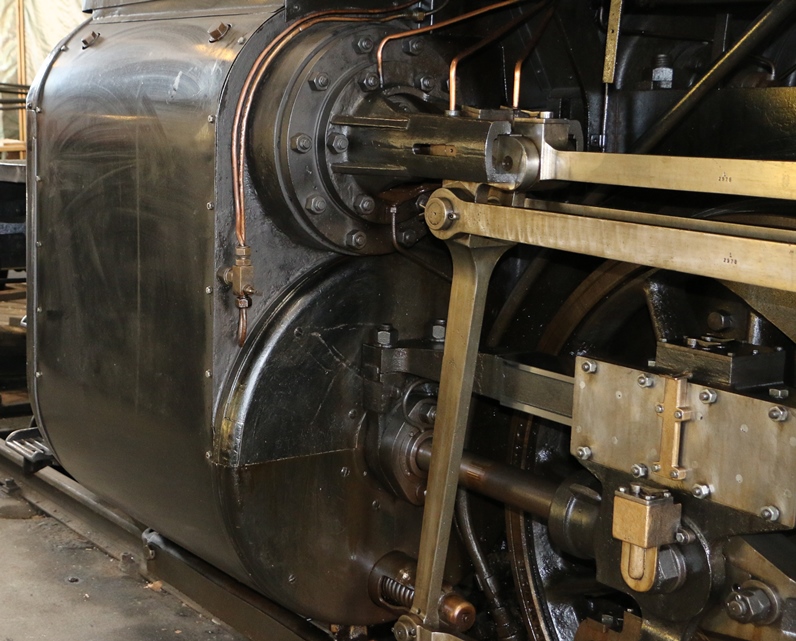 Da
nun die Versorgung mit teilweise entspanntem Dampf erfolgte, war der Druck
etwas niedriger. Deshalb wurde bei diesen
Da
nun die Versorgung mit teilweise entspanntem Dampf erfolgte, war der Druck
etwas niedriger. Deshalb wurde bei diesen
 Beim Einbau der
Beim Einbau der
 Aussen wurde die gut funktionierende Steuerung nach
Aussen wurde die gut funktionierende Steuerung nach 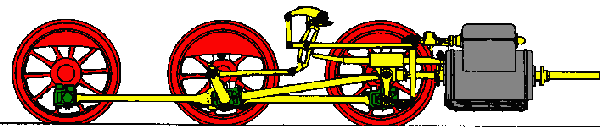 Beim äusseren
Beim äusseren 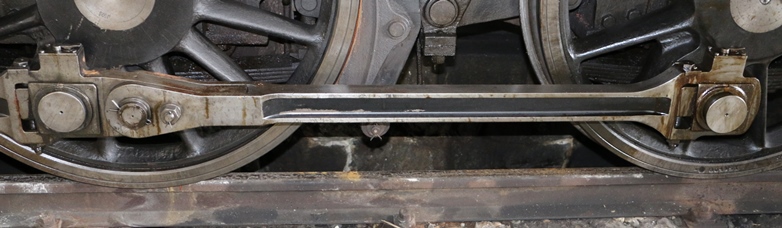 Die
Die