|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Ein rollendes Fahrzeug sollte gebremst werden können. In diesem
Punkt zeigten sich auch die Dampflokomotiven nicht anders. Dabei kamen in
der Zeit, als diese
Lokomotiven
gebaut wurden, bereits
Druckluftbremsen
zum Einsatz. Diese hatten sich bei den
Reisezügen bewährt und wurden immer öfters auch bei
den
Güterzügen
angewendet. Deutlicher kann man den Vorteil nicht aufzeigen. Jedoch
benötigen diese
Bremsen
Druckluft.
Mit der hier erfolgten Montage der
Luftpumpe
konnten kurze Leitungen verwendet werden. Man musste auf das Gewicht
achten, daher versuchte man Leitungen so kurz wie möglich zu halten.
Gerade bei der Erzeugung der
Druckluft
waren viele Leitungen erforderlich. Bei der Luftpumpe wurde mit der Hilfe von Dampf aus dem Kessel ein Kolben bewegt, dieser Kolben wurde über eine Stange mit einem zweiten Kolben verbunden.
Der begann durch die Bewegung mit Hilfe von Rückschlagventilen
Luft eine Leitung zu schöpfen. Man erzeugte daher die
Druckluft
nicht in der
Luftpumpe,
sondern in dem daran angeschlossenen Leitungssystem. Wurde dort keine Luft
entnommen, stieg der Druck an.
Damit für die
Bremsen
immer genug
Druckluft
bereit stand, wurde die Luft in einen Druckbehälter geschöpft. Dieser
wurde im Rahmen unter dem
Kessel
im Bereich der vierten
Triebachse
montiert. Einen Abschluss, damit die Luft in diesem Behälter gespeichert
werden konnte, gab es jedoch nicht, denn für den Betrieb der
Luftpumpe
reichte es aus, wenn genügend Dampf im
Kessel
vorhanden war. So lange hier aber keine Luft entnommen wurde, stieg der
Druck an.
Für das System der
Lokomotive
wurde ein maximaler Druck von acht
bar
angegeben. Dieser wurde von der
Luftpumpe
erzeugt und zwar durch die Reduktion des Druckes beim Dampf. Erreichte die
Luftpumpe den Wert, stellte sie, weil die Kräfte des Dampfes und der
Druckluft
gleich waren, automatisch ab. Daher war eine automatische Regelung der
Erzeugung von Druckluft vorhanden, die sogar sehr feinfühlig arbeiten
konnte.
Speziell war, dass man bei dieser
Lokomotive
eine doppelt wirkende
Luftpumpe
einbaute. Diese schöpfte Luft bei jedem Kolbenhub. So konnte die
Leistung
bei der Luftpumpe gesteigert werden. Das war besonders bei der Bespannung
von
Güterzügen
wichtig, da deren Länge sehr viel
Druckluft
benötigte. Daher konnte man hier auf die, normalerweise übliche zweite
Luftpumpe verzichten. Ein Punkt der erwähnt werden muss.
Es muss erwähnt werden, dass beim Bau dieser
Lokomotiven
die
Güterzüge
zu einem grossen Teil von Hand gebremst wurden. Jedoch fanden bereits die
ersten Versuche mit luftgebremsten Güterzügen statt. Diese zeigten, dass
diese viel mehr Luft benötigen, als die kurzen
Reisezüge. Daher rüstete man vorsorglicherweise die
neuen Lokomotiven mit den leistungsfähigen
Luftpumpen
aus. Schliesslich war klar, dass es solche Güterzüge geben wird.
Eine weitere Aufbereitung der
Druckluft
erfolgte jedoch nicht mehr. So gab es weder einen Wasserabscheider noch
Absperrhähne.
Ein Umstand, der gerade bei Dampflokomotiven aufzeigt, wie viele
Funktionen man mit dem Dampf und dem heissen Wasser aus dem
Kessel
verwirklichen konnte. Jedoch wurden hier nicht mehr alle möglichen
Lösungen umgesetzt und dabei war eine betrieblich wichtige Sache, die wir
uns ansehen müssen.
Um die langen und steilen Gefälle der Gotthardstrecke zu befahren,
benutzte die
Gotthardbahn an ihren
Lokomotiven
Gegendruckbremsen.
So konnte der Verschleiss der
Bremsklötze
verringert werden. Jedoch zeigten die neuen Baureihen, dass mit den dort
vorhandenen Möglichkeiten keine befriedigende Lösung für die
Bremse
mehr gefunden werden konnte. In den grossen
Zylindern
konnte schlicht kein genügend grosser Gegendruck erzeugt werden.
Das zeigten die Erfahrungen mit der Baureihe
A 3/5
der
Gotthardbahn deutlich auf. Bei der Baureihe C 5/6, wo die
Zylinder
noch einmal eine Nummer grösser waren, verzichtete man daher schlicht auf
den Einbau dieser
Bremse.
Das hatte zur Folge, dass die Maschine auf der Talfahrt mit der
Druckluftbremse
abgebremst werden musste. Dementsprechend sorgfältig musste die mit
Druckluft
betriebene Bremse ausgelegt werden.
Bei der
Bremseinrichtung
setzte man auf die bewährten und gut funktionierenden Baugruppen aus dem
Hause
Westinghouse.
Diese oft auch als Doppelbremse bezeichnete Bremsausrüstung, arbeitete mit
zwei unabhängigen pneumatischen
Bremsen.
Dazu gehörten die
Regulierbremse
und die
automatischen Bremse
der
Bauart
Westinghouse. Diese beiden
Bremssysteme
wurden für verschiedene Zwecke und Einsätze benötigt.
Dabei wurde der Druck reduziert, so dass in dieser Leitung der Druck maximal 3.9 bar betragen konnte.
Um die Bremsung einzuleiten musste der Druck in der
Bremsleitung
erhöht werden. Je höher der Druck war, desto besser wirkte die
Bremse. Die Regulierbremse wurde auch zu den beiden Stossbalken geführt und stand dort in einer Schlauchleitung bereit.
So konnte die direkte
Bremse
durch den Zug verbunden werden. Damit konnte ein Zug auf der Talfahrt,
aber auch die alleine fahrende
Lokomotive,
zurückgehalten werden. Der Nachteil hingegen war, dass sich die Bremse bei
einer
Zugstrennung
automatisch löste und so keine Bremswirkung mehr vorhanden war.
Damit eine der Sicherheit dienende
Bremse
vorhanden war, musste man die
Regulierbremse
mit einem weiteren
Bremssystem
ergänzen. Diese Bremse sollte genutzt werden, wenn der Zug abbremsen
musste und sollte auch wirken, wenn es zu einer
Zugstrennung
gekommen ist. Daher wurde hier die
Westinghousebremse
als zweites Bremssystem eingebaut. Die Doppelbremse nach
Westinghouse
war damit perfekt.
Bei der
automatischen Bremse
wurde eine
Bremsleitung,
die als
Hauptleitung
bezeichnet wurde, mit einem Druck von fünf
bar
gefüllt. Auch diese Leitung wurde über die
Stossbalken
durch den ganzen Zug verbunden. Der Schlauch hatte dabei spezielle
Kupplungen
und konnte dank dem erforderlichen
Absperrhahn
deutlich von der Leitung der
Regulierbremse
unterschieden werden. Fehlerhafte
Verbindungen
waren daher ausgeschlossen.
Die
Druckluft
für die
Hauptleitung
wurde dabei vom Vorratsbehälter bezogen und über ein spezielles
Ventil
mit dem entsprechenden Druck in die Leitung geleitet. Daher benötigte kein
Bremssystem
den vollen Druck im Behälter, so dass ein sicherer Betrieb der
Bremsen
ermöglicht wurde. Gerade hier war der höhere Druck für den Prozess des
Füllens des Bremssystems von grosser Bedeutung. Daher waren acht
bar
im Behälter ideal.
Damit so eine Bremsung ermöglicht werden kann, wurde ein Steuerventil benötigt. Dieses Steuerventil war nach Bauart Westinghouse und es war in einlösiger Ausführung verwirklicht worden.
Das bedeutete unweigerlich, dass sich die
Bremse
vollständig löste, wenn der Druck in der
Hauptleitung
anstieg. Damals war das aber ein üblicher Vorgang. Das Steuerventil konnte noch nicht auf zwei Bremsarten umgestellt werden. Dadurch war es der Lokomotive nur möglich, die schnell wirkende P-Bremse bei Reisezügen zu benutzen.
Bei den
Güterzügen
fanden erst die Versuche statt und die dort benötigte
Güterzugsbremse
war noch nicht bekannt. Wir haben damit aber eine zuverlässige
Sicherheitsbremse bei
Reisezügen erhalten. Damit war ein sicherer Betrieb
der
Lokomotive
möglich.
Ein Punkt bei den
Bremsen
der
Lokomotive
müssen wir noch kennen. So wirkten die beiden
Bremssysteme
nicht überall auf den gleichen
Bremszylinder
und auch nicht überall auf das gleiche
Bremsgestänge.
Gerade im Gebirge, wo ein Bremsgestänge auf der Talfahrt durch Steine
leicht verbogen werden konnte, war das ganz wichtig. Die Unterteilung der
Bremsgestänge erfolgte zwischen der Lokomotive und dem
Tender.
Wenn wir die Betrachtung der mechanischen
Bremsen
beginnen, nehmen wir zuerst die
Lokomotive.
Bei der eigentlichen Lokomotive wirkte die indirekte
automatische Bremse
auf einen
Bremszylinder.
Jedoch nicht auf diesen Bremszylinder wirkend war die
Regulierbremse.
Daher konnte die Lokomotive selber nur mit der Bremse nach
Westinghouse
abgebremst werden. Eine Lösung, die damals bei
Schlepptenderlokomotiven
oft angewendet wurde.
Die Laufachse war, wie das in der Schweiz üblich war, nicht mit einer Bremse versehen worden. Daher konnten nur die Triebachsen herangezogen werden.
Jedoch gab es auch bei den
Triebachsen
ein Problem mit der
Bremse,
so dass eine andere Lösung gesucht wurde. Beim Krauss-Helmholtz-Drehgestell war es schlicht nicht möglich eine Bremse einzubauen. Bei der Laufachse war das kein Problem, aber bei der der Triebachse stellte das eine starke Einschränkung dar.
Da man auf die mögliche Lösung mit einem zweiten
Bremszylinder
verzichten wollte, wurde eine unge-wöhnliche Lösung für das Problem der
ungebremsten ersten
Triebachse
gewählt. Die fast 130 Tonnen schwere
Lokomotive
bremste nur mit vier Triebachsen!
Jedes
Triebrad
der gebremsten
Triebachsen
zwei bis fünf wurde mit einem
Bremsklotz
abgebremst. Um die fehlende
Bremskraft der ersten Triebachse zu
kompensieren, wurde die vierte Triebachse mit einem zusätzlichen
Bremsklotz pro
Rad
versehen. So hatte die
Lokomotive
die übliche Anzahl Bremsklötze, die damals mit zwei Bremsklötzen pro
Achse
angegeben wurde. Hier lag auch der Grund für den erweiterten Achsstand
zwischen der Achse vier und fünf.
Damit hatte die
Lokomotive
eine übliche
Klotzbremse
der damaligen Zeit erhalten und benötigte damit den gleichen Unterhalt,
wie die anderen bereits eingesetzten Baureihen. Wir haben damit aber die
Bremsausrüstung der Lokomotive kennen gelernt. So gesehen war diese
dürftig ausgefallen, aber bei der Lokomotive gab es noch den
Tender
und dieser Wagen konnte auch für die Abbremsung der Lokomotive genutzt
werden.
Auch hier konnte das Gestänge dank einem
Bremsgestängesteller
der Abnutzung der
Brems-klötze
angepasst werden. Selbst die manuelle Nachstellung war identisch
ausgeführt worden. Jedoch war damit noch nicht alles erwähnt worden.
Das
Bremsgestänge
des
Tenders
wurde zusätzlich noch mit der
Handbremse
verbunden. Diese
Bremse
wurde als Spindelbremse ausgeführt und konnte vom
Führerstand
aus bedient werden. Sie diente zum Sichern der stillstehenden
Lokomotive
und als Bremse, wenn die
Druckluftbremsen
versagten. Sie war jedoch nicht als Betriebsbremse ausgeführt worden. Die
Lokomotive wurde somit nur im Stillstand mit der Spindelbremse des Tenders
gesichert.
Der
Tender
hatte eine umfangreichere
Klotzbremse
erhalten. Diese bestand aus den
Bremsklötzen,
die auf die
Laufflächen
der
Räder
wirkten. Da die Räder beidseitig mit einem Bremsklotz ausgerüstet wurden,
hatte der Tender nicht weniger als zwölf Bremsklötze erhalten, was mit
drei
Achsen
zwei Bremsklötze mehr, als bei der
Lokomotive,
ergab. Dadurch war der Tender recht gut abgebremst worden, was bei den
Gefällen des Gotthard sicher sinnvoll war.
Wie wichtig die
Bremse
des
Tenders
war, zeigte sich, wenn mit diesen gerechnet wurde. Dabei waren
Bremsrechnungen
nur für die
automatische Bremse
und für die
Handbremse
üblich. Die Handbremse musste dabei ausreichen um die
Lokomotive
genügend abzusichern. Mit 15 Tonnen
Bremsgewicht
war sie dazu etwas schwach, so dass gerade in den steilen Steigungen
Probleme beim Sichern der Lokomotive entstehen konnten.
Bei der
automatische Bremse
wurde der maximale Bremsdruck erreicht, wenn der Druck in der
Hauptleitung
um 1.5
bar
abgesenkt wurde. Dadurch stieg der Druck im
Bremszylinder
auf 3.9 bar an und die
Bremsklötze
wurden gegen die
Räder
gepresst. Dadurch erreichte die komplette
Lokomotive
ein
Bremsgewicht
von 85 Tonnen. Auf das Gewicht umgerechnet, ergibt sich so ein
Bremsverhältnis
von 65%. Ein für Lokomotiven ansehnlicher Wert.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
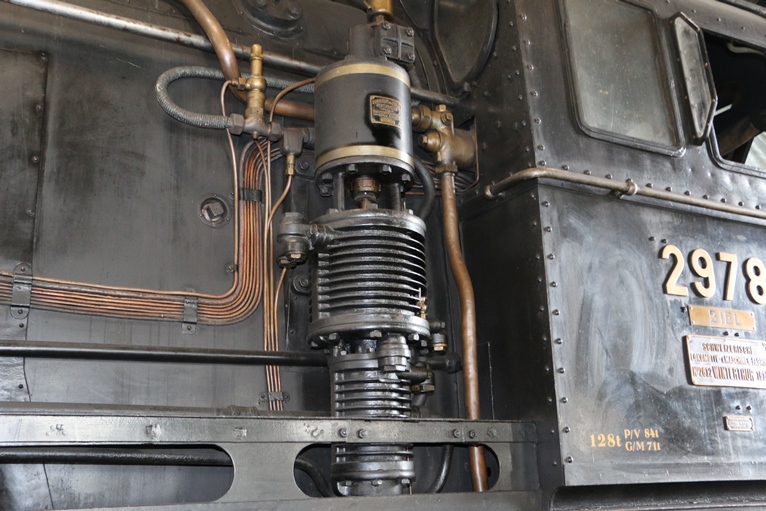 Die
Erzeugung der benötigten
Die
Erzeugung der benötigten 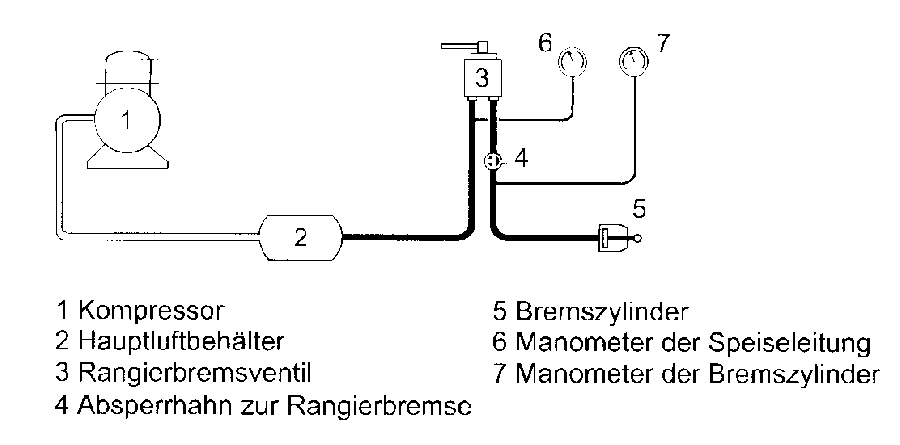 Beginnen
wir mit der direkt wirkenden
Beginnen
wir mit der direkt wirkenden
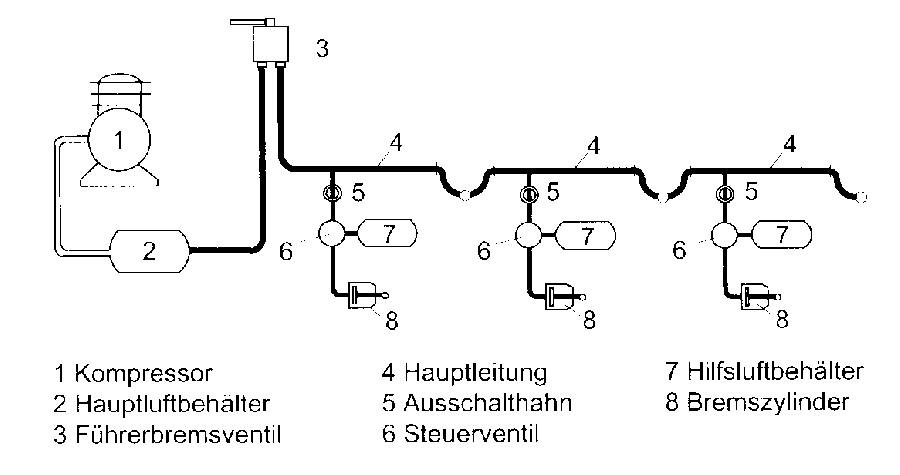 Die
Bremswirkung auf dem Fahrzeug wurde eingeleitet, wenn sich der Druck in
der
Die
Bremswirkung auf dem Fahrzeug wurde eingeleitet, wenn sich der Druck in
der  Der
Der  Beim
Beim