|
Fahrgasteinrichtungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Nachdem wir den
Triebzug
mechanisch soweit aufgebaut haben, dass er rollen konnte, kommen wir zu
den Einbauten. Beginnen werden wir dabei mit den Bereichen, die für die
Fahrgäste zugänglich waren. Letztlich ist das auch jener Teil, den Sie für
die Beurteilung eines Fahrzeuges nutzen. Ihr neues schickes Auto, soll
innen auch gut aussehen. Direktoren von
Bahngesellschaften
unterschieden sich hier nicht.
Somit stelle ich den ETR 610 vor und
erwähnte, wo dies erforderlich ist, die Unterschiede der
Neigezüge,
die den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausge-liefert wurden. Doch wie so
oft müssen wir zuerst hereinkommen. Wir nähern uns dem Triebzug von vorne. Dabei müs-sen wir um in den Zug zu gelangen, die lange Front und die komplette Seitenwand begehen. Die beim Führerstand vorhandene Türe war dem Personal vor-enthalten. Da wir die Begehung mit dem Wagen eins
beginnen, bedeutet das, dass wir in ein Abteil der ersten
Wagenklasse
betrachten werden. Die als Zugang die-nende Türe befand sich am Ende des
Wagens. Damit wir in den Zug kommen, müssen wir die
gefundene Türe zuerst öffnen. Während diese oben mit einem Fenster
versehen wurde, befand sich darunter ein Display für die Anzeige des
Fahrweges und des Zielbahnhofes. Der Reisende konnte daher sofort
erkennen, ob er in den richtigen Zug einsteigen würde. Die Position war
zudem so gewählt worden, dass auch Fahrer von Rollstühlen die Schrift gut
lesen konnten.
Zuerst wurden unter der Türe ein Trittbrett
ausge-klappt und danach die
Schwenkschiebetüre
mit der Hilfe von
Druckluft
gegen den Wagen hin geöffnet. Damit war der rund 900 mm breite Einstieg
frei und er konnte benutzt werden. Über die Treppe gelangte man zur Plattform, die sich zwischen den Türen befand. Seitlich Handläufe boten auch älteren Reisenden den notwendigen Halt. Benutzer von Rollstühlen konnten daher nicht ohne Hilfe in den Zug gelangen. Dazu gilt jedoch zu sagen, dass es bei den
meisten
Neigezügen
nicht möglich war, einen ebenerdigen Einstieg zu ermöglichen. Jedoch war
der Zugang breit genug, dass dies mit einem mobilen Lift ging. Bevor wir uns auf den Weg durch den Triebzug machen, betrachten wir das Abteil dieses Wagens. Von der Plattform wurde es über einen mittigen Gang erreicht. Beim Gang waren auf der Seite zu unserer linken Seite Ablagen für Reisegepäck vorhanden. Die an-dere Seite besass die Türe zur hier eingebauten Toilette. Diese konnte nur von gehenden Leuten
besucht werden und sie war nach dem aktuellen Standard aufgebaut worden. Am Ende des Durchganges befand sich eine verglaste Schiebetüre, die im geöffneten Zustand den Weg in das Abteil der ersten Wagenklasse frei gab. Die Sitze waren mehrheitlich in der
Flugzeug-bestuhlung angeordnet worden und standen gegen-über dem
Mittelgang so, dass auf einer Seite zwei und auf der anderen ein Sitz war.
Es war damit die im
Fernverkehr übliche Anordnung der Sitze in dieser
Wagenklasse
vorhanden. Bei den Sitzen waren in den Rückenlehnen
Klapptische montiert worden. Diese dienten dem hinteren Sitz als
Ablagefläche für Laptops, oder Bücher. Bei jenen Abteilen, die in der
klassischen Anordnung aufgestellt wurden, gab es jedoch zwischen den
Sitzen einen grossen Tisch, der zudem Elemente hatte, die abgeklappt
werden konnten. Insgesamt fanden zudem 44 Reisende in diesem Abteil einen
Sitzplatz.
Diese Polster wurden mit zusätzlichen
Stoff-polstern im Bereich der Kopfstützen ergänzt. Da-bei verwendete man
beim ETR 610 blaue Polster mit den Schriftzug Cisalpino und einer 1. Bei
den RABe 503 wurde SBB CFF FFS angeschrieben. Ergänzt wurden diese Sitze der ersten Wagenklasse mit den seitlichen Armlehnen. Diese Armlehnen waren an der hellgrauen Sitzschale montiert worden und konnten hochgeklappt werden. Zwischen den einzelnen Sitzen des grösseren
Ab-teils war dazu genug Platz vorhanden. So gesehen entsprachen die Sitze
des
Triebzuges
der damals aktuellen Ausrüstung von hochwertigen Abteilen der ersten
Wagenklasse
im
Fernverkehr. Bei der Anordnung der Sitze gab es zwischen den Triebzügen ETR 610 und RABe 503 kleine Unter-schiede. Der
Sitzteiler
betrug bei beiden
Triebzügen 2000 mm. Einzig bei der Reihe RABe 503 gab es noch
leicht vergrösserte Abstände für die Sitzplätze, die mobilitätsbehinderten
Personen vorbehalten waren. Auch der Weg zu diesen Sitzen war gering, da
sie unmittelbar bei der
Einstiegstüre
angeordnet wurden. Zudem waren diese Sitze gekennzeichnet. Die im Abteil verteilten Gepäckablagen
wurden im
Triebwagen
RABe 503 an das Ende der Abteile verschoben. Beim ETR 610 waren diese noch
im Abteil verteilt worden. Diese Ablagen wurden jedoch bei beiden Zügen
durch die am Dach montierte Gepäckablage ergänzt. Da man hier im Vergleich
zum
ETR 470
mehr Platz hatte, konnten diese auch etwas grosszügiger ausgeführt werden,
so dass auch kleinere Koffer Platz fanden.
Er harmonierte jedoch sehr gut mit den
dunklen Sitzen und den weissen Wänden und des ebenso weissen Himmels. Das
Abteil wirkte dadurch sehr freundlich und einladend auf den Fahrgast. Dank
dem kurzen Gang und der automatischen Schiebetüre war der Raum vom Verkehr
auf der
Plattform
abgegrenzt. Am Tag erhellt wurde das Abteil durch die
seitlichen Fenster. Diese hatten einen Teiler von 1 950 mm erhalten und
passten daher nicht immer optimal zu den Sitzen. Speziell war, dass die
Gläser aus
Sicherheitsglas,
leicht getönt ausgeführt wurden. So sollte verhindert werden, dass zu
viele UV-Strahlen ins Abteil gelangten. Um die Sonneneinstrahlung
zusätzlich zu minimieren, waren noch
Sonnenrollos
montiert worden. Es wird Zeit, dass wir das Abteil wieder
verlassen und über den
Personenübergang
auf den zweiten Wagen wechseln. Der Wechsel von einem auf das andere
Fahrzeug war sehr offen ausgeführt worden. Es gab keine Türen und der
Faltenbalg
war zudem druckdicht ausgeführt worden. Wer sich nicht achtete, wechselte
den Wagen, ohne es zu merken. Auch hier war das keine grosse Neuerung,
denn auch andere Züge kannten diese Merkmale.
Die vorher erwähnten Unterschiede zwischen
ETR 610 und RABe 503 waren auch hier vorhanden. Neu war nur, dass es hier
zwei WC gab, die auf beiden Seiten des Durchgangs angeordnet wurden. Eine
Trennung nach Geschlechtern gab es jedoch nicht. Daher treten wir gleich in den dritten Wagen ein. Nach dem Personenübergang folgten nun wieder die beiden seitlichen Einstiege mit der dazwischen eingebauten Plattform. Doch bereits danach war klar zu erkennen, dass bei diesem Wagen nicht alles normal aufgebaut worden war. Der Durchgang wurde zur Seite verschoben
und daneben eine vergrösserte WC-Kabine eingebaut. Diese war so aufgebaut
worden, dass sie auch von Rollstühlen befahren werden konnte. Wie bei den anderen WC, war auch hier ein geschlossenes System verbaut worden. Die Ausscheidungen der Reisenden, wurden in einem Tank gesammelt und dabei eingedickt. Nach der Tagesleistung musste diese Anlage jedoch entleert werden. Da keine chemischen Zusätze verwendet
wurde, konnte das in die normale Kanalisation erfolgen. Die dazu
erforderlichen Anschlüsse befanden sich seitlich an der Aussenwand. Nach dem WC folgte ein kleines Abteil der ersten Wagenklasse. Neben den sechs normalen Sitzen, waren hier auch vier Sitze vorhanden, die hochgeklappt werden konnten. Daher war es hier möglich, auch zwei Rollstühle abzustellen. Mit diesen Sitzen haben wir nun die erste
Wagenklasse
abgeschlossen und können feststellen, dass die
Triebzüge ETR 610 und RABe 503 über insgesamt 108 Sitzplätze in
der ersten Wagenklasse verfügten. Sowohl gegen den Gang, als auch gegen den
nun folgenden Speiseraum war das kleine Abteil mit Türen versehen worden.
So wurden hier sitzende Reisende nicht so stark vom betriebsamen
Speiseraum belästigt. Der Speiseraum selber besass Tische und insgesamt 18
einzelne Stühle. Hier war die Ausstattung eher auf ein Gasthaus, als nach
einem Zug ausgerichtet worden. Bei
Speisewagen
durchaus ein übliche Ausführung.
Auch wenn von einer Küche gesprochen wurde,
die Einrichtung war eher ein Office und die fertig zubereiteten Mahlzeiten
mussten nur noch erwärmt werden. Eine Lösung, die mittlerweile als
Standard galt und die das Personal kannte. Wir gehen nun durch den Seitengang an der
Küche und dem Serviceoffice vorbei und kommen so zum zweiten WC in diesem
Speisewagen.
Gegenüber dem vorgestellten WC wurde die Kabine für das
Zugpersonal
eingebaut. Dieses fand hier Ablagen und Stauraum für das mitgeführte
Gepäck. Eine Tischplatte diente Schreibarbeiten und mit Hilfe des
Bedienplatzes konnten von hier aus auch ungestörte Durchsagen im Zug
durchgeführt werden. Mit dem vierten Wagen kommen wir zu den
Abteilen der zweiten
Beim Wagen mit der Nummer vier gab es
zwischen der Baureihe ETR 610 und dem später abgelieferten
Triebwagen
RABe 503 Unterschiede bei der Anzahl der Sitze. Wenn wir uns nun im Abteil
dieses vierten Wagens umsehen, erkennen wir, dass hier eine klassische 2/2
Bestuhlung in zweiter
Wagenklasse
eingebaut wurde. Dabei waren die meisten Sitzplätze auch in der
klassischen Vis-à-vis Bestuhlung angeordnet worden.
Bei der Baureihe RABe 503 wurde jedoch mehr
Sitze in der Flugzeugbestuhlung eingebaut. Das führte dazu, dass die
Anzahl Sitze auf den Wert von 78 verringert werden musste und dass eine
weitere Gepäckablage vorhanden war. Der Sitzteiler betrug bei der zweiten Wagenklasse 1900 mm und war daher nur unwesentlich kleiner, als in der ersten Wagenklasse. Die einzelnen Sitze wurden mit einer hellgrauen Sitzschale und mit einer stoffbezogenen Pol-sterung in dunkelblauer Farbe versehen. Im Bereich der Kopfpolster wurden in
ähnlicher Farbe ge-haltene Kopftücher angebracht. Dabei trugen diese beim
ETR 610 anfänglich den Schriftzug Cisalpino. Beim Triebzug RABe 503 wurde das Signet und die Ab-kürzung der Schweizerischen Bundesbahnen SBB einge-prägt. Wie bei der ersten Wagenklasse wurden auch hier seitlich von jedem Sitz Armlehnen montiert. Diese konnten ebenfalls hochgeklappt
werden. Die oft angeprangerte Angleichung der beiden
Wagenklasse
konnte hier durchaus nachvollzogen werden. Die Abteile der zweiten
Wagenklasse waren recht hochwertig. Sowohl die Gepäckablagen, als auch der
Bodenbelag und die Wände des Wagens entsprachen der Ausführung in der
ersten
Wagenklasse.
Das galt auch für die angebrachten Tische, die
Sonnenrollos
und natürlich die Grösse der Fenster. Sie sehen, dass die beim Bau der
Kasten erwähnte Lösung mit nachträglich ausgeschnitten Fenstern nicht
genutzt wurde. Es waren viele standardisierte Teile verbaut worden. Wir kommen nun zum fünften Wagen des Zuges.
Auch diesen erreichen wir wieder über den
Personenübergang.
An die
Plattform
mit den beiden
Einstiegstüren
folgte der Durchgang mit dem WC und der Gepäckablage. Vom Aufbau her
entsprach er dem zuvor vorgestellten Wagen, jedoch wurde er, wie der
anschliessende Wagen sechs abgedreht. Ein Vorgang, der bei den meisten
Triebzügen vorgenommen werden musste.
Die Modelle für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, also die Baureihe RABe 503, hatte gegenüber dem Wagen vier eine unveränderte Anordnung der Sitze. Somit sollten nicht beide Varianten die
gleiche Anzahl der Sitzplätze erhalten. Doch noch fehlt der Wagen sieben.
Der letzte Wagen hatte wiederum nur ein paar Einstiegs-türen erhalten. Auch das WC und die Gepäckablage wurden, wie im bereits bekannten Wagen Nummer fünf, gleich nach dieser Plattform angeordnet. Da dieser letzte Wagen wegen der
Front
und dem
Führer-stand
mit dem technischen Bereich weniger Platz für Sitzplätze hatte, wurden
beim ETR 610 insgesamt 72 Sitze eingebaut. Beim
Triebwagen
RABe 503 waren es sogar nur 66 Plätze. Nachdem wir nun die beiden Triebzüge begangen haben, können wir die Anzahl der Sitzplätze für den ganzen Zug bestimmen. Beide Modelle hatten in der ersten
Wagenklasse
108 Sitzplätze. In der zweiten Wagenklasse waren bei der Baureihe ETR 610
der Cisalpino AG 304 Sitze vorhanden. Deren Anzahl wurden bei der Reihe
RABe 503 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf 296 verringert, so dass
hier etwas weniger Platz vorhanden war. Es lohnt sich ein Vergleich mit der
Baureihe RABDe 500 der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Der
ICN
war für den nationalen Verkehr ausgelegt und war daher auf optimale
Nutzung ausgelegt worden. Bei vergleichbarer Länge waren hier 125 Sitze in
der ersten und 326 Sitzplätze in der zweiten
Wagenklasse
vorhanden. Der grösste Anteil beim Verlust von Sitzen, muss beim ETR 610
der langen
Front
zugeschlagen werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wir
sind nun auch in einem Bereich, bei dem es zwischen der Reihe ETR 610 und
der Baureihe RABe 503 Unterschiede gab. Diese waren jedoch nicht so
deutlich zu erkennen, wie der komplett anders aufgebaute Anstrich.
Wir
sind nun auch in einem Bereich, bei dem es zwischen der Reihe ETR 610 und
der Baureihe RABe 503 Unterschiede gab. Diese waren jedoch nicht so
deutlich zu erkennen, wie der komplett anders aufgebaute Anstrich. Geöffnet
wurde die
Geöffnet
wurde die
 Die
Sitzpolster der ersten
Die
Sitzpolster der ersten 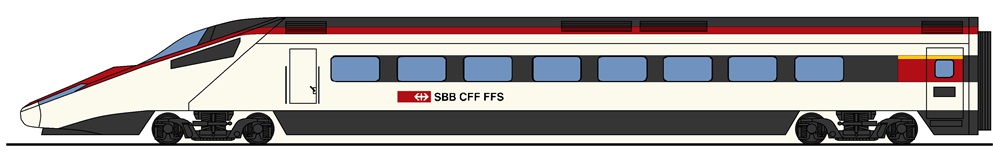 Der
Boden des Abteils in diesem ersten Wagen hat-te einen beigen Belag
er-halten und war gegenüber anderen Zügen jener Zeit eher hell
ausgefallen.
Der
Boden des Abteils in diesem ersten Wagen hat-te einen beigen Belag
er-halten und war gegenüber anderen Zügen jener Zeit eher hell
ausgefallen. Der
zweite Wagen können wir eigentlich einfach passieren. Es war ebenfalls
einer für die erste
Der
zweite Wagen können wir eigentlich einfach passieren. Es war ebenfalls
einer für die erste  Serviert
wurden die Mahlzeiten von der anschlies-senden Küche. Zur Belieferung
dieser Küche waren am Wagen zwei seitliche Tore vorhanden, die ein
ungestörtes Verladen der Lebensmittel ermöglichte.
Serviert
wurden die Mahlzeiten von der anschlies-senden Küche. Zur Belieferung
dieser Küche waren am Wagen zwei seitliche Tore vorhanden, die ein
ungestörtes Verladen der Lebensmittel ermöglichte. Der
Unterschied zwischen den Zügen bestand darin, dass die Anordnung der Sitze
nicht gleich gewählt wurde. Das führte dazu, dass beim an die Cisalpino AG
ausgelieferten ETR 610 80 Sitzplätze vorhanden waren.
Der
Unterschied zwischen den Zügen bestand darin, dass die Anordnung der Sitze
nicht gleich gewählt wurde. Das führte dazu, dass beim an die Cisalpino AG
ausgelieferten ETR 610 80 Sitzplätze vorhanden waren. Die
Anordnung der Sitze wurde beim
Die
Anordnung der Sitze wurde beim