|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir zum
Fahrwerk
der Baureihe D kommen, dann führt uns auch das direkt zur Achsfolge.
Wie bei vielen anderen Baureihen der
Gotthardbahn entsprach diese der Bezeichnung. Wir haben hier also
mit der Achsfolge D ein
Laufwerk
erhalten, das über nicht weniger als vier
Triebachsen
verfügte. Damals gab es solche Lösungen in der Schweiz schlicht nicht und
auch in Europa musste man lange suchen, denn die Achsfolge D war selten.
Letztere befanden sich innerhalb der
Räder
und da-her haben wir hier eine innen gelagerte
Loko-motive,
wie sie damals durchaus üblich war und die wegen dem verwendeten
Antrieb
nicht anders gelöst werden konnte. Für die
Achslager
wurden die damals üblichen
Gleitlager
verwendet. Diese teilten sich in das Rotationslager und in ein lineares
Lager
auf. Dabei war das lineare Lager noch einfach aufgebaut, denn es führte
die
Achse
im
Plattenrahmen
und erlaubte nur eine vertikale Bewegung. Geschmiert wurde dieses mit
Stahl auf Stahl arbeitende Lager mit dem damals üblichen
Schmiermittel
Öl.
Diese konnte jedoch sparsam genutzt werden. Viel grösser war der Aufwand beim
Rotationslager. Durch die hohe Drehzahl der
Achse,
musste in diesem Bereich eine gute
Schmierung
verbaut werden. Dazu wurden die
Lagerschalen
aus
Weissmetall
aufgebaut. Der Vorteil dieses Metalls war die gute Eigenschmierung. Jedoch
reagierte Weissmetall sehr empfindlich auf die entstehende Wärme. Auch bei
einem guten
Lager
war diese so hoch, dass es zu einem geschmolzenen Lager kommen konnte.
Beide Punkte wurden durch die eingebaute Sumpfschmierung übernommen. Dabei ge-langte hier das Schmiermittel Öl auf die Achswelle. Dort wurde die Reibung verringert und
gleichzeitig die Wärme aufgenommen. Durch den Aufbau wurde das
Schmiermittel
nach der Arbeit aus dem
Gleitlager
ge-drängt. Die Lösung mit der Sumpfschmierung war bei Achslagern durchaus üblich. Der Vorteil war, dass das Schmiermittel in einem grossen Behälter mitgeführt werden konnte. Zudem wurde gerade so viel Öl aufgenom-men, wie benötigt wurde. Die Arbeiten auf der Fahrt beschränkten
sich damit nur auf die Wärme der
Lager,
denn diese war wirklich ein zu grosses Problem. Bei rund 300 Grad Celsius
begann das
Weiss-metall
zu schmelzen. Um den Radsatz abzuschliessen, müssen wir diesen mit den Rädern versehen. Dabei war der Aufbau bei allen Lokomotiven gleich. Es wurde auf der Achswelle ein Speichenrad als Radkörper aufgezogen. Dieses wiederum umspannte eine Bandage. Bei diesem
Radreifen,
waren die
Lauffläche
und der
Spurkranz
ausgebildet worden. Bei grosser Abnützung konnte also nur die
Ban-dage
getauscht werden. Das
Rad
selber kam erneut zum Einbau. Wenn wir uns nun die Durchmesser der
aufgebauten
Räder
ansehen, kommen wir zu den Unterschieden bei den
Lokomotiven.
Für die Nummern 101 bis 136 wurden Lösungen verwendet, die über einen
Durchmesser von 1 170 mm verfügten. Dabei darf man durchaus erwähnten,
dass die
Laufachsen
der Reihe A2 den gleichen
Durchmesser hatten. Die
Güterzugslokomotive
konnte damit also gar nicht schnell fahren. Bei den Nummern 141 bis 145 wurden die
Räder
leicht verändert. Man steigerte den Durchmesser, so dass diese Modelle
einen Durchmesser von 1 230 mm hatten. Die Steigerung war jedoch so
gering, dass auch für diese speziellen
Lokomotiven
die gleiche
Höchstgeschwindigkeit
von 45 km/h galt. Die Baureihe war damit kein Renner geworden, aber das
war von der
Gotthardbahn auch nicht verlangt worden, denn hier ging es um die
Kraft.
Eine durchaus gängige Lösung, die aber den
festen
Radstand
auf die
Achsen
eins und vier ausdehnte und dabei gab es zwischen den
Lokomotiven
Unter-schiede, die wegen den
Rädern
entstanden. Der feste Radstand der Lokomotiven mit den Num-mern 101 bis 136 wurde mit einem Wert von 3 900 mm angegeben. Das war zwar ein recht hoher Wert, der aber wegen den kleinen Rädern durchaus bescheiden ausgefallen war. Wegen den Änderungen, die bei den Nummern
141 bis 145 vorgenommen wurden, stieg dort der feste
Radstand
auf einen Wert von 4 200 mm. Damals durchaus ein hoher Wert, der später
mit anderen Baureihen übertroffen wurde. Da sich alle Achslager vertikal bewegen konnten, musste der Plattenrahmen auf diesen abgestützt werden. Dazu war eine Federung verbaut worden. Diese Lösung führte dazu, dass die
ungefederte
Achse
gemildert werden konnte. Bei der hier vor-handenen Geschwindigkeit war das
kein so grosses Problem. Trotzdem wurde in diesem Bereich mit der gleichen
Sorgfalt gearbeitet, wie das bei den anderen Reihen der Fall war. Bei der
Federung
haben wir hier jedoch ein Problem. Die bei
Triebachsen
sonst übliche Montage unter dem
Achslager
war hier schlicht nicht möglich. Wegen den kleinen
Rädern
befand sich der Rahmen so tief, dass dazu schlicht der Platz nicht
vorhanden war. Die Federung mit den damals üblichen
Blattfedern
musste deshalb über der
Achse
eingebaut werden. Eine Lösung, die jedoch bei der vierten Achse ebenfalls
nicht ging.
Der normale Einbau über dem
Achslager
war je-doch auch nicht möglich, da hier die
Feuerbüchse
im Weg war. Die Konstrukteure mussten daher zu einer speziellen Lösung
greifen und dabei kamen die beiden Hersteller zu unterschiedlichen
Lösungen für das Problem mit der
Federung. Bei den bei der Maschinenfabrik Maffei in München gebauten Maschinen mit den Nummern 101 bis 131 kam eine Lösung mit abgelegten Blattfedern zur Anwendung. Um diese zu unterstützen waren hier jedoch
noch
Spiralfedern
eingebaut worden. Auf diese wurde bei den in Winterthur gebauten Maschinen
jedoch verzichtet, so dass die bei der SLM gebauten
Lokomotiven
nur über die
Blattfedern
verfügten, die durchaus ausreichend waren. Die einzelnen Federpakete der
Triebachsen
waren mit
Ausgleichshebeln
verbunden worden. Diese sorgten dafür, dass beim befahren von
Kuppen
und
Senken die
Achslasten
bei allen vier
Achsen
immer gleich hoch waren. Eine wichtige Lösung, die für eine gute
Ausnutzung der vorhandenen
Adhäsion
sehr wichtig war. Wobei damals alle mehrachsigen
Laufwerke
mit solchen Hebeln versehen wurden, die gute Arbeit verrichten konnten. Wir haben damit das
Laufwerk
der
Lokomotive
bereits aufgebaut. Wie schon früher erwähnt, waren gemäss
Pflichtenheft
keine
Laufachsen
zugelassen und das ganze Gewicht sollte auf die
Triebachsen
abgestützt werden. Doch mit dem bisherigen Aufbau haben wir eigentlich nur
ein spezielle Fahrzeug geschaffen. Damit daraus ein Lokomotive wird,
müssen wir bei diesen Laufwerk mit der Achsfolge
D noch einen
Antrieb
einbauten.
Auch bei der Baureihe D handelte es sich um
eine
Loko-motive,
die über zwei
Dampfmaschinen
gleicher Bauweise verfügte. Diese nehmen wir nun als Ausgangspunkt. Dampfmaschinen und Stangenantriebe haben jedoch ein Problem. Auf dem Umfang des Rades gibt es zwei Punkte, bei denen es nicht möglich ist, die Drehrichtung des Rades zu bestimmen. Damit das trotzdem immer richtig erfolgte,
wurden die beiden Maschinen mit einem
Versatz
versehen. Wie bei allen Maschinen mit zwei
Zylindern
betrug dieser Versatz 90 Grad. So war gesichert, dass immer die korrekte
Dreh-richtung aktiv ist. Von Zylinder wurde die Kolbenstange Bewegung versetzt und mit grosser Kraft nach aussen gestossen oder einge-zogen. Diese Stange endete in gerade Linie beim
wichtigsten Bau-teil des
Antriebes.
Ich spreche vom
Kreuzgelenk,
das die Kraft der
Kolbenstange
unabhängig von der Drehung des
Rades
auf dieses übertrug. Die hier auftretenden Kräfte waren gross, denn
eigentlich will sich ein Rad gar nicht drehen und das erzeugte Kräfte. Wichtig war, dass dieses
Kreuzgelenk
in seiner Lage stabil blieb. Es durfte sich nur in der
Achse
der
Kolbenstange
bewegen. Hier wurde wegen den hohen Kräften, die übertragen werden musste,
ein doppelt geführtes Kreuzgelenk verbaut. Gerade bei schweren und
kräftigen
Lokomotiven
waren diese Lösungen üblich und da sollte unsere
Güterzugslokomotive
sicherlich keine Ausnahme darstellen, denn höhere Kräfte gab es nicht.
Wegen den kleinen
Triebrädern,
war nur so ein kor-rekter Winkel im
Kreuzgelenk
zu erhalten. Sie sehen, wie gross die Auswirkungen der
Fahrwerkes
auf den
Antrieb
hatte, denn sonst versuchte man diese
Schub-stange
so kurz wie möglich zu halten. Im Kurbelzapfen der Triebachse wurde die lineare Kraft der Dampfmaschine in ein Drehmoment umgewandelt. Damit haben wir eigentlich den Antrieb. Jedoch hatte die Maschine so viel Kraft, dass diese mit Hilfe der Adhäsion nicht von einer Achse übertragen werden konnte. Es musste also eine Verteilung auf mehrere
Achsen
erfolgen. Dazu waren die drei weiteren als
Kuppelach-sen
bezeichneten
Triebachsen
verbaut worden. Die drei
Kuppelachsen
wurden jedoch nur mit einfachen waagerecht eingebauten
Kuppelstangen
verbunden. Diese
Triebstangen
waren mit
Gelenken
bei den
Kurbel-zapfen
versehen worden. So konnten die vier Triebachsen der
Lokomotive
ungehindert federn, was für den Betrieb wichtig war, was aber auch die
Menge der vorhandenen
Lager
deutlich erhöhte. Auch hier kamen die üblichen
Gleitlager
zur Anwendung. Hier wurden ebenfalls die schon bekannten
Lagerschalen
aus
Weissmetall
verwendet. Für die
Schmierung
wurde auch
Öl
eingesetzt. Wegen dem verfügbaren Platz kam jedoch eine
Nadelschmierung
zur Anwendung. Diese hatten nur einen kleinen Vorrat beim
Schmiermittel.
Das sorgte dafür, dass diese
Lager
im Betrieb eventuell nachgeschmiert werden mussten. Das erfolgte bei jedem
Halt und war Aufgabe des
Heizers.
Das war nicht der Fall, sondern basiert auf
einer optischen Täuschung. Bei den kleinen
Triebrädern,
wirkte ein normaler
Stangenantrieb
als käme er mit jeder Kraft zurecht. Sie sehen, oft spielt uns auch hier
das Auge einen Streich. Das im
Triebrad
vorhandene
Drehmoment
wurde mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen der Lauffläche
und der
Schiene
in
Zugkraft
umgewandelt. So konnte von den Nummern 101 bis 136 eine
Anfahrzugkraft
von 85 kN erzeugt werden. Bei den veränderten fünf Maschinen mit den
Nummern 141 bis 145 wurde dieser Wert auf stolze 125 kN gesteigert. Auch
wenn das viel erscheinen mag, in jenen Jahren, waren schon höhere Kräfte
möglich. Um diese hohen Kräfte auch bei schlechtem
Zustand der
Schienen
auf diese zu übertragen, wurde eine
Sandstreueinrichtung
verbaut. Mit dieser konnte aus einem auf dem
Kessel
montierten
Sanddom
Quarzsand
auf die Schienen vor der zweiten
Triebachse
gestreut werden. Wie damals üblich funktionierte die Anlage allein mit der
Schwerkraft und so sorgte für eine bessere
Adhäsion.
Mehr war in diesem Punkt jedoch nicht vorhanden. Wir haben damit ein
Fahrwerk
erhalten, das über keine speziellen Eigenschaften verfügte. Die
zusätzliche
Triebachse
war ein Punkt, der an die
Zugkräfte
angepasst wurde. Doch noch haben wir die Maschine im mechanischen Aufbau
nicht abgeschlossen, denn es fehlt noch der hintere
Stossbalken,
der bekanntlich nicht bei der
Lokomotive,
sondern am
Tender
montiert wurde. Daher sollten wir auch diesen ansehen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
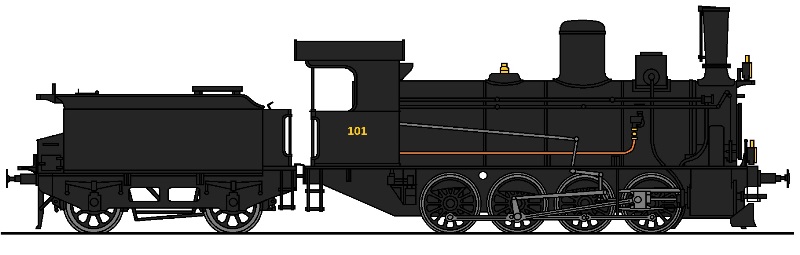 Die
Achswellen wurden aus geschmiedetem Stahl gefertigt und sie bestanden aus
einem hochfesten Werkstoff. Merkmal dieser einfachen
Die
Achswellen wurden aus geschmiedetem Stahl gefertigt und sie bestanden aus
einem hochfesten Werkstoff. Merkmal dieser einfachen 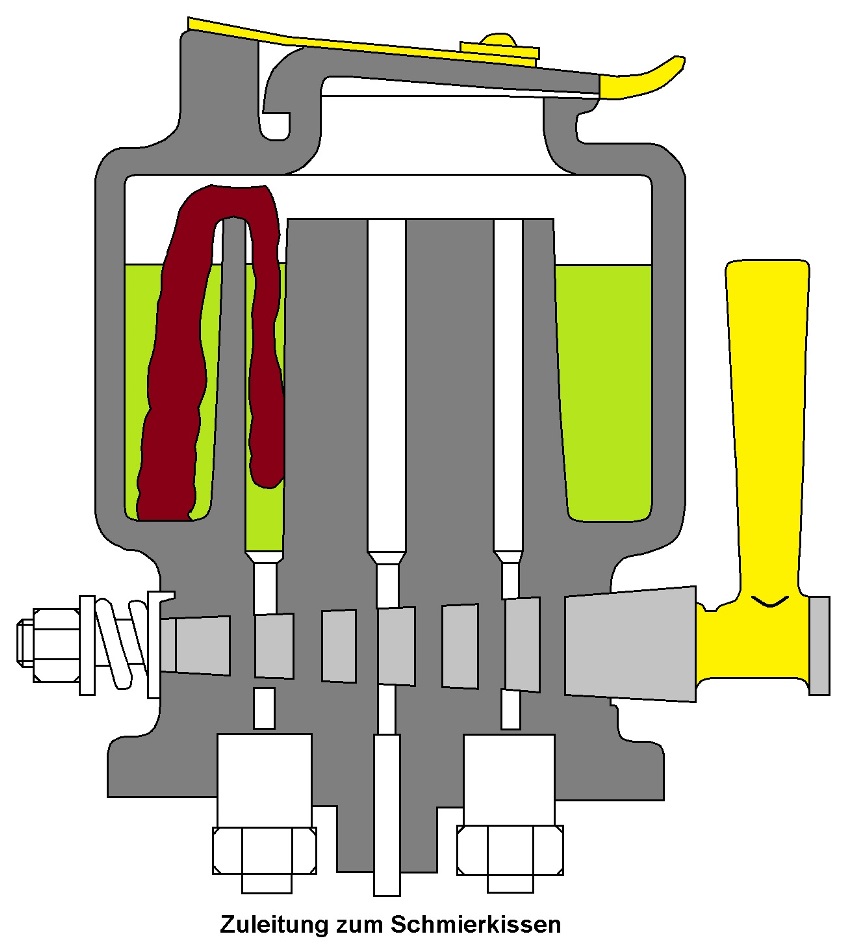 Um
die Wärme im
Um
die Wärme im
 Mit
einem
Mit
einem
 Wirklich
eng war es bei der vierten
Wirklich
eng war es bei der vierten
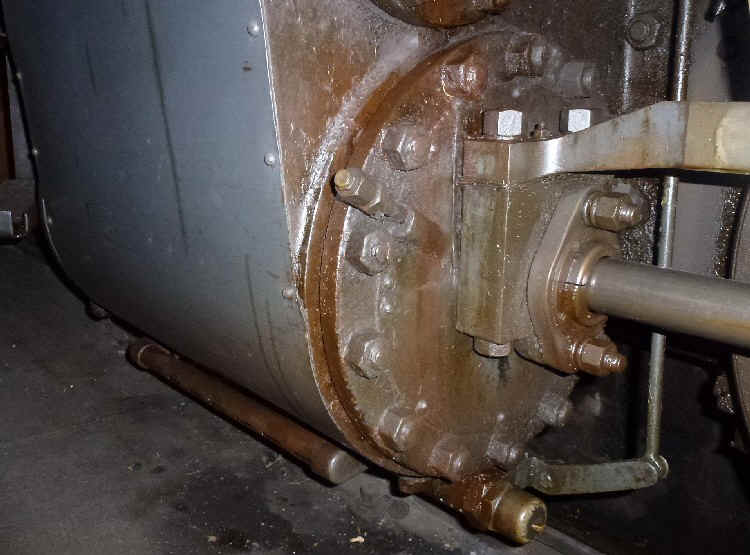 Eigentlich
bringt auch der
Eigentlich
bringt auch der
 Vom
Vom
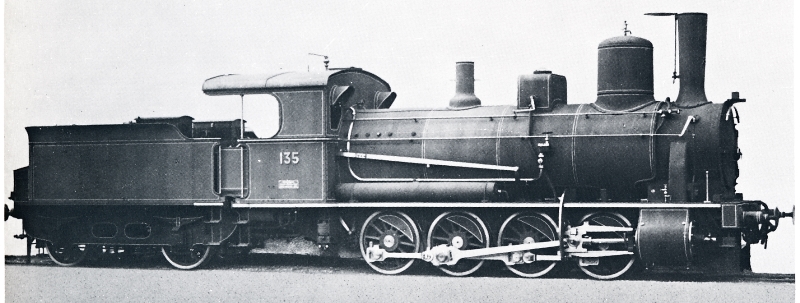 Damit
haben wir den
Damit
haben wir den