|
Inbetriebsetzung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die von der
Jura-Simplon-Bahn
JS
bestellen beiden
Prototypen
wurden von der erwähnten
Bahngesellschaft
dringend erwartet. Dabei standen die Strecken, auf denen man diese
Maschine einsetzen konnte, noch nicht bereit. Insbesondere die Verzögerung
beim Bau des Simplontunnels mit den Streiks, den Wassereinbrüchen und
Gewalttaten machten eine vordringliche Lieferung der beiden Maschinen
nicht unbedingt notwendig.
Da man die bestehenden Linien mit den
vorhandenen Maschinen abdecken konnte, wurde die
Lokomotive
nicht so dringlich. Mit der A 2/4 hatte man moderne und schnelle
Lokomotiven, die den Verkehr durchaus übernehmen konnten. Selbst für die
leeren Kassen waren Verzögerungen gut. Aber trotzdem freute man sich auf
den grossen Tag, wenn die erste Maschine am vertraglich festgelegten Ort
übergeben wird.
Jedoch war da die vom Schweizer Stimmvolk
beschlossene
Staatsbahn.
Diese drohte den Verkehr auf der
JS
zu übernehmen, bevor die zuletzt bestellte
Lokomotive
abgeliefert worden wäre. Es ging dabei um den guten Ruf der Gesellschaft,
denn eigentlich lachte man zu dieser Zeit wirklich nur bei der
Gotthardbahn. Die JS benötigte einen Erfolg um mit einem möglichst
guten Polster versehen zu werden, denn es ging auch um Geld, das man
dringend benötigte.
Obwohl die Industrie schon beim Bau von
ähnlichen
Lokomotiven
Erfahrungen hatte, gab es bei der Schweizerischen Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM massive Verzögerungen. Das Werk war für die damals
eingegangenen Aufträge zu klein und gerade die Maschinenfabrik in Oerlikon
MFO drängte auf eine bevorzugte Behandlung der Teile, die man in
Winterthur bestellt hatte, denn dort ging es schlicht um den Weltrekord.
Noch ahnte Niemand, dass die komische
Maschine, die sich kaum so recht bewegen konnte, den grossartigen
Dampflokomotiven den Gnadenstoss verpassen könnte. Es handelte sich um ein
Experiment und diese sollte nun auch die
Jura-Simplon-Bahn
JS mit der neuesten Dampflokomotive im Fuhrpark anstellen. Damit sollte
zudem nicht lange gewartet werden. Deshalb wurde die Maschine gleich dem
üblichen Programm einer frisch gelieferten Maschine unterzogen.
Selbst die Anlieferung ab Werk war etwas
sonderbar. So wurde die neue
Lokomotive
nach Luzern überführt, wo sie auf die wenigen Jahre alten Maschinen der
Gotthardbahn stiess. Diese bereits planmässig im Einsatz
stehenden Lokomotiven machte die Maschine des
JS
keine grossen Sorgen, denn die Eckwerte war gar nicht so weit entfernt.
Man konnte bei der Gotthardbahn damit leben, denn die JS sah man nicht als
Konkurrenz.
Natürlich sah man das bei der
JS
etwas anders, aber dazu musste sie zuerst selber wissen, ob die neue
Lokomotive
auch funktioniert. Daher schickte man sie gleich auf die übliche
Abnahmefahrt. So konnte man sich ein erstes Bild von der Lokomotive
machen. Solche Abnahmefahrten waren damals durchaus üblich und sie sollten
zuerst einmal aufzeigen, ob die gelieferte Maschine grundsätzlich gesehen
funktioniert und daher auf die
Testfahrten
geschickt werden konnte.
Damit war sie ideal. Ähnlich zur Strecke
von Rot-kreuz nach Erstfeld der
Gotthardbahn. Sie sehen, dass beide Bahnen in etwa die
gleichen Strecken für diese Fahrten nutzten. Ab Bern wurde die erste Lokomotive gleich den Versuchsfahrten zugeführt. Dazu wurde sie im Depot Genève stationiert. Ab dort erfolgten die ersten Fahrten zur Bestimmung der möglichen Ge-schwindigkeiten.
Dazu war die sehr gerade gebaute Linie
nach Lausanne ideal geeignet. Schliesslich musste die neue Maschine
zeigen, was sie konnte und das war für die ersten Fahrten die Rennbahn.
Erst danach ging es dann an die Steigungen und somit an die
Normallasten.
Bei solchen Versuchsfahrten wurden zu
jener Zeit in Europa bereits erste Versuche mit Geschwindigkeiten von bis
zu 200 km/h angestellt. Davon war man in der Schweiz jedoch weit entfernt.
Bisher lief eigentlich keine
Lokomotive
schneller als 90 km/h und planmässig bewegte man sich im Bereich von 75
km/h. Deshalb wurden die als Hochtastfahrten bezeichneten Versuche bei 90
km/h gestartet. Darauf konnte man aufbauen.
Man erreiche bei den Versuchen schnell
Geschwindigkeiten von 100 bis 105 km/h. Der Rekord wurde bei einer
Geschwindigkeit von 112 km/h erreicht. Dabei zeigte die
Lokomotive
eine sehr gute Laufruhe, die es durchaus ermöglicht hätte, damit auch
Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h zu erreichen. Man hatte den Beweis,
dass die neue Maschine der
JS
auch schnell fahren konnte. Daher wurde die zulässige
Höchstgeschwindigkeit
auf 100 km/h angehoben.
Obwohl man nicht bei den höchsten
Geschwindigkeiten dabei war, erntete man mit der
Lokomotive,
die mittlerweile eine Schwester bekommen hatte, grosse Anerkennung. Dabei
sorgte gerade diese Tatsache, dass man nicht mit speziellen riesigen
Rädern
fuhr, sondern mit einer Lokomotive, die für den planmässigen Verkehr
ausgelegt wurde. Genau das war wirklich eine besondere Sache, denn man
hätte so auch fahrplanmässig fahren können.
Bevor es aber in den planmässigen Einsatz
gehen konnte, mussten die
Normallasten
überprüft werden. Die dabei gemachten Versuchfahrten verliefen zu vollen
Zufriedenheit der Betreiber. So wurden die berechneten Normallasten
deutlich überschritten und die vorgegebenen
Fahrzeiten
wurde auch damit erreicht. In der Folge konnte diese Lasten erhöht werden,
so dass auf Strecken mit 10‰ Steigung Züge mit bis zu 400 Tonnen befördert
werden konnten.
So konnte man mit den beiden
Prototypen
in den planmässigen Verkehr gehen. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch der
Simplontunnel und die Strecke zwischen dem französischen Pontarlier und
Vallorbe in der Schweiz noch nicht bereit standen, musste man die zweite
Magistrale
dafür nehmen. So kam es, dass man die Maschinen vor den
Schnellzügen
zwischen Genève, Lausanne, Fribourg und Bern einsetzte und so betriebliche
Erfahrungen sammelte.
Die damals eingesetzten
Schnellzüge
bestanden vorwiegend aus Wagen mit zwei oder drei
Achsen.
Darunter befanden sich auch die ersten Wagen mit geschlossenen
Plattformen.
Einzig bei der
Gotthardbahn verkehrten Wagen mit
Drehgestellen
und geschlossenen
Personenübergängen.
Diese waren zwar vorgesehen, aber bisher reichte der vorhandene Fuhrpark
durchaus. Zudem sollte die dieses Problem von der
Staatsbahn
gelöst werden.
Ergänzt wurden diese
Schnellzüge
oftmals mit den dreiachsigen roten
Postwagen
mit einem offenen seitlichen Durchgang. Zusammen mit den grünen und
violetten Wagen eine bunte
Komposition.
Gefahren wurde meisten mit
Geschwindigkeiten von 75 km/h. Besonders die lange und steile Rampe von
Lausanne hoch nach Palézieux war für die Maschine der neuen Reihe A 3/5
und dem
Schnellzug
am Haken, zu viel. So musste eine
Vorspannlokomotive
gestellt werden. Diese bestand oftmals aus den für diese Strecke
ausgelegten
Lokomotiven
Eb 3/4 und wenn es möglich war aus der Baureihe A 2/4. So konnten die Züge
hoch gebracht werden.
Mit den Einsätzen erreichen die beiden
Maschinen eine tägliche
Leistung
von 544 Kilometer. Im Vergleich war das eine sehr gute Leistung, denn die
Dampflokomotiven mussten regelmässig die
Depots
aufsuchen. Wobei man schnell feststellte, dass die neue Baureihe durchaus
sehr gute Ergebnisse bei der Dampferzeugung erzielen konnte. Im Vergleich
erreichte man aus einer Tonne
Kohle
mehr Dampf, als bei vergleichbaren Modellen.
Schliesslich wurden die beiden
Prototypen
von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB zusammen mit der
JS
übernommen und die Baureihe als Standard erklärt. Damit war klar, dass
weitere
Lokomotiven
folgen sollten. Diese wurde mit den Nummern ab 703 versehen. Daher war es
nur logisch, dass die beiden Prototypen zum Abschluss der
Inbetriebsetzung
ebenfalls auf die neuen Nummern der späteren Serie umbezeichnet wurden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
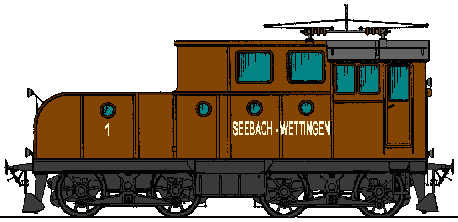 Schliesslich
wurden die Maschinen noch vor der Verstaatlichung im August 1902
ausgeliefert. Die damals jedoch im Raum Zürich verkehrende
Schliesslich
wurden die Maschinen noch vor der Verstaatlichung im August 1902
ausgeliefert. Die damals jedoch im Raum Zürich verkehrende
 Die
Abnahmefahrt der
Die
Abnahmefahrt der
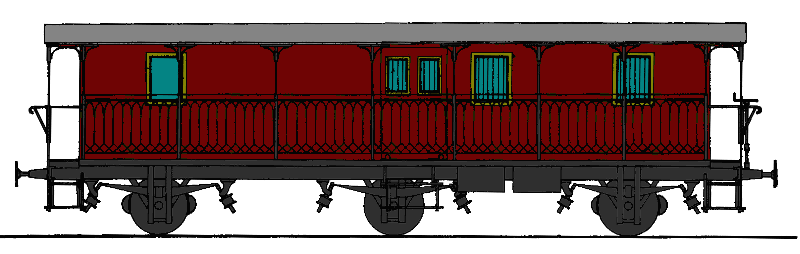 Da
aber nur Wagen der
Da
aber nur Wagen der