|
Inbetriebnahme der Prototypen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie dringend benötigt die
Lokomotiven wurden, zeigte die Tatsache, dass die
veränderten Maschinen der späteren Serie schon bestellt waren, als die
beiden
Prototypen
abgeliefert wurden. Man muss jedoch bedenken, dass mit den
unterschiedlichen Maschinen durchaus beide Varianten ermöglicht worden
wären. Diese Lösung war nicht zu erkennen, da die zweite Lösung zur Serie
wurde und daher die möglichen Prototypen nicht erkannt wurden.
Da man dort jedoch zu dieser Zeit grosse Probleme mit dem für die hohe Leistung zu schwach kon-struierten Antrieb hatte, sah man sich bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf dem richtigen Weg.
Jedoch war noch nicht klar, ob die Stangen der neuen C 5/6 den
Kräften gewachsen waren.
Die beiden
Prototypen
kamen 1913 nach Erstfeld und somit in den
Kreis
V. Bei für den Gotthard gebauten
Lokomotiven war das nicht überraschend. Schon
immer wurden die ersten Exemplare nach Erstfeld überstellt. Die
Hersteller, die auch bei der
Gotthardbahn aus dem deutschen Sprachraum kamen, konnten so mit
dem beteiligten Personal sprechen. Ein Vorteil, den man auch später immer
wieder nutzen sollte.
Wie bei neuen
Lokomotiven üblich wurden die beiden
Prototypen
intensiven Versuchen zugeführt. Diese waren nötig, weil man die Eckdaten
bestimmen wollte. Dazu gehörten die Verbrauchswerte und die möglichen
Anhängelasten.
Gerade beim letzten Punkt war man sehr gespannt, denn das angedachte
Programm war wirklich nicht zu vernachlässigen. So sollten am Berg 320
Tonnen schwere Züge mit einer Lokomotive bespannt werden.
Das waren Vorgaben, die in Europa noch nicht erreicht wurden. 320
Tonnen schwere Züge in Steigungen von bis zu 26‰ waren damals noch selten.
Die einzige Strecke, die damals so beansprucht wurde, war der Gotthard.
Das war keine Neuerung und daher erwartete man das von der Schweiz. Bisher
stammten jedoch die meisten
Lokomotiven aus Deutschland und die SLM war
wirklich mit einer grossen Herausforderung konfrontiert worden.
Bisher fuhr man in den engen Kurven am Gotthard lediglich mit vier Triebachsen und das war auch nicht immer optimal.
Gerade die D 4/4
zeigten Probleme mit vielen
Triebachsen
und die bisher eingesetzten C 4/5
waren nicht unbedingt besser.
Daher wurden die beiden
Prototypen
gleich der Erprobung zugeführt. Neben Fahrten zur Erfassung einiger
Eckdaten, gehörten auch Lastfahrten zum Programm. Die Eckdaten waren
nötig, damit man den Verbrauch von
Kohlen
und Wasser erkennen konnte. So wusste man, wie die
Lokomotiven eingesetzt werden konnten und wo man
anhalten musste um Wasser und Kohlen zu fassen. Unterschiede zu
vorhandenen Baureihen wurden erwartet.
Die Verbrauchswerte bei der
Kohle
entsprachen dem berechneten Wert. Jedoch war der Verbrauch beim Wasser
sehr viel höher, als bei der Baureihe
C 4/5 der
Gotthardbahn. Gerade hier war die Überraschung gross,
obwohl man entsprechende Erfahrungen bereits mit den Maschinen der Reihe
A 3/5 gemacht hatte. Dabei war der
Verbrauch bei den Vierlingen noch viel höher, als bei den Drillingen der
Baureihe
A 3/5. So war klar, die
Lokomotiven wurden nicht weiter verfolgt.
Die Anordnung der
Zylinder
im
Verbund
nutzte den Dampf doppelt, dadurch wurde aus dem
Kessel
weniger Dampf benötigt. Die höheren Kosten bei der Beschaffung wurden
daher im Betrieb schnell widerlegt. Der geringere Verbrauch beim Wasser
ermöglichte längere Fahrten ohne einen Halt zum Fassen von Wasser
einzulegen. Auf der chronisch überlasteten Strecke ein Vorteil, den man
auch unter der neuen Leitung nicht missen wollte.
Es zeigte sich bei den Fahrten, dass die
Anhängelasten
nach den Vorgaben umgesetzt werden konnten. So wurden die 320 schweren
Züge in den Steigungen problemlos beschleunigt und die Geschwindigkeit
konnte eingehalten werden. Man war mit den Maschinen auf dem richtigen
Weg, denn so konnte man endlich die zweite
Lokomotive vor dem Zug einsparen. Die Baureihe C
5/6 war somit die richtige Lösung für den Gotthard.
Die fünf Triebachsen klemmten in den engen Kurven. Gerade bei den engen Radien im Depot Erstfeld war es kaum möglich mit der Lokomotive zu fahren.
Man hörte förmlich, wie das
Gleis
unter den Maschinen stöhnte. Anfänglich schob man dieses Problem noch den
engen
Kurven
in die Schuhe, doch das sollte sich ändern. Auch sonst konnte die neue Lokomotive in den Kurven nicht überzeugen. Die fünf Triebachsen führten immer wieder dazu, dass die Maschinen unruhig liefen. Dabei zeigte sich auch, dass der Vergleich mit den vorhandenen C 4/5 gegen die neuen Lokomotiven sprach.
Man benötigte jedoch die fünfte
Triebachse
um grössere
Zugkräfte
zu erzeugen und so schwerere Züge auf den
Rampen
am Gotthard zu befördern. So kam der Entscheid, dass eine grössere Serie beschafft werden wird, nicht über-raschend.
Noch schätzte man den Nachteil einer
Triebachse
mehr als kleines Problem ein. Daher wurde bei der Bestellung auf die
Lösung mit
Verbund
gesetzt. Das
Laufwerk
wurde für die Serie jedoch nicht verändert. Ein Punkt der klar der kurzen
Ablieferung der neuen
Lokomotive geschuldet war. Der Verkehr verlangte
neue Lokomotiven und die C 5/6 war die Lösung.
Der längere Einsatz zeigte jedoch, dass gerade die zweite
Triebachse
einen sehr grossen Verschleiss beim
Spurkranz
hatte. Das führte zu einem grossen Bedarf beim Unterhalt. Daher wurden die
Nachforschungen in diesem Bereich schnell intensiv durchgeführt. Man
wollte wissen, wo das Problem lag und wie man diesem begegnen konnte. Ein
Umstand, der bei
Prototypen
immer wieder zur Verbesserung einer späteren Serie genutzt wurde.
Mit etwas mehr Zeit mit den beiden
Prototypen
hätten die späteren Maschinen der Serie verbessert, was eigentlich der
Sinn von Prototypen war und so gesehen bei der Baureihe C 5/6 nicht
umgesetzt wurde. So wurde einfach eine andere Lösung bei den
Dampfmaschinen
gewählt. Mit den Abklärungen erkannten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB je-doch, wo das Problem lag. Die zu schwache Ausführung der Zen-trierfederung des Krauss-Helmholtz-Drehgestells drückte die erste Triebachse zur Seite.
Dadurch lief die zweite
Triebachse
mit sehr viel Kraft an der äusseren
Schiene.
Das hatte eine grosse Abnutzung zur Folge. Die Veränderungen konnten daher
nur bei den letzten Maschinen umgesetzt werden.
Man wollte schnelle Ergebnisse um möglichst rasch, gute
Lokomotiven zu bestellen. Diese Idee konnte mit
den beiden
Prototypen
nicht umgesetzt werden. Nur die Lösung von dem Vierling war sehr schnell
erkannt worden und wurde bei der Serie nicht umgesetzt. Die Probleme beim
Laufwerk
kamen dazu schlicht zu spät. So gesehen kann man die beiden Prototypen
durchaus als misslungen ansehen. Ein Nachbau wäre ein Fehler gewesen.
Dabei muss man im Nachhinein sagen, dass mit einer längeren
Wartezeit die Probleme beim
Laufwerk
hätten gemildert werden können. Heute wissen wir, dass eine längere
Wartezeit und das Abwarten der Erfahrungen mit den beiden
Prototypen
dazu geführt hätten, dass der Siegeszug bei den elektrischen
Lokomotiven schneller gekommen wäre. Jedoch hätte
die Lösung auch bedeuten können, dass die
Bauart
Mallet umgesetzt worden wäre.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
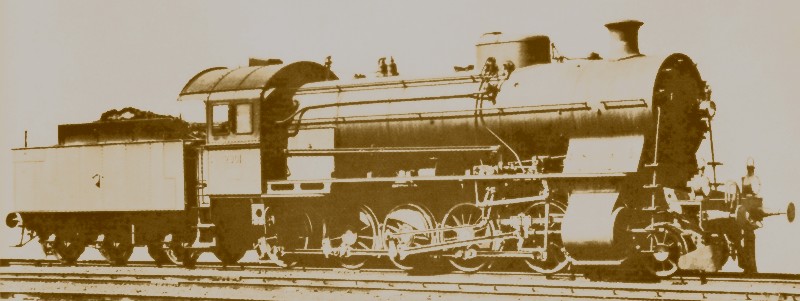 Erwartet
wurden die neuen
Erwartet
wurden die neuen
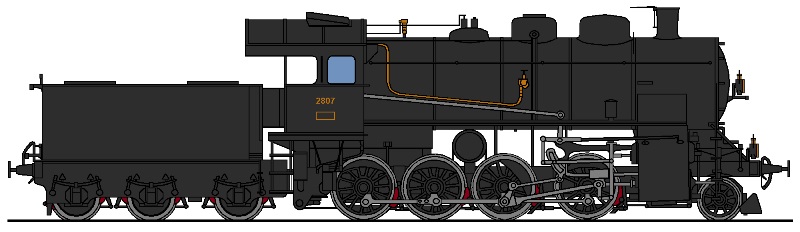 Damit
sollten die beiden
Damit
sollten die beiden
 So
erfreulich die Werte bisher waren, so schlecht schnitten die
So
erfreulich die Werte bisher waren, so schlecht schnitten die
 Die
Probleme traten jedoch erst in Erscheinung, als die ersten in Serie
gebauten
Die
Probleme traten jedoch erst in Erscheinung, als die ersten in Serie
gebauten