|
Rückblick zur Dampftraktion |
|||
| Navigation durch das Thema |
|
||
|
Wer die Schweiz und Dampflokomotiven in einem Satz verwendet, hat
entweder Mut, oder aber er kennt sich aus. Für alle anderen ist das so
eine Sache, denn die berühmte
Lokomotive fährt elektrisch durch die Schweiz. Als ich
einmal eine
Gruppe
Kollegen aus dem hohen Norden durch das
Depot
führen durfte, kam die Frage, ob wir auch einen Dampfer haben. Leider gab
es damals in Erstfeld schon lange keine Cholis mehr.
Beim Blick auf die Ce 6/8 II mit der Nummer 14 253 stammelt er nur noch, «Ihr braucht keinen Dampfer». Zwei Punkte zeigt das auf.
Der Star auf Schweizer
Schienen
fährt elektrisch und da kann man auf eine Dampflokomotive verzichten. Nur,
war der Elefant wirklich so ein grosser Fehler, wie man beim
Krokodil meinen
könnte? Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten sich um 1910 Gedanken über die Zukunft des Schienennetzes in der Schweiz machen.
Das musste, wollte man dem Verkehr gewachsen sein, innert weniger
Jahren umgesetzt werden. Die Erfahrungen mit den vorhandenen
Dampflokomotiven waren so gut, dass man sich nicht auf ein gross
angelegtes Experiment, wie das im Kandertal durchgeführt wurde, einlassen
wollte. So blieb man bei Dampflokomotiven.
Mit der grossen Baureihe C 5/6 wollte man den Verkehr am Gotthard
rationeller abwickeln. Dazu wurde sie entwickelt und mit der gigantischen
Zugkraft
von 145 kN war sie wirklich eine stolze Maschine für den Gotthard. Selbst
in anderen Ländern sucht man um 1913 solche Zugkräfte vergebens. Dumm für
die
Lokomotive war, dass sie diesen Effekt nicht nutzen
konnte. Da stand ihr schlicht die Maschine der BLS im Weg.
Es war dann ein Krieg in Europa, der den Dampflokomotiven in der
Schweiz letztlich das Fürchten lehrte. Nicht, wie so oft erwähnt die
Ce 6/8 II,
sondern der erste Weltkrieg brach den Dampflokomotiven in der Schweiz das
Genick. In einem Land ohne Kohlenvorkommen war man auf den Import von
Kohle
angewiesen. Das ging jedoch wegen dem Krieg nicht. So wurden Dampfzüge
extrem teuer. Die
Krokodile
räumten am Schluss einfach noch auf.
All das führte letztlich zu einem ganz klaren Fazit. Wobei so klar
ist es eigentlich nicht, denn ich behaupte, dass gerade die Baureihe C 5/6
bei der Dampftraktion grosse Akzente schaffen konnte.
So fuhren die C 5/6 mit den
Versorgungszügen
in beiden Weltkriegen gigantische
Leistungen. Das Leben eines ganzen Landes hing an einer einzigen
Lokomotive. Mitbekommen hatte das im Land niemand. So
vergass man, dass in der Not die Dampflokomotiven der Reihe C 5/6 die Züge
an die Grenze brachten. Sie operierten im Ausland. Das interessiert
niemand. Wer in der Schweiz weiss schon, dass das Land eine Hochseeflotte
hat?
Genau das war der Nachteil. Im Land herrschte grosse Not, da
kümmert man sich nicht um
Lokomotiven. Die Baureihe C 5/6 wurde nach Frankreich
entsandt um dort die schweren Züge mit den Lebensmitteln zu hohlen.
Dringend benötigte Rohstoffe kamen so dank den eigenen Lokomotiven ins
Land. Dieses hatte die tapferen Maschinen jedoch wieder vergessen. Genau
so ergeht es heute der Hochseeflotte der Schweiz.
Wenn wir den Krieg weglassen würden, hätten sich vermutlich die C
5/6 in der Schweiz einen sehr guten Ruf erarbeiten können. Aber wegen dem
Krieg stand sie im Schatten der etwas älteren
Lokomotiven der Baureihen
A 3/5. Diese
Schnellzugslokomotive
konnte sich vor den
Reisezügen so richtig in Szene setzen und wurde
dadurch zu einer sehr bekannten Baureihe. Beim Anblick eines Bildes der
legendären
A3t der
Gotthardbahn
leuchten auch meine Augen kurz auf.
Der Verkehr am Gotthard hätte laufend zugenommen und so wären auch die vorhandenen Maschinen schnell überfordert worden.
Der nächste Schritt hätte um das Jahr 1920 herum umgesetzt werden
müssen. Genau genommen war das die Zeit, als die ersten
Krokodile
an den Gotthard kamen. Noch grössere und bekanntere Lokomotiven wären wohl die Folge davon gewesen. Der nächste Schritt bei der Traktion von Zügen waren vier Triebachsen bei Reisezügen und sechs Triebachsen bei Güterzügen.
Eine logische Weiterentwicklung der Baureihen
A 3/5 und der C 5/6.
Damit hätte sich bereits um 1920 die
Mallet-Bauweise
in der Schweiz festsetzen können. Jedoch kam das nicht, weil der Krieg in
Europa alles veränderte.
Die C 5/6 sollte somit die letzte in der Schweiz beschaffte grosse
Dampflokomotive sein. Die elektrischen
Lokomotiven hatten im Krieg gezeigt, wie abhängig vom
Ausland der
Dampfbetrieb
war. Ein Umschwung in Bern führte letztlich dazu, dass die C 5/6 diesen
Status bekam, denn auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB zeigten
die elektrischen Lokomotiven was sie konnten und das war für die
Dampflokomotiven schlicht zu viel.
Aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen, war die C 5/6
schon überholt, als sie auf die
Schienen
gestellt wurde. Der Fortschritt mit den elektrischen
Lokomotiven war nicht aufzuhalten. Auch wenn man
wohlwollend sein will, die C 5/6 wurde abgeliefert, als eine doppelt so
starke
Fb 5/7 die
ersten Gehversuche unternahm. Diese
Leistungen konnten die Dampflokomotiven schlicht nicht mehr
bringen, sie waren zu langsam geworden.
Obwohl die Schweizer Dampflokomotiven nie zu den grossen
Berühmtheiten auf der Welt gehörten, mussten sie sich im internationalen
Vergleich nie verstecken. Die
Lokomotiven der
Gotthardbahn
waren immer wieder bei den stärksten Maschinen der Welt vertreten. Das
vergisst man immer wieder, wenn man von den Lokomotiven der Schweiz
sprach. Man kannte nur die elektrischen Veteranen
Be 4/6 und
Ce 6/8 II
und kaum Dampflokomotiven.
So können unsere Maschinen weder mit einer BR 01, BR 52 oder sogar mit den gigantischen 241 A 65 aus Frankreich mithalten.
Alle kamen erst Jahre später. In einer Zeit, wo die Traktion der
Züge in der Schweiz bereits nach acht
Triebachsen
schrie. 1931 kamen am Gotthard die Lokomotive mit acht Triebachsen. Der legendäre BigBoy aus den USA, hatte gleich viele Triebachsen erhalten. Er war um diese Zeit gar noch nicht entwickelt worden.
Da die
Lokomotive jedoch elektrisch fuhr, sah man diesen
Vergleich schlicht nicht mehr. Auch die erwähnten Dampflokomotiven müssen
sich beim Baujahr anstrengen um an die
Ae 8/14 heran zu kommen. In so
einem Land gibt es keine grossen Dampflokomotiven.
Die Baureihe C 5/6 traf es noch in der Blütezeit ihres Lebens. So
wurden die letzten
Lokomotiven trotz den Kriegswirren abgeliefert. Aber
bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, mehr sollten es nicht mehr werden.
Wie deutlich das sein sollte, ahnte man nicht. So erstaunt es nicht, dass
bereits zwei Jahre nach der letzten C 5/6 die erste elektrische Lokomotive
für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB abgeliefert wurde.
Die nur zwei Jahre alten Dampflokomotiven waren nun schlicht
veraltet und gehörten der Vergangenheit an. Das war schnell und in dieser
Zeit konnte sich die C 5/6 nicht gross ins Bild setzen und bekannt werden.
Als Dampflokomotive hatte sie verloren, im Vergleich mit anderen
Bahngesellschaften
konnte sich diese Baureihe jedoch zeigen. 1913 waren fünf
Triebachsen
bei einer
Lokomotive noch eine seltene Sache und nur auf steilen
Strecken vorgesehen.
Bei der SLM in Winterthur wurde gleichzeitig zur C 5/6 auch eine
andere
Lokomotive mit fünf gekuppelten
Achsen
gebaut. Die
Fb 5/7 der
BLS mechanisch kaum grosse Unterschiede. Diese hatte jedoch die doppelte
Dauerleistung
und war nicht einmal so schwer, wie die Dampflokomotive der Baureihe C
5/6, wenn sie eine Fahrt begann. Das Personal stellte die elektrische
Lokomotive ab und ging zum Bier. Bei der C 5/6 musste man noch
umfangreiche
Nacharbeiten
vornehmen.
Die beiden
Lokomotiven wurden weltberühmt, was man von den C 5/6
nicht sagen konnte. Hier kann die Schweiz nicht mehr mithalten, denn was
kam hier? Die kleine unscheinbare Ae
4/6 wurde in Betrieb genommen. Mit der
Vielfachsteuerung
und der gigantischen
Leistung
ein kleines Wunder.
Ein direkter Vergleich lohnt sich. Der BigBoy konnte bei einem
Gewicht von 548.3 Tonnen eine
Leistung
von 4 560 kW abrufen. Die kleine Ae 4/6
konnte lediglich 4 100 kW abrufen, hatte aber auch nur ein Gewicht von 105
Tonnen. Zu zweit wären war aber bei 8 200 kW Leistung und erst bei 210
Tonnen. Anders betrachtet, bei gleichem Gewicht, wären bei der
Ae 4/6 Leistungen von über 20 000
kW möglich geworden. Fünfmal mehr, als beim schwächelnden BigBoy.
Mit dem Schritt von 1920 wurden die grossen Dampflokomotiven in
der Schweiz schlicht beerdigt. Was da gekommen wäre, kann man nur erahnen.
Die
Krokodile waren
der Schlüssel zum Erfolg und die letzte grosse Dampflokomotive der
Schweiz, die C 5/6 ebnete diesem Maschinen den Weg. Sie geriet dadurch
aber ins Hintertreffen und das hatte die C 5/6 schlicht nicht verdient. Es
war eine grosse
Lokomotive der Schweiz.
So wurden die Lokomotiven mangels Gebrauch als Reservelokomotive abgestellt, jedoch noch nicht abgebrochen. Nur, wer neue grosse Dampf-lokomotiven einmottet, muss etwas viel Besseres haben.
Das hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB und
niemand wollte mehr auf die elektrischen
Lokomotiven verzichten. Mit dem zweiten Weltkrieg und der dadurch in der Schweiz entstandenen Not, kamen sie, genau die eingemotteten Lokomotiven. Sie machten sich vor Versorgungszügen erneut nützlich. Strecken im Ausland, die mit elektrischen Lokomotiven nicht befahren werden konnten.
Die C 5/6 wurde somit zum Retter in der Not
und das sollten wir nie vergessen, wenn wir von
Krokodilen
sprechen, denn die machten das nicht.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
gleiche Person stand mit glänzenden Augen vor einer braunen elektrischen
Die
gleiche Person stand mit glänzenden Augen vor einer braunen elektrischen
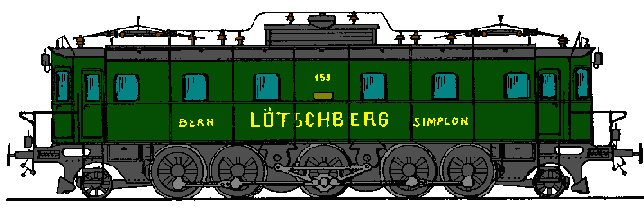 Ohne
Ohne  Betrachten
wir diese Entwicklung der
Betrachten
wir diese Entwicklung der
 Jedoch
waren gerade die Nationen, die heute die bekanntesten Dampflokomotiven von
Europa haben, dafür verantwortlich, dass die Schweiz keine grösseren
Dampflokomotiven mehr baute.
Jedoch
waren gerade die Nationen, die heute die bekanntesten Dampflokomotiven von
Europa haben, dafür verantwortlich, dass die Schweiz keine grösseren
Dampflokomotiven mehr baute.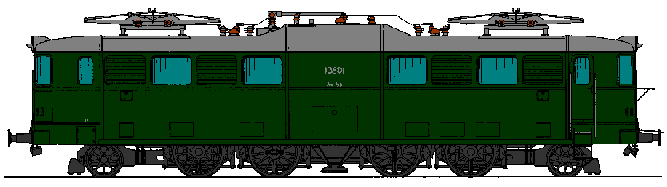 Um
1942 machten in den USA, also fast 30 Jahre nach den ersten Maschinen der
Reihe C 5/6, sich die Challenger oder der Big Boy vor den
Um
1942 machten in den USA, also fast 30 Jahre nach den ersten Maschinen der
Reihe C 5/6, sich die Challenger oder der Big Boy vor den  Dass die C 5/6 nicht schon nach knapp 20 Jahren Einsatz zur
Vergangenheit gehörten, war dem vorausschauenden Denken einiger
verantwortlichen Personen zu verdanken.
Dass die C 5/6 nicht schon nach knapp 20 Jahren Einsatz zur
Vergangenheit gehörten, war dem vorausschauenden Denken einiger
verantwortlichen Personen zu verdanken.