|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Sowohl die
Beleuchtung,
als auch die Steuerung mussten von der
Spannung
der
Fahrleitung
unabhängig funktionieren. Schliesslich musste der Lokführer sehen, welchen
Schalter er für die gewünschte Funktion betätigen muss. Die gemachte
Handlung wurde dann von der Steuerung umgesetzt. Dazu gehörte zum Beispiel
auch das heben des
Stromabnehmers.
Es lohnt sich, wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen.
Für die Steuerung der
Lokomotive und die
Beleuchtung
stand ein Bordnetz zur Verfügung. Dieses funktionierte mit
Gleichstrom
und einer
Spannung
von 36
Volt.
So aufgebaute
Bordnetze
hatten sich in der Schweiz schon seit Jahren bewährt und kamen bei allen
Lokomotiven und
Triebwagen
zur Anwendung. Daher kann man hier klar von einem standardisierten
Bordnetz sprechen. Damit war auch klar, dass die Reihe Re 4/4 damit
ausgerüstet würde.
Verschlossen wurde dieser Kasten mit einem
ein-fachen Deckel, der mit einem Schnappschloss ver-sehen wurde. Damit er
sich nicht ungewollt öffnen konnte, waren zwei zusätzliche Riegel auf der
Seite angebracht worden. Geöffnet wurde der Deckel indem er durch die Schwerkraft nach unten geklappt wurde. Im ge-öffneten Zustand stand er waagerecht von der Lokomotive ab und verletzte so das Lichtraumprofil.
Dabei war der Deckel so ausgelegt worden,
dass die schweren Bauteile über Gleitbahnen aus dem Kasten gezogen und auf
eine spezielle Hebevorrichtung verschoben werden konnten. Damit haben wir
aber schon die gemeinsamen Punkte behandelt.
Bei den
Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 406 wurden zwei
solche
Batteriekasten
verwendet. Diese montierte man auf beiden Seiten und in jedem wurde eine
Batterie
eingebaut. Bei den restlichen Exemplaren vereinfachte man diesen Aufbau
etwas und so wurde nur noch ein Kasten verbaut. Dazu wählte man die rechte
Seite der Lokomotive. Der Platz in diesem Kasten reichte jedoch für zwei
Batterien, so dass er deutlich grösser war.
Je nach Platz wurden in einem Kasten eine
oder zwei
Bleibatterien
eingebaut. Diese hatten sich seit Jahren bewährt. Sie hatten jedoch den
Nachteil, dass sich bei der Aufladung Wasserstoff bilden konnte. Damit
sich dieser im
Batteriekasten
nicht sammeln konnte, war der Kasten mit Belüftungen versehen worden.
Trotzdem ging von diesen Elementen eine gewisse Gefahr hervor. Aber die
Vorteile überwiegten dieses geringe Risiko.
Um die für das
Bordnetz
der
Lokomotive benötigte
Spannung
von 36
Volt
zu erhalten, mussten zwei solche Behälter eingebaut werden. Auch sie
wurden in Reihe geschaltet, so dass letztlich die ge-wünschte Spannung
vorhanden war. Unterschiede innerhalb der Baureihe gab es hier nicht. Trotz der recht hohen Kapazität dieser Blei-batterien, wurden sie bei ausgefallener Ladung sehr schnell entleert. Ohne diese Spannung war die Lokomotive jedoch nicht mehr verwendbar.
Daher wurden in jedem
Depot,
aber auch an jedem grösseren
Bahnhof
der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB solche Behälter vorgehalten. Selbst
die erwähnte Hebevorrichtung war dort vorhanden. Von Vorteil war, dass
diese Behälter auch bei den
Reisezugwagen
passten.
Wurde die
Lokomotive mit Hilfe der Steuerung und des
Bordnetzes
eingeschaltet, aktivierte sich die an den
Hilfsbetrieben
angeschlossene
Umformergruppe
automatisch. Diese gab eine
Spannung
von 40
Volt
Gleichstrom
ab. Dadurch wurden die Baugruppen jetzt ab dem
Umformer
versorgt. Wegen der höheren Spannung erfolgte auch die Ladung der
eingebauten
Batterien.
Damit stand das Bordnetz jederzeit immer in gesicherter Form zur
Verfügung.
Direkt an den
Batterien
abgeschlossen wurden die
Beleuchtungen
in der
Lokomotive. Dazu gehörten die Lampen in den
Führerständen,
aber auch jene im Durchgang und im
Maschinenraum.
Diese konnten daher, sofern sie nicht gelöscht wurden, bei ausgeschalteter
Lokomotive die Batterien entladen. Es gab jedoch keine andere Lösung, da
hier auch Licht benötigt wurde und die Steuerung zu aktivieren. Alle
anderen Beleuchtungen liefen jedoch über die Steuerung.
Zu diesen Lampen gehörten die
Beleuchtungen
der
Instrumente
im
Führerstand
und natürlich die
Stirnbeleuchtung.
Spannend dabei waren jedoch die Lampen aussen an der
Lokomotive, denn hier gab es zwischen den beiden
Bauarten
einen kleinen Unterschied, den wir betrachten müssen. Bei allen Lokomotiven wurden unten über den Puffern zwei Lampen auf gleicher Höhe montiert. Es kamen dabei Lampen mit einem klaren flachen Glas zur Anwendung. Diese konnten daher nur weiss leuchten.
Um farbige
Signalbilder
zu erzeugen, mussten, wie bei den anderen vorhandenen Baureihen, spezielle
Vorsteckgläser verwendet wer-den. Dabei gab es sogar eine spezielle
Ausführung für den Zug-schluss, die auch ein rot/weisses Blech enthielt.
Damit das normale Bild der
Spitzenbeleuchtung
in Form eines A entstand, wurde oben eine dritte weisse Lampe montiert.
Diese wurde bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 mittig am oberen
Rand der Türe eingebaut. Bei den Nummern 427 bis 450 wurde die dritte
Lampe jedoch in das Dach verschoben, so dass sie im Vergleich etwas höher
positioniert wurde. Lediglich eine Anpassung an die beiden
unterschiedlichen
Fronten.
Da oben kein zusätzliches Glas gesteckt
werden konnte, musste für die hier mögliche rote Farbe eine andere Lösung
gefunden werden. Dazu verbaute man eine zusätzliche Lampe. Diese wurde bei
den Nummern 401 bis 426 links von der oberen weissen Lampe ebenfalls in
der Türe montiert und war daher leicht aus der Mitte verschoben. Bei den
restlichen
Lokomotiven positionierte man diese Lampe ebenfalls im
Dach und nun unter der normalen Lampe.
Wir können nun zur Steuerung der
Lokomotive wechseln. Aktiviert wurde diese auf allen
Maschinen dieser Baureihe mit einem
Steuerschalter.
Erst wenn dieser aktiviert wurde, konnten die weiteren Funktionen der
Lokomotive abgerufen werden. Dabei führte die Steuerung die vom Lokführer
über die Bedienelemente angeforderten Aufgaben aus. Gleichzeitig waren
jedoch auch die Überwachungen der einzelnen Baugruppen aktiviert worden.
Im schlimmsten Fall, war die
Lokomotive jedoch ohne jegliche Funktion. In diesem Fall
wurde jedoch eine
Zwangsbremsung
ausgelöst, so dass der Zug angehalten werden konnte. Die Be-hebung der
Störung oblag jedoch dem
Lokomotivpersonal. Nicht sämtliche Relais lösten automatisch den Hauptschalter aus. So bewirkte die Kontrolle der Hüpfer zur Stufenregelung nur ein Öffnen der Trennhüpfer. Nach dem Zurückdrehen des Steuerkontrollers konnte daher gleich wieder mit der Zuschaltung der Hüpfersteuerung begonnen werden.
Eventuell konnte dabei die defekte
Fahrstufe
einfach «über-sprungen» werden. Alle anderen
Relais
wirkten jedoch auf den
Hauptschalter,
so dass die
Lokomotive ausgeschaltet wurde. Ergänzend muss erwähnt werden, dass der Hauptschalter vom Lokomotivpersonal immer eingeschaltet werden konnte. Die dazu erforderlichen Bedingungen wurden mit einfachen Ver-schlüssen kontrolliert.
Gab es dort kein Unterbruch, schaltete der
Schalter mit der Ein-schaltspule ein. Die
Relais
der Steuerung waren jedoch in der Leitung zur Haltespule eingebaut worden.
War diese Leitung wegen einem Relais unterbrochen, schaltete der
Hauptschalter
wieder aus. Jedoch gab es unterschiedliche Ausführungen, die eine andere Reaktion zur Folge hatten. Bei der Kontrolle der Spannung in der Fahrleitung war beim Relais eine Verzögerung eingebaut worden.
Diese war nötig, damit ein kurzer Abriss beim
Stromabnehmer
nicht dazu führte, dass die
Lokomotive ausgeschaltet wurde. Dieses
Minimalspannungsrelais
wurde, wenn es ausgelöst hatte, automatisch wieder zurückgestellt.
Erst bei der Kontrolle wurde die Meldeklappe
festgestellt. Ein Grund, warum später bei den
Drucklufthauptschaltern
auf den Einbau dieses Bauteil verzichtet wurde. Es war nahezu nutzlos. Die weiteren Relais bewirkten jedoch, dass der Hauptschalter sofort ausgeschaltet wurde. Auch sie stellten sich danach zurück, wobei die hier vorhandene Anzeige in Form einer Meldeklappe erhalten blieb.
In der Folge konnte wieder eingeschaltet
werden. Erst, wenn auch beim zweiten Versuch der
Hauptschalter
sofort wieder ausgeschaltet wurde, führte das
Lokomotivpersonal
die Behebung der Störung durch. Dabei orientierte es sich an den
Meldeklappen.
Theoretisch war es möglich, diesen Vorgang
beliebig oft zu wiederholen. Das galt auch bei der Überwachung der
Steuerung. Damit dies jedoch nicht so lange erfolgte, bis es zu einem
grösseren Defekt kann, wurde in den Vorschriften für das
Lokomotivpersonal
geregelt, dass nur eine Rückstellung erfolgen darf. Damit konnte eine
einmalige Fehlfunktion ausgeschlossen werden. Trat das gleiche Problem
jedoch zweimal auf, handelte es sich um eine Störung.
Trat die Störung erneut auf, mussten die
erforderlichen Handlungen anhand der Schulung vorge-nommen werden. Eine
Einrichtung, die das Personal bei dieser Behebung der Störung
unterstützte, gab es jedoch nicht. Allenfalls konnte noch mit reduzierten
Funktionen ein
Bahnhof
angefahren werden. Je nach Störung war jedoch auch eine
Hilfslokomotive
anzufordern. Es lag dabei beim
Lokomotivpersonal
die Störung korrekt zu handhaben. Neben den Überwachungen des Fahrzeuges waren auch Einrichtungen zur Kontrolle des Lokomotivpersonals eingebaut worden. Diese teilten sich in zwei Bereiche auf. Dabei wurde die Verfügbarkeit des Lokführers mit Hilfe einer Sicherheitssteuerung kontrolliert.
Aktiviert wurde diese Einrichtung in dem Moment, wenn sich das Fahrzeug
bewegte. Dabei spiel-te es keine Rolle, ob dieses bedient, ferngesteuert
oder geschleppt wurde.
Um das Personal auf diesen Umstand aufmerksam
zu machen, war die Vorrichtung mit einer Plombe versehen worden. Die aktive Sicherheitssteuerung hatte zwei Überwachungen ent-halten. Dabei wirkte der Schnellgang, wenn die Bedienein-richtung nicht benutzt wurde. Um eine kurze Unterbrechung zu ermöglichen, passierte auf den ersten 50 Metern noch nichts.
Danach wurde eine
Warnung
ausgegeben. Diese wirkte akustisch auf weiteren 50 Meter. Erst jetzt
reagierte der
Schnellgang.
Der
Hauptschalter
wurde ausgelöst und eine
Zwangsbremsung
einge-leitet. Als zweite Einrichtung war der Langsamgang als Wachsam-keitskontrolle vorhanden. Dabei war der Langsamgang aktiviert, wenn die Bedieneinrichtung betätigt wurde und keine der definierten Handlungen ausgeführt wurde.
Zu diesen Handlungen zählten die Betätigung
des
Steuer-kontrollers,
oder eine Druckänderung an einer der eingebauten pneumatischen
Bremsen.
Der
Langsamgang
begann danach jedoch erneut mit der Wegmessung.
Sofern während 1 600 Metern keine Handlung
ausgeführt wurde, meldete sich der
Langsamgang
mit einer
Warnung.
Dabei wurde nun ein im Schall veränderlicher Ton ausgegeben. Die
Reaktionszeit des Lokführers betrug 200 Meter. Erfolgte in dieser Zeit
keine der Handlungen und wurde der
Schnellgang
nicht aktiviert, löste die
Wachsamkeitskontrolle
den
Hauptschalter
aus und es kam auch jetzt zur einer
Zwangsbremsung.
Es war jedoch jederzeit eine Rückstellung der
Sicherheitseinrichtung
möglich. Dazu mussten einfach die vorgegebenen Handlungen vom Lokführer
ausgeführt werden. Damit wurde die
Zwangsbremsung
wieder gelöst. Der
Hauptschalter
musste jedoch vom Lokführer wieder eingeschaltet werden. Dabei war dies
jedoch nur möglich, wenn zuvor die
Sicherheitssteuerung
zurückgestellt wurde. Ansonsten wurde die
Lokomotive sofort wieder ausgeschaltet.
Da die
Sicherheitssteuerung
immer aktiv war, wurden die Betätigungen des Lokführers bei den Nummern
401 bis 406 auch über die
Vielfachsteuerung
übertragen. Wurden daran zwei
Lokomotiven angeschlossen, arbeiteten die Vorrichtungen
parallel und das Personal wusste nicht, von welcher Maschine die
Aufforderung zur Handlung kam. Die
Steuerwagen
besassen hingegen nur die Bedieneinrichtungen und hatten keine eigene
Sicherheitssteuerung.
Aktiviert wurde die Zugsicherung jedoch nur bei entsprechen ausgerüsteten Signalen. Dazu war mittig unter der Lokomotive ein Magnet vorhanden. Dessen Felder wurden beim Signal in bestimmten Fällen an die seitlich montierten und je nach Richtung geschalteten Empfängern gesendet.
Damit wurde im bedienten
Führerstand
eine
Warnung
in Form einer gelben Lampe und einen dauernden Ton ausgegeben. Der
Lokführer hatte nun 50 Meter Zeit den
Quittierschalter
zu betätigen.
Tat es dies jedoch nicht, wurden durch die
Zugsicherung
der
Hauptschalter
ausgeschaltet und eine
Zwangsbremsung
eingeleitet. Auch jetzt konnte der Lokführer die Einrichtung mit dem
Quittierschalter
zurückstellen und den Hauptschalter einschalten. Die
Lokomotive konnte die Fahrt ungehindert fortsetzen. Eine
Kontrolle der Bremsung war jedoch bei diesem System schlicht nicht
vorhanden, so dass nur eine
Warnung
erfolgte.
Von
der ferngesteuerten
Lokomotive wurden jedoch die Anforderungen zum Auslösen
des
Hauptschalters
übertragen. Daher konnte bei der
Vielfach-steuerung
die Störung nicht immer einfach eingegrenzt werden. Die Erfahrungen mit der Vielfachsteuerung bei der Baureihe Ae 4/6 führten dazu, dass bei der Reihe Re 4/4 ein neuartiges Kabel verwendet wurde. Dieses hatte nur noch 42 Adern und konnte daher als ein einziges Kabel ausgeführt werden.
Dadurch konnten die Störungen bei der
Vielfachsteuerung
durch die Kabel merklich reduziert werden. Von den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB wurde dieses Kabel als
Vst III bezeichnet. Es wurde bei deaktivierter Steuerung und daher ausgeschalteter Lokomotive in die passenden Steckdosen am Stossbalken der ausgerüsteten Fahrzeuge gesteckt. War dies erfolgt, konnte die Steuerung auf einem angeschlossenen Fahrzeug aktiviert werden.
Die nun erfolgten Anforderungen des
Lokomotivpersonals
wurden auch auf die an der Leitung angeschlossene
Lokomotive übertragen, wobei deren Steuerung nicht
aktiviert sein musste.
Es war auch möglich, eine
Lokomotive zu einem
Steuerwagen
«umzubauen». Dabei waren jedoch viele Handlungen vorzunehmen. Dazu musste
der Wählschalter zum
Stromabnehmer
auf «0» gestellt werden. Zudem wurden die
Fahrmotoren
mit den
Trennhüpfern
abgetrennt. Danach konnte die Lokomotive als «Steuerwagen» verwendet
werden. Einfacher war es da schon die Maschine zu schleppen, denn dazu
musste sie nur remisiert werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Damit
die
Damit
die 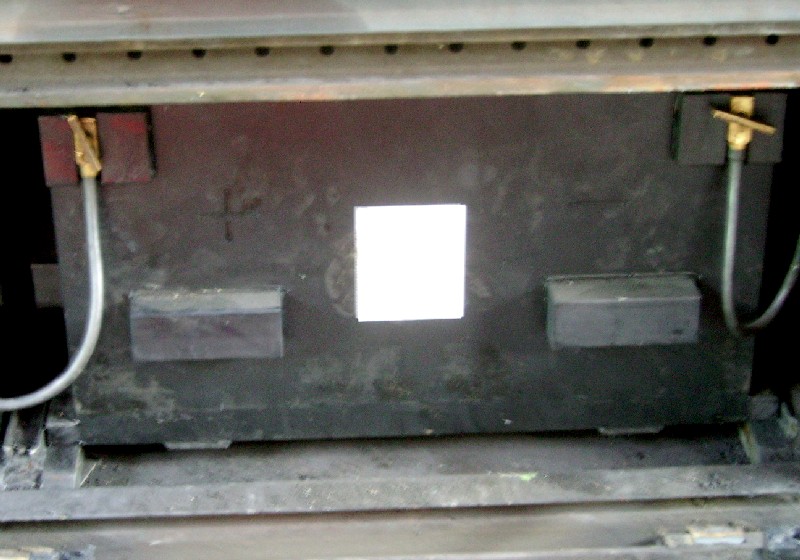 Verwendet
wurden Behälter in genormter Grösse. Diese besassen neun mit verdünnter
Säure gefüllte Zellen, die in Reihe geschaltet eine
Verwendet
wurden Behälter in genormter Grösse. Diese besassen neun mit verdünnter
Säure gefüllte Zellen, die in Reihe geschaltet eine  Wenn
wir schon bei der
Wenn
wir schon bei der
 Die
Überwachungen der
Die
Überwachungen der
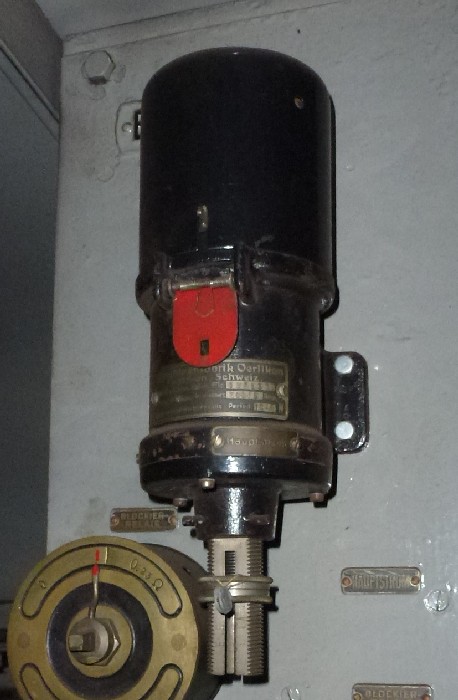 Das
bei den
Das
bei den

 Als
zweite Einrichtung wurde die
Als
zweite Einrichtung wurde die
 Die
Einrichtung erlaubte es, die
Die
Einrichtung erlaubte es, die