|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beginnen wir die Betrachtung der nicht direkt mit dem
Antrieb
der Maschine verbunden elektrischen Einrichtungen, mit den Nebenbetrieben.
Diese waren für die
Lokomotive
sehr wichtig, da die Baureihe Re 4/4 schliesslich für den Einsatz als
Schnellzugslokomotive
für den
Personenverkehr
vorgesehen war. Gerade dort wurde die
Spannung
dieser Einrichtung, für die
Heizung
der Wagen benötigt. Daher wurden damals diese Nebenbetriebe auch als
Zugsheizung
bezeichnet.
Die
Spannungen
für die
Zugsheizung
wurden von der
Primärwicklung
abgenommen. Dort waren zwei
Anzapfungen,
die Spannung von 800 und 1000
Volt
erzeugten. Jede Leitung wurde anschliessend zu einem eigenen
Hüpfer
geführt. Welcher davon geschaltet wurde, war von der Steuerung abhängig.
Die Heizhüpfer waren jedoch so verschlossen, dass immer nur einer
eingeschaltet werden konnte. So wurde ein
Kurzschluss
zwischen den Anzapfungen verhindert.
Nach dem Heizhüpfer wurde die Messung des in der Leitung
vorhandenen
Stromes
vorgenommen. Wurden die eingestellten maximalen Werte überschritten, löste
die Steuerung den
Hauptschalter
aus. Dieser Wert lag bei den
Lokomotiven
mit den Nummern 401 bis 426 bei maximal 500
Ampère.
Die restlichen Maschinen mit den Nummern 427 bis 450 hatten jedoch nur
noch einen maximalen Strom von 450 Ampére erhalten.
Es musste daher immer das
Heizkabel
der
Reisezugwagen
verwendet werden. Musste ausserordentlich die
Heizung
ab einer
Vorspannlokomotive
erfolgen, kamen spezielle
Hilfsheizkabel,
die bei grösseren
Bahnhöfen
vorrätig waren, zum Einsatz. Auf den
Steuerwagen
wurden diese Kabel sogar mitgeführt. Eine Lösung, die so gut
funktionierte, dass man in der Schweiz grundsätzlich auf die Kabel bei den
Lokomotiven verzichten konnte.
Die Rückleitung der
Spannung
in der
Zugsheizung
erfolgte über die bei den Wagen angebrachten
Erdungsbürsten.
Damit musste nur eine Leitung gezogen werden. Auf der
Lokomotive hatte diese Einrichtung daher zur
Folge, dass die
Primärwicklung
eine
Anzapfung
erhalten hatte. Wobei genau genommen hier noch zwei vorhanden waren, weil
es noch vereinzelte Wagen für 800
Volt
im Bestand der
Staatsbahnen
gab.
Mehr gab es bei der
Zugsheizung
der Maschinen jedoch nicht mehr, so dass wir uns den
Hilfsbetrieben
zuwenden können. Diese beschränkten sich auf die
Lokomotive. Jedoch waren hier die benötigten
Spannungen
schon sehr früh genormt worden. Der Vorteil dieser Norm, werden wir später
noch erfahren, denn er lag eigentlich gar nicht auf der Maschine, denn
dort wurde einfach ein Abgriff im
Transformator
benötigt.
Die
Hilfsbetriebe
wurden daher ab der separat ausgeführten Hilfsbetriebewicklung mit einer
Spannung
von 220
Volt
versorgt. Es war die einzige
Wicklung,
die mit Kupfer aufgebaut wurde. Sie war zudem auf der Seite mit der Erdung
mit der
Primärspule
verbunden. Theoretisch hätte die Spannung daher auch dort abgenommen
werden können. Die eigene Spule bot jedoch den Vorteil, dass die hier
verwendete Spannung sehr genau eingestellt werden konnte.
Bei den
Lokomotiven wurden die gesamten
Hilfsbetriebe
abgesichert und dabei vor zu hohen Belastungen geschützt. Dabei verwendete
man bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 ein
Relais.
Bei den Lokomotiven mit den Nummern 427 bis 450 kam jedoch eine einfache
Sicherung
zur Anwendung. Diese Lösung war eigentlich üblich, so dass die unteren
Nummern in diesem Punkt einen speziellen Fall waren, der aber auch
funktionierte.
Nach der Absicherung wurde die
Spannung
dem Depotumschalter zugeführt. Dieser spezielle Schalter konnte die
gesamten
Hilfsbetriebe
vom
Transformator
trennen und einer seitlich an der
Lokomotive angebrachten Steckdose
zuschalten. Mehr war nicht, aber genau hier lag der Grund für die Spannung
von 220
Volt,
denn der Anschluss war bei allen Baureihen der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB identisch ausgeführt worden.
Wurden die
Hilfsbetriebe
mit
Depotstrom
versorgt, konnten sie im normalen Rahmen genutzt werden. Jedoch war die
Absicherung nicht mehr auf der
Lokomotive, sondern in der Versorgung des
Depotstromes. Dort war eine zerstörungsfreie
Sicherung
vorhanden. So konnten Störungen an den Hilfsbetrieben leichter und ohne
Schäden geprüft und behoben werden. Jedoch bot der Depotstrom noch einen
weiteren Vorteil, den wir gleich erfahren werden.
Diese schaltete dabei den Kompressorschütz so, dass die
Druckluft
ergänzt wurde, oder nicht. Eine Lösung, die schon bei anderen Baureihen so
gelöst wurde. Es muss je-doch gesagt werden, dass der
Kompressor
kaum auf ande-re Weise angeschlossen werden konnte. Dank dem hier verwendeten von der Druckluft unabhäng-igen Schütz konnte der Kompressor auch eingeschaltet werden, wenn kein Druck mehr vorhanden war.
Wurden die
Hilfsbetriebe
jetzt ab dem
Depotstrom
betrie-ben, konnte die
Druckluft
der
Lokomotive ohne Schwier-igkeiten mit dem
Kompressor
ergänzt werden. Ein Vor-gang, der jedoch nur in einem
Depot
funktionierte. An den anderen Orten blieb nur die
Handluftpumpe. Ein wichtiger Verbraucher, der an den Hilfsbetrieben angeschlossen wurde, war die Kühlung der elektrischen Bauteile.
Diese war wichtig, weil die installierte
Leistung
so ausge-legt wurde, dass die Baugruppen diese nur erbringen konnten, wenn
sie ausreichend abgekühlt wurden. Das erlaubte, dass diese Bauteile
leichter werden konnten. Ein Vorteil, der gerade bei der hier
vorgestellten
Lokomotive sehr wichtig war.
Beginnen wir die Betrachtung der
Kühlung
mit dem
Transformator.
Dieser wurde in einem Gehäuse eingebaut und dieses mit speziellem
Öl
befüllt. Dabei hatte dieses
Transformatoröl
gute Eigenschaften bei der
Isolation.
Es konnte so das Gewicht der Isolation teilweise eingespart werden. Jedoch
wurde dieses Öl auch für die Kühlung des Transformators genutzt. Dabei war
das Prinzip einfach, denn das Öl wurde von den warmen Leitern erhitzt.
Damit frisches
Kühlmittel
zu geführt wurde, musste dieses zirkulieren. Zu einem gewissen Teil
übernahm dies das
Öl
selber durch die Veränderung der Dichte. Die Rückkühlung erfolgte am
Gehäuse. Wurde jedoch
Leistung
benötigt, reichte diese primitive Art der
Kühlung
nicht mehr aus. Daher musste das Kühlmittel künstlich in Bewegung gesetzt
werden. Dazu war eine von den
Hilfsbetrieben
versorgte
Ölpumpe
vorhanden.
Dieser Ölkühler gab die Wärme in die Umgebung ab und verringerte
so die Temperatur des
Kühlmittels.
Damit diese
Kühlung
noch verbessert werden konnte, wurde der Ölkühler künstlich mit frischer
Luft versorgt und dazu verwendete man die
Fahrmotorventilation. Es waren auf der Lokomotive zwei Ventilatoren vorhanden, die jedem Drehgestell zugeteilt waren. Diese waren im Bereich der Fahrmotoren angeordnet worden. Mit einem Motor von den Hilfsbetrieben in Bewegung versetzt, bezogen die Ventila-toren die Luft für die Kühlung der Bauteile im Maschinenraum.
Dorthin gelangte diese durch die seitlichen
Lüftungsgitter
und der
Maschinenraum
diente zur Beruhigung der Luft. Ein bisher oft angewendetes Prinzip. Von den Ventilatoren in Bewegung versetzt, wurde die Luft unter leichtem Über-druck durch die Kanäle gepresst. Dabei passierte diese den Ölkühler und führte so die vom Transformatoröl abgegebene Wärme ab.
Anschliessend gelangte die
Kühlluft
zu den beiden
Fahrmotoren.
Auch dort durch-strömte sie die Teile und nahm die Wärme auf.
Anschliessend wurde die Luft im Bereich der beiden
Drehgestelle
wieder ins Freie entlassen. Der Vorteil dieser Kühlung war, dass die Motoren von Schmutz befreit wurden und auch Feuchtigkeit abgezogen wurde. Jedoch war sie bei voller Leistung sehr laut und wirkte daher störend.
Gerade bei geringen Geschwindigkeit war der Lärm so hoch, dass er die
Fahrgäste in den
Bahnhöfen
behinderte. Besonders die zahlreichen Hallen dröhnten in diesem Fall
förmlich. Damit eine Besserung eintreten konnte, lief die
Ventilation
nur auf halber
Leistung.
Diese Reduktion der
Leistung
für die
Ventilation
erreichte man mit den beiden
Fahrmotoren.
Wurden diese in Reihe angeschlossen, liefen sie mit ungefähr der halben
Leistung und der Lärm reduzierte sich. Erst bei einer Geschwindigkeit, die
höher als 30 km/h lag und bei mehr als sechs Stufen wurde die Ventilation
so umgeschaltet, dass nun die volle Leistung vorhanden war. Der Lärm wurde
nun vom Fahrgeräusch überdeckt.
Das
bedeutete unweigerlich, dass wegen diesem Defekt der
Hilfsbetriebe
die
Lokomotive nicht mehr eingesetzt werden konnte.
Es musste eine Ersatzlok angefordert werden. Auch diverse kleinere Verbraucher hingen an den Hilfsbetrieben. Diese fand man in den beiden Führer-ständen. Dazu gehörten die dort eingebauten Heizungen für den Raum, das Pedal und die Frontscheiben. All diese
Heizungen
waren mit
Widerständen
aufgebaut worden.
Es stand jedoch auch eine Steckdose zur Verfügung, die mit 220
Volt
16 2/3
Hertz
beschriftet, normale Lampen aus dem Landesnetz versorgen konnte. Ausser
den Lampen gab es jedoch kaum passende Geräte in den Läden zu kaufen.
Speziell war die Anzeige der
Fahrleitungsspannung.
Diese Anzeige erfolgte bei allen
Lokomotiven dieser Baureihe über die
Hilfsbetriebe.
Eigentlich keine Neuerung, da dies schon früher so gelöst wurde. Es wurden
jedoch die Versuche mit der Detektion der vergangenen Jahre nicht mehr
umgesetzt. Trotzdem gab es bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426
ein Problem mit der Anzeige der
Spannung,
das gelöst werden musste.
Wurde die
Lokomotive ab einem
Steuerwagen
ferngesteuert, konnte die Anzeige der
Spannung
im Steuerwagen nicht direkt an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen werden. Damit das ging, wurde eine Schaltung eingebaut, die
dafür sorgte, dass die Anzeige auch auf die
Vielfachsteuerung
und so in den Steuerwagen übertragen wurde. So wurde die Spannung auch
beim Steuerwagen angezeigt. Das funktionierte auch, wenn zwei Lokomotiven
vereint wurden.
Zum Schluss bleibt noch die
Umformergruppe,
die mit einer einfachen
Sicherung
und einem Lastschutzschalter angeschlossen wurde. Dabei wurde der Motor
angetrieben einfach und spezielle Schaltungen suchte man vergebens. Damit
lief dieser
Umformer
automatisch an, wenn die
Hilfsbetriebe
mit
Spannung
versorgt wurden. In der Folge setzte auch der
Generator
der Umformergruppe ein und gab die gewünschte
Gleichspannung
ab.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Eine
weitere Aufbereitung der Heizspannung fand jedoch nicht mehr statt. Daher
wurden die Leitungen zu den am
Eine
weitere Aufbereitung der Heizspannung fand jedoch nicht mehr statt. Daher
wurden die Leitungen zu den am 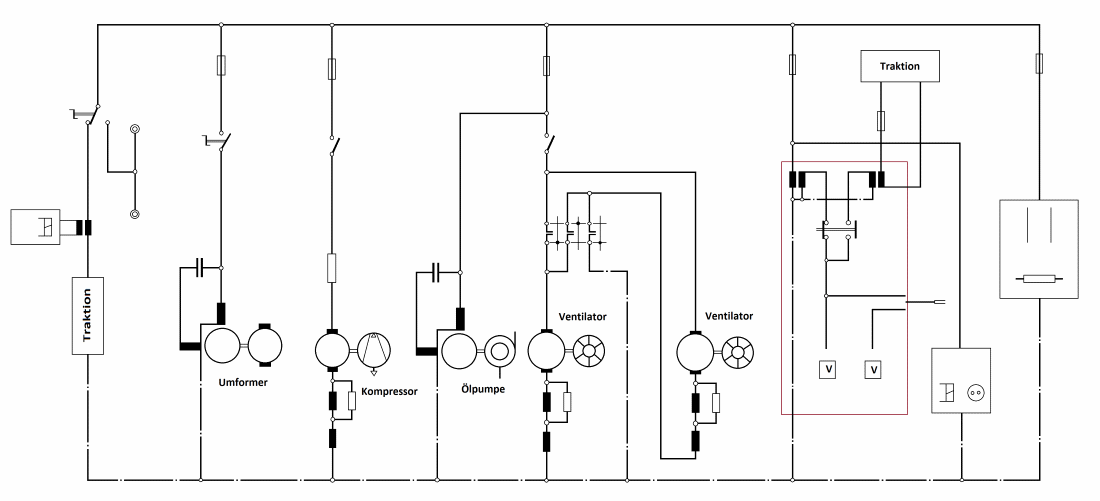
 An
den
An
den
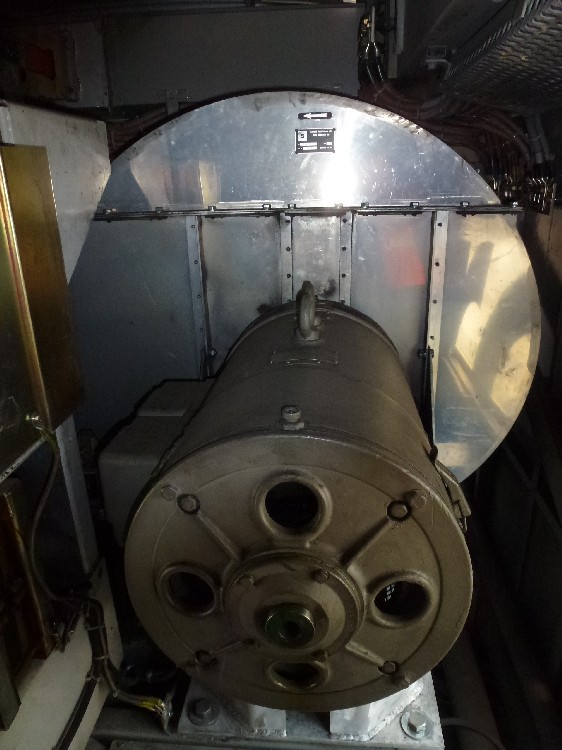 Durch
die
Durch
die
 Die
Motoren der
Die
Motoren der