|
Traktionsstromkreis |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Elektrisch wurde das
Triebfahrzeug
für eine
Spannung
von 15 000
Volt
und 16 2/3
Hertz
ausgelegt. Das war nicht sonderlich überraschend, denn die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB besassen nur dieses System und ein Einsatz im
internationalen Verkehr war nicht vorgesehen. Bei den Einsätzen ins
Ausland fehlten nicht nur die
Fahrleitungen,
sondern bei der Auslieferung das ganze System. Der Krieg hatte der
Infrastruktur
sehr zugesetzt.
Die
Spannung
aus der
Fahrleitung
wurde von zwei identischen
Stromabnehmern
auf das Dach übertragen. Montiert wurden diese auf dem Dach und dort im
Bereich der beiden
Drehgestelle.
Gerade der letzte Punkt war wichtig, wenn die Stromabnehmer zur
Fahrleitung passen sollten. Die seitlichen Verschiebungen reduzierten sich
auf ein Minimum, so dass ein sicherer Betrieb ermöglicht werden konnte.
Das war jedoch ein weiterer Vorteil der neuen
Bauart.
Das passte perfekt zur leichten schnellen
Loko-motive. Neu war jedoch, dass der Bügel mit einer
Höhenbegrenzung versehen wurde. Diese verhin-derte, dass sich der
Pantograph durchstrecken konnte. Um diesen Stromabnehmer zu heben, wurde Druck-luft aus der Apparateleitung benötigt. Diese Luft mit einem Druck von sechs bar wurde in einen Zylinder gelassen. Durch die Kraft im Zylinder wurde die Kraft der Senkfeder aufgehoben.
Dadurch war es der vorhandenen
Hubfeder
nun möglich, den
Stromabnehmer
an den
Fahrdraht
zu heben. Diese Hebung erfolgte so lange, bis die ein-gebaute
Höhenbegrenzung den Vorgang blockierte.
Berührt wurde der
Fahrdraht
von der
Wippe,
die mit zwei
Schleifleisten
und den seitlichen
Notlaufhörner
ausgerüstet war. Mit einer Breite von 1 320 mm entsprach die Breite den
damals in der Schweiz geltenden Normen. Dank diesen
Schleifstücken
konnten die
Lokomotiven
der Baureihe Re 4/4 mit nur noch einem gehobenen
Stromabnehmer
verkehren. Welcher das war, wurde mit der Ansteuerung der entsprechenden
EP-Ventile festgelegt.
Die
Schleifstücke
bestanden nach den Vorgaben der Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei den
ersten Maschinen ausschliesslich aus Aluminium. Das war ein Unterschied zu
der Baureihe
Ae 4/4
der BLS-Gruppe,
wo
Kohle
verwendet wurde. Die letzten
Lokomotiven
der Reihe Re 4/4 besassen bei Auslieferung ebenfalls ein Bügel mit Kohle,
der jedoch nicht im Winter verwendet werden durfte. Daher war in dieser
Zeit der Kalender für die Wahl verantwortlich.
Die
Senkfeder
sorgte anschliessend dafür, dass der
Stromabnehmer
gesenkt wurde und danach in Tieflage blieb. Die Kraft der
Hubfeder
verhinderte, dass der Stromabnehmer zu schnell gesenkt wurde. In der Regel wurde der Senkvorgang vom EP-Ventil und damit von der Steuer-ung eingeleitet. Die pneumatische Zuleitung wurde jedoch auch von einem zusätzlichen Schlüssel unterbrochen.
Dieser war für den später noch vorgestellten
Erdungsschalter
und entleerte so die Zuleitung zu den
Stromabnehmern,
wenn die
Lokomotive
geerdet werden musste. So war technisch gesichert, dass dieser Vorgang nur
bei «Bügel tief» erfolgte.
Die beiden
Stromabnehmer
wurden über eine
Dachleitung
miteinander und mit dem
Hauptschalter
verbunden. Um einen defekten Stromabnehmer abzu-trennen, war ein Trenner
vorhanden. Dieser wurde aus dem inneren der
Lokomotive
bedient und unterbrach so die Leitung zum Stromabnehmer. Die bei den
Trennstellen des Daches vorhandenen Trenner mussten jedoch auf dem Dach
der Lokomotive gelöst werden, was kein Nachteil war, weil so oder so ein
Arbeiter dorthin musste.
Weitere Einrichtungen, wie die früher verwendeten
Blitzschutzspulen
gab es bei der Baureihe Re 4/4 nicht mehr. Zum Schutz vor Blitzschlägen
wurde neu ein
Erdungsschalter
eingebaut. Dieser diente der
Verbindung
der
Dachleitung
und der Kabel mit der Erde und erlaubte so Arbeiten an den Einrichtungen.
Jedoch diente die vorhandene Kurzschlussstrecke dafür, dass es bei zu
hoher
Spannung
in der Leitung zu einem Überschlag auf das Dach kam.
Die durch die
Dachleitung
dem
Hauptschalter
zugeführte
Spannung
der
Fahrleitung
passierte kurz davor noch einem Stromwandler. Dieser Wandler überprüfte
den in der Leitung vorhandenen
Strom. Stieg dieser auf einen Wert, der über den
erlaubten Werten lag, wurde die Steuerung mit der entsprechenden Anweisung
versorgt. Diese wiederum löste daraufhin der Hauptschalter aus. Der Strom
in der Zuleitung sollte damit wegfallen.
Als
Hauptschalter
wurde ein von der Firma BBC entwickeltes und auf den
Lokomotiven
Ae 4/6
mit den Nummern 10 801 und 10 809 bis 10 812 erprobtes Modell verwendet.
Dabei sprach die Erprobung auf den erwähnten Maschinen dafür, dass dieses
leichte und zuverlässige Modell verwendet wurde. Es handelte sich dabei um ein mit Druckluft betriebener Schalter. Er war leichter, als die älteren mit Öl befüllten Modelle und konnte daher auf den leichten Lokomotiven dieser Baureihe zusätzliches Gewicht einsparen.
Vorteile, die hier, wo es um jedes Gramm ging, genutzt wurden. Wir
müssen diesen jedoch etwas genauer ansehen, denn mit einem
«druckluftbetriebenen Traktionsfernschalter» können wir herzlich wenig
anfangen. Wurde der Hauptschalter über die Steuerung eingeschaltet, erfolgte der Vor-gang in zwei Schritten. Zuerst wurde das Einschaltrelais aktiviert und der Schalter schloss den im freien montierten Trenner.
Gleichzeitig aktivierte sich auch die Haltespule und der
Hauptschalter
blieb eingeschaltet. Traten jedoch Störungen auf, die den Einschaltvorgang
verhinderten, wurde das Halterelais nicht angesteuert und der Schalter
schaltete sofort wieder aus.
Der Schaltvorgang selber wurde mit Hilfe von
Druckluft
ausgeführt. Dazu war jedoch ein minimaler Druck von 3.5
bar
erforderlich. Lag der Druck tiefer, konnte der Schalter auch von Hand
eingeschaltet werden. Möglich war dies jedoch nur, weil der
Hauptschalter
bei diesem sehr geringen Druck in der
Speiseleitung
durch die eingebaute
Niederdruckblockierung
daran gehindert wurde, dass er sofort wieder ausschalten konnte.
Beim Ausschalten, wurde zuerst im inneren des Schalters ein
Kontakt geöffnet, da das Halterelais abgefallen war. Der dort entstehende
Funke, wurde dann mit Hilfe der
Druckluft
ausgeblasen. Der jetzt erforderliche Druck lag bei fünf
bar
und somit deutlich höher als beim Einschalten des
Hauptschalters.
Anschliessend wurde der Trenner, gesteuert durch das Ausschaltrelais,
weggeschwenkt und so eine sichere Trennung ermöglicht.
Diese
Drucklufthauptschalter
hatten gegenüber den früheren
Ölhauptschaltern
den Vorteil, dass sie auch in der Lage waren, die hohen
Ströme von
Kurzschlüssen
sicher zu schalten. Fehlte die
Druckluft,
oder war der Druck zu gering, um das sichere Löschen des Funkes zu
ermöglichen, konnte der Schalter jedoch zerstört werden. Damit das nicht
passierte, konnte der Schalter bei einem Druck von weniger als fünf
bar
nicht mehr ausgeschaltet werden.
Ein leichter Unterschied zwischen den beiden
Bauarten
gab es hier bei der Anzeige des
Primär-stromes.
Bei den Nummern 427 bis 450, wurde dieser
Strom in der
Spule
gemessen. Mit Hilfe der an allen Achsen der Lokomotive montierten Erdungsbürsten, war die Primärspule mit den Schienen verbunden. Dadurch war nun ein Stromfluss möglich, der letztlich die Leistung erzeugen konnte, die für die Lokomotive benötigt wurde.
Damit abgenutzte
Erdungsbürsten
keine gefährliche Situation hervorrufen konnten, waren diese
unterschiedlich lang ausgeführt worden und sie mussten im Unterhalt
regelmässig kontrolliert werden. Die Primärwicklung wurde, wie die später vorgestellte sekundäre Spule, aus dem leichten Alu-minium gefertigt. Dieses Metall wurde verwendet, weil es leicht war und weil man so wertvolles Kupfer sparen konnte.
Kupfer war in der Schweiz bedingt durch den Krieg zur Zeit des
Baus noch nicht in genügendem Umfang vorhanden. Das bessere aber schwere
Metall Kupfer wurde nur bei der dritten
Wicklung
für die
Hilfsbetriebe
verwendet. Die einzelnen Spulen wurden auf einem Eisenkern aufgesetzt. Dazu verwendete man bei diesem Transformator eine von der BBC entwickelte Radialblechung. Damit veränderten sich auch die Wicklungen.
Diese hatte gegenüber den herkömmlichen
Transformatoren
mit der Anordnung der Bleche in einem geschlossenen H den Vorteil, dass
bei gleicher Wirkung wesentlich weniger Eisen benötigt wurde. Das
reduzierte das Gewicht des Transformators zusätzlich massiv.
Die sekundäre
Wicklung
des
Transformators
hatte zwölf
Anzapfungen
erhalten. So entstanden hier unterschiedliche
Spannungen,
die für die spätere Regulierung der Spannung an den
Fahrmotoren
genutzt wurden. Diese
Sekundärspule
war zudem komplett gegenüber der Erde isoliert ausgeführt worden. Damit
wurde verhindert, dass bei einem Defekt Hochspannung zu den Fahrmotoren
gelangen konnte. Speziell war, dass diese
Isolation
von der Steuerung überwacht wurde.
Der Vorteil bei diesen
Hüpfern
war deren schnelle Schaltfolge und die Möglichkeit, dass auch hohe
Ströme geschaltet werden konnten. Der
entstehende
Lichtbogen
wurden dabei einfach mit
Druckluft
ausgeblasen und in den
Löschkaminen
gefahrlos ge-löscht. Jedoch war es auch mit den Hüpfern nicht möglich, die Spann-ung ohne Unterbruch zu erhöhen. Aus diesem Grund wurden die Hüpfer mit drei Überschaltdrosselspulen verbunden.
Diese
Spulen
befanden sich im Gehäuse des
Transformators
und wurden daher ebenfalls durch das sich darin befindliche
Trans-formatoröl
isoliert und gekühlt. Zudem waren die
Ströme über-wacht, so dass bei einseitiger
Belastung einer Drosselspule der
Hauptschalter
ausgelöst wurde.
Die Schalttabelle dieser
Hüpfersteuerung
sah vor, dass immer vier
Hüpfer
so mit den
Spulen
verbunden wurden, dass an den
Fahrmotoren
eine
Spannung
zwischen 40 und 550
Volt
entstand. Dabei waren aber bei den ersten drei
Fahrstufen
nicht alle erforderlichen Hüpfer geschaltet, so dass diese vier Stufen
schnell geschaltet werden mussten, um einseitige Belastungen der
Drosselspulen zu verhindern. Jedoch war nun die Überwachung nicht aktiv,
weil die
Ströme zu gering waren.
Wir haben damit eine Regelung der
Spannung
erhalten, die ohne Unterbruch in Stufen geschaltet werden konnte. Damit
war diese nun für die
Fahrmotoren
bereit, sie konnte jedoch nicht direkt zugeführt werden, da die
Drehrichtung der Motoren vorgängig von den
Wendeschaltern
bestimmt wurde. Dabei hatten die Wendeschalter keine neutrale Position
mehr. Die Abtrennung eines Fahrmotors erfolgte nur noch durch das
Abtrennen des
Trennhüpfers.
Unterschiede gab es auch bei der Ausführung der
Wendeschalter.
Diese wurden bei den Nummern 427 bis 450 nur dazu ausgelegt, die
Fahrrichtung zu ändern. Sie waren daher deutlich leichter, als die Modelle
bei den Nummern 401 bis 426. Der Grund waren die dort erforderlichen
Kontakte zum Umgruppieren der
Fahrmotoren
beim Einsatz der
elektrischen
Bremse, die bekanntlich bei den höheren Nummern
nicht mehr eingebaut wurde.
Die
Ansteuerung der
Wendeschalter
erfolgte elektropneumatisch. Dabei wurden immer zwei Wendeschalter zu
einer
Gruppe
zusammengefasst. Das bedeute, dass bei Ausfall eines Wendeschalters gleich
ein ganzes
Drehgestell
abgetrennt werden musste. Mit einem funktionierenden Drehgestell konnte
sich die
Lokomotive
noch selber fortbewegen und so die Werkstatt erreichen. Zu berücksichtigen
waren dabei jedoch die zulässigen
Anhängelasten.
Unterschiede bei der Ausführung führten jedoch dazu, dass die Maschinen je nach Nummer unterschiedliche Kenndaten besassen.
Wir
müssen daher die beiden Serien innerhalb dieser Baureihe separat
betrachten und diesmal beginne ich mit den tieferen Betriebsnummern. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426 ver-wendete man achtpolige Motoren, wie sie zuvor schon bei vielen Baureihen verwendet wurden. Diese konnten zu-sammen eine maximale Anfahrzugkraft von 140 kN erzeu-gen.
Die
Leistungsgrenze
wurde bei 82.5 km/h erreicht und die
Leistung
lag nun bei 2 450 PS oder 1 860 kW. Die nun verfügbare
Zugkraft
betrug immer noch 80 kN, so dass letztlich auch bei
Höchstgeschwindigkeit
noch eine ak-zeptable Zugkraft bereitstand.
Diese
Leistung
führte bei diesen
Lokomotiven
zu einem sensationellen Verhältnis von Gewicht und Kraft. Die dabei
erreichten 3 kg/PS waren bisher in der Schweiz noch nie verwirklicht
worden. Damit waren die Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 jedoch mit
sehr knapp bemessenen
Fahrmotoren
ausgerüstet worden. Das war jedoch ein Nachteil, den man in Kauf nehmen
musste, damit trotz der geringen
Achslast
eine hohe Leistung erreicht werden konnte.
Dieser Umstand führte bei den
Lokomotiven
mit den Nummern 427 bis 450 dazu, dass andere
Fahrmotoren
eingebaut wurden. Diese hatten zwölf Pole und waren etwas robuster gebaut
worden. Ihre Drehzahl war etwas tiefer, so dass diese Maschinen bei den
Zugkräften
im gleichen Rahmen, wie das bei den anderen Lokomotiven der Fall war,
lagen. Einzig die
Leistungsgrenze
wurde mit 83 km/h etwas höher angesetzt. Daher galten für diese Modelle
auch die gleichen
Normallasten.
Die schwereren
Fahrmotoren
der Nummern 427 bis 450 führte jedoch dazu, dass man dort wegen den
Achslasten
auf den Einbau einer
elektrischen
Bremse verzichten musste. Diese als
Nutzstrombremse
ausgeführte Einrichtung, war daher nur bei den Nummern 401 bis 426
vorhanden. Es kam dabei die bei der Baureihe
Ae 4/6
erfolgreich umgesetzte Schaltung mit Erregermotor zur Anwendung. Der
Vorteil dieser Schaltung lag bei der etwas höheren
Leistung
der elektrischen Bremse.
Trotzdem mussten bei der Baureihe Re 4/4 wegen dem geringen
Gewicht einige Einschränkungen berücksichtigt werden, so dass die
elektrische
Bremse nicht als stark wirkend eingestuft werden
durfte. Trotzdem konnte die
Lokomotive
mit dieser
Bremse
in den geforderten Gefällen ohne Probleme in der Beharrung gehalten
werden. Für Verzögerungen auch auf flacheren Abschnitten war die
Leistung
jedoch zu gering ausgefallen.
Bei dieser Schaltung diente der von einem Erregertransformator
gespeiste
Fahrmotor
eins als Erreger und versorgte im elektrischen Bremsbetrieb die drei
anderen parallel geschalteten Fahrmotoren mit der notwendigen
Erregerspannung. Damit konnten diese drei Fahrmotoren Energie in Form von
Wechselstrom
erzeugen. Fiel einer der Fahrmotoren wegen einem Defekt aus, konnte die
elektrische
Bremse nicht mehr verwendet werden.
Die so als
Generatoren
arbeitenden drei
Fahrmotoren
wurden über die
Hüpfer
mit dem
Transformator
und der Bremsdrosselspule verbunden. Sie arbeiteten daher auf die
Fahrleitung
und speisten so die Energie in den
Fahrdraht.
Zur Regelung der
Bremsströme
konnte die
elektrische
Bremse mit Hilfe der Hüpfer in acht Stufen
geschaltet werden. Nachteilig war jedoch, dass damit auch einen grossen
Anteil an Blindleistung ins Netz übertragen wurde.
Es
bleibt noch zu erwähnen, dass die
Nutzstrombremsen
der Reihe Re 4/4 zwar besser wirkten, als die Lösungen nach
Behn-Eschenburg bei der Reihen
Ae 8/14
und
Be 6/8 II, jedoch die
Werte der
roten Pfeile mit den
Widerstandsbremsen
nicht mehr erreicht wurden. Vorteilhaft war bei der Nutzstrombremse das
Gewicht, das deutlich unter einer Widerstandsbremse lag. Jedoch kaufte man
sich dieses mit der geringeren
Leistung,
die aber durchaus höher hätte sein können.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Verwendet
wurden
Verwendet
wurden  Um
den
Um
den
 Wir
sind nun beim
Wir
sind nun beim  Nach
dem
Nach
dem
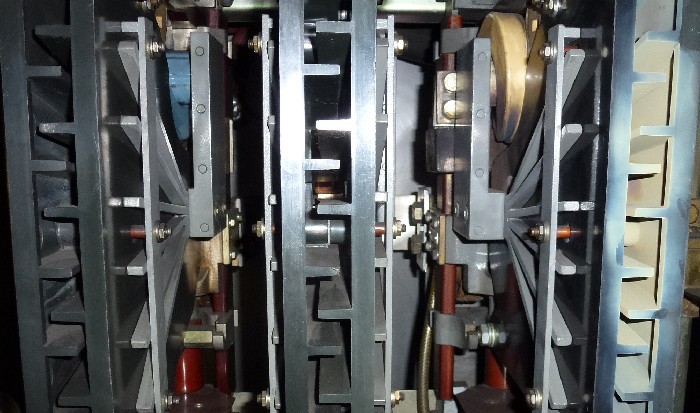 Diese
zwölf
Diese
zwölf
 Es
wurden unterschiedliche
Es
wurden unterschiedliche