|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Es
gab im System für die
Druckluft
zwischen den
Lokomotiven
der Baureihe Re 4/4 leichte Unterschiede. So wurden bei den Maschinen mit
den Nummern 427 bis 450 nicht benötigte Leitungen entfernt. Jedoch
bewirkten diese Anpassungen im Leitungssystem der Lokomotive keine grossen
Veränderungen. Daher lohnt sich ein genauer Blick auf dieses System, das
jedoch nur funktionierte, wenn Druckluft vorhanden war.
Dabei verdichte dieses Modell in
Zylindern
die Luft und entliess sie nachher in die angeschlossenen Leitungen. Dort
verflüchtigte sich der Druck, wegen dem grösseren Volumen, jedoch wieder.
Da der Druckabfall dafür sorgte, dass die verdichtete Luft Feuchtigkeit ausschied, musste diese aus den Leitungen entfernt werden. Daher leitete man die Luft nun an einem Wasserabscheider vorbei.
Dort
benetzte die Feuchtigkeit Bleche, womit das Wasser, wie auch enthaltene
Schmiermittel,
in den darunter mon-tierten Behälter floss. Dort konnte die Emulsion beim
Un-terhalt in einer Werkstatt abgelassen und anschliessend entsorgt
werden.
Einen Schutz bot das in der Leitung vom
Kompressor
eingebaute
Überdruckventil.
Dieses öffnete sich, wenn der Druck im Leitungssystem auf einen Wert von
mehr als zehn
bar
anstieg. Fiel dieser wieder unter diesen Druck, schloss das
Ventil
wieder. Speziell war, dass wegen dem in der Leitung eingebauten
Rückschlagventil nur die Leitung vom Kompressor betroffen war. Bei den
Maschinen 401 bis 426 hätte daher in den Leitungen theoretisch ein höherer
Druck vorhanden sein können.
Gespeichert wurde die
Druckluft
vom
Kompressor
in den zwischen den beiden
Drehgestellen
montierten
Hauptluftbehältern.
Diese bildeten einen Speicher, so dass der
Kolbenkompressor
nicht dauernd arbeiten musste. Jedoch waren diese Behälter auch dazu
vorgesehen, dass die Druckluft bei abgestellter
Lokomotive
gespeichert werden konnte. Damit das funktionierte, mussten
Absperrhähne
in den beidseitigen Leitungen montiert werden.
Bei
den jüngeren Maschinen mit den Betriebsnummern 427 bis 450 befanden sie
sich jedoch wieder, wie bei den älteren Bau-reihen, aussen unter dem
Kasten im Bereich der
Hauptluftbe-hälter.
Auf die Funktion hatte das jedoch nur eine unterge-ordnete Auswirkung. Das Luftgerüst der Baureihe Re 4/4 war eine Neuerung, die bei der Maschine der Reihe Ae 4/6 eingeführt wurde und weiterver-folgt werden sollte.
Sämtliche nicht an einen bestimmten Ort
gebundenen Bauteile der
Druckluft
wurden an diesem Gerüst montiert. Bei Störungen des pneumatischen Systems
musste das
Lokomotivpersonal
nur noch dieses Gerüst kontrollieren. Absperrungen und Abtrenn-ungen waren
anhand der Stellung der Bedienhebel schnell zu finden. Die von den Hauptluftbehältern entnommene Leitung wurde als Speiseleitung bezeichnet. Ihr Druck schwankte zwischen acht und zehn bar. Angeschlossen wurden hier Verbraucher, die nicht an einem bestimmten Druck gebunden waren.
Neben den
Bremsen
und der
Sandstreueinrichtungen,
waren diese Baugruppen der
Hauptschalter
und die
Pfeife
der
Lokomotive. Letztere klang daher je nach
Luftdruck
in den Leitungen etwas anders. Wobei das Klangbild der Schweiz vom
Lokführer erzeugt wurde.
Bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426
wurde die
Speiseleitung
auch zu den beiden
Stossbalken
geführt und dienten so der Versorgung des
Steuerwagens.
Wobei diese bei den Maschinen, die ohne die Einrichtung zur
Vielfachsteuerung
ausgeliefert wurden, anfänglich noch nicht vorhanden war. Daher wurde die
Leitung damals wirklich nur bei den Baureihen benötigt wurden, die
vielfachgesteuert werden konnten.
So sollte verhindert werden, dass diese
Leitung mit jener der
Bremsen
verwechselt wurde. Eine
Verbind-ung
wurde jedoch durch die unterschiedlichen
Kupp-lungen
verhindert. Fehlte bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426 die Druckluft, konnte der Vorrat, sofern eine pas-sende Maschine vorhanden war, über die Speiseleitung ergänzt werden.
Wichtig war dies, weil ohne
Druckluft
der
Stromab-nehmer
nicht gehoben werden konnte. Bei den Mo-dellen mit den Betriebsnummern 427
bis 450 blieb je-doch nur noch die unbeliebte
Handluftpumpe
übrig. Diese Pumpe werden wir später noch genauer an-sehen. Über ein einfaches Reduzierventil wurde die Appara-teleitung an der Speiseleitung angeschlossen. Diese Leitung arbeitete mit einem Druck von sechs bar, der zudem stabil gehalten wurde.
Angeschlossen wurden hier einige mit
Druckluft
be-triebene Bauteile der elektrischen Ausrüstung. Dazu gehörten auch die
beiden auf dem Dach montierten
Stromabnehmer.
Daher wurde für den Hebevorgang derselben, Druckluft von sechs
bar
benötigt.
Mit dieser konnte von Hand ein
Stromabnehmer
gehoben werden. Ein Rückschlagventil verhinderte, dass in diesem Fall die
komplette Leitung gefüllt werden musste.
Zu
den wichtigsten Verbrauchern der
Druckluft
gehörten jedoch die pneumatischen
Bremsen.
Von diesen gab es auf den
Lokomotiven
dieser Baureihe nicht weniger als drei unterschiedliche Varianten. Dabei
war die
Schleuderbremse
noch sehr einfach aufgebaut, denn sie versorgte die
Bremszylinder
lediglich mit einem Druck von 0.8
bar.
Mehr war da nicht mehr, denn dazu waren die beiden anderen
Bremssysteme
vorhanden.
Bei
den vollwertigen
Bremssystemen
der
Lokomotive gab es eigentlich keine grossen
Überraschungen. Das galt insbesondere für die auf allen Maschinen
vorhandene
Regulierbremse.
Diese
direkte Bremse
nach
Westing-house
arbeitete mit einem Druck von maximal 3.5
bar
und sie wurde zu den
Stossbalken
geführt. Dort hatte die Regulierbremse ebenfalls zwei Schläuche, die
spezielle
Schlauchkupplungen
mit Rückschlagventilen besassen, erhalten.
Dank den an den
Stossbalken
angebrachten Luftleitungen der
Regulierbremse
konnten auch angehängte
Reisezugwagen
abgebremst werden. Diese
Bremse
konnte jedoch auch, als von den Wagen unabhängige Bremse verwendet werden.
War der Zug jedoch damit ausgerüstet, konnte die Regulierbremse auch als
Betriebsbremse bei Fahrten in langen Gefällen verwendet werden. Jedoch war
bei diesem
Bremssystem
keine Sicherheitsfunktion vorhanden.
Die
Bremse
mit der Sicherheitsfunktion funktionierte mit einer als
Hauptleitung
bezeichneten Leitung und wurde als
automatische Bremse
bezeichnet. Diese Leitung wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt und stand dort in jeweils zwei Schläuchen zur Verfügung. Zur
Kennzeichnung der Hauptleitung wurden die
Absperrhähne
und die
Kupplungen
mit roter Farbe gekennzeichnet. Umgekehrte Kupplung verhindern zudem das
Risiko der Verwechslung mit der
Speiseleitung.
Eine Entleerung der Leitung war durch die Sicherheitssysteme, das Brems-ventil und die Hauptleitung immer möglich. Jedoch konnte die Leitung nur durch das aktive Führerbrems-ventil gefüllt werden.
Die
Bedienung dieser Leitung wird in einem anderen Kapitel vorgestellt
wer-den. Damit mit der automatischen Bremse eine Bremsung eingeleitet werden konnte, musste auf der Lokomotive ein spezielles Steuerventil verwendet werden.
Dabei kam hier jedoch nicht das auf der Baureihe
Ae 4/6 sehr
erfolgreich eingeführte
Lst 1
zu Anwendung. Vielmehr verwendete man bei der Reihe Re 4/4 zur Reduktion
der Ersatzteile ein
Steuerventil
das von den
Leichtstahlwagen
übernommen wurde. Es war daher ein Wagensteuerventil, das hier eingesetzt
wurde.
Der Vorteil dieses
Steuerventils
war die Tatsache, dass es alle erforderlichen Drücke der neuen
Hochleistungsbremse erzeugen konnte. Nachteilig war, dass mit diesen
Steuerventilen jedoch nicht alle Versionen erzeugt werden konnten. So
besass die
Lokomotive der Baureihe Re 4/4 keine
Güterzugsbremse.
Mit fehlender
G-Bremse
und dem Wagensteuerventil, mutierte die neue Maschine jedoch vermeintlich
zu einer halbherzigen Lokomotive.
Obwohl das
Steuerventil
von den
Leichtstahlwagen
übernommen wurde, waren bei den jeweiligen
Bremsen
auf der
Lokomotive andere Drücke vorhanden. Bei
der üblichen
P-Bremse
bedeutete dies, dass maximal 3.6
bar
in die
Bremszylinder
geleitet wurden. Dieser Druck in den Bremszylindern reichte jedoch nur im
unteren Bereich der Geschwindigkeiten für eine ausreichende Bremsung mit
der Lokomotive dieser
Bauart.
Fuhr die
Lokomotive schneller, aktivierte sich ab
60 km/h die
R-Bremse.
Diese
Bremse
erhöhte den Druck in den
Bremszylindern
auf 6.8
bar.
Da der Druck jedoch höher als jener der
Hauptleitung
war, musste das
Steuerventil
wegen der R-Bremse auch an die
Speiseleitung
angeschlossen werden. Unter 50 km/h wurde die R-Bremse automatisch
deaktiviert und es wirkte wieder die übliche
Personenzugsbremse.
Diese Bremse entsprach daher jener der Baureihe
Ae 4/6.
Speziell war die Situation nur, wenn die
Lokomotive geschleppt verkehrte. Die nun
als Wagen funktionierende Maschine konnte für die
R-Bremse
nicht mehr genug Druck erzeugen, da nur die
Hauptleitung
zur Verfügung stand. Aus diesem Grund durfte in diesem Fall nur die
übliche
Personenzugsbremse
angerechnet werden. Das war klar ein Unterschied zu den
Leichtstahlwagen,
wo die R-Bremse lediglich die Hauptleitung benötigte.
So konnten Bremsungen der
Regulierbremse
ohne grosse Probleme mit der
automatischen Bremse
über-lagert werden. Ein wichtiger Punkt, wenn der Zug im Gefälle verzögert
werden musste, denn dann kam die automatische Bremse zur Anwendung. Der Bremszylinder wurde daher mit Hilfe der Druckluft in Bewegung versetzt und besass eine Feder, die den Kolben bei Wegfall der Druckluft wieder in den gelösten Anschlag verbrachte.
Die Rückholfeder darf jedoch nicht mit den
heute üb-lichen
Federspeicherbremsen
verwechselt werden. Das Prinzip mit der Rückholfeder wurde damals bei
sämtlichen eingesetzten Fahrzeugen der Schweiz-erischen Bundesbahnen SBB
angewendet.
Am
Bremszylinder
in jedem
Drehgestell
war ein damals übliches
Bremsgestänge
angeschlossen worden. Dieses Gestänge besass zur Korrektur an die
Abnützung der
Bremsklötze,
einen automatischen
Gestängesteller
der
Bauart
Stopex. Damit war eine automatische Anpassung vorhanden, so dass die
Lokomotive immer über die gleiche
Bremswirkung verfügte. Ein Punkt, der bei den hohen Geschwindigkeiten
wichtig war.
Jedes
Rad
wurde von beiden Seiten mit jeweils zwei
Bremsklötzen,
die direkt auf die
Lauffläche
wirkten, abgebremst. Die Bremsklötze dieser
Klotzbremse
waren als
Bremssohlen ausgeführt worden. Sie wurden jeweils zu zweit in
einem speziellen
Sohlenhalter
befestigt. Dieser Sohlenhalter war letztlich mit dem
Bremsgestänge
und dem
Bremszylinder
verbunden. Auf die Funktion hatte das keinen Einfluss, jedoch konnte die
Wartung vereinfacht werden.
Mit der Personenzugsbremse konnte im Bremszylinder ein maximaler Druck von 3.6 bar erzeugt werden. Das bewirkte bei maximalem Druck ein Bremsgewicht von 46 Tonnen. Bei der Bremsrechnung wurde daher bei Anwendung der P-Bremse bereits ein Bremsverhältnis von 80% erreicht.
Im Vergleich zu den anderen Baureihen hatte
die Baureihe Re 4/4 damit bereits sehr gute
Bremsen
erhalten. Lediglich die Reihe
Ae 4/6 hatte mit der
R-Bremse
einen besseren Wert. Für die R-Bremse stieg der Druck im Bremszylinder auf einen Wert von 6.8 bar an. Damit veränderte sich das Bremsgewicht der Lokomotive deutlich. In diesem Fall wurde ein Gewicht von 73 Tonnen angegeben.
Bei einem Gewicht der Maschine von bis zu 58
Tonnen wurde ein
Bremsverhältnis
von 125% erreicht. Bei diesen hohen
Bremskräften
konnten lediglich noch die
Personenwagen
mithalten, womit die
Lokomotive ideal für schnelle
Reisezüge
war. Einen Nachteil hatte das so aufgebaute Bremssystem jedoch. Die mechanischen Bremsen wirkten nur, wenn der Bremszylinder mit Druckluft versorgt wurde. Fehlte diese Luft auf der Lokomotive, lösten sich die Bremsen wieder.
Damit war keine ausreichende
Sicherung der
abgestellten Maschine mehr möglich. Aus diesem Grund musste eine von der
Druckluft unabhängige
Bremse auf der
Lokomotive eingebaut werden.
Direkt auf das
Bremsgestänge des benachbarten
Drehgestells wirkte die im darüber angeordneten
Führerstand montierte
Handbremse. Durch diese Spindelbremse konnte mit einer einfachen Kurbel
das Gestänge so verändert werden, dass die
Bremssohlen gegen die
Lauffläche gedrückt wurden. Eine Arretierung verhinderte, dass sich diese
Handbremse ohne fremde Hilfe lösen konnte. Daher war sie zur
Sicherung der
Lokomotive geeignet.
Das
Bremsgewicht dieser
Handbremse wurde mit 20
Tonnen angegeben. Das reichte für ein Verhältnis von 35%. Da jedoch in
jedem
Führerstand eine solche
Feststellbremse vorhanden war, konnten die Werte
zweimal gerechnet werden. So konnten auf der Maschine der Reihe Re 4/4
maximal 40 Tonnen mit allen
Bremsklötzen erreicht werden. Mit einem
Verhältnis von 70% konnte daher die
Lokomotive überall auf dem Netz
abgestellt werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Erzeugt
wurde die
Erzeugt
wurde die  Die
Position der
Die
Position der 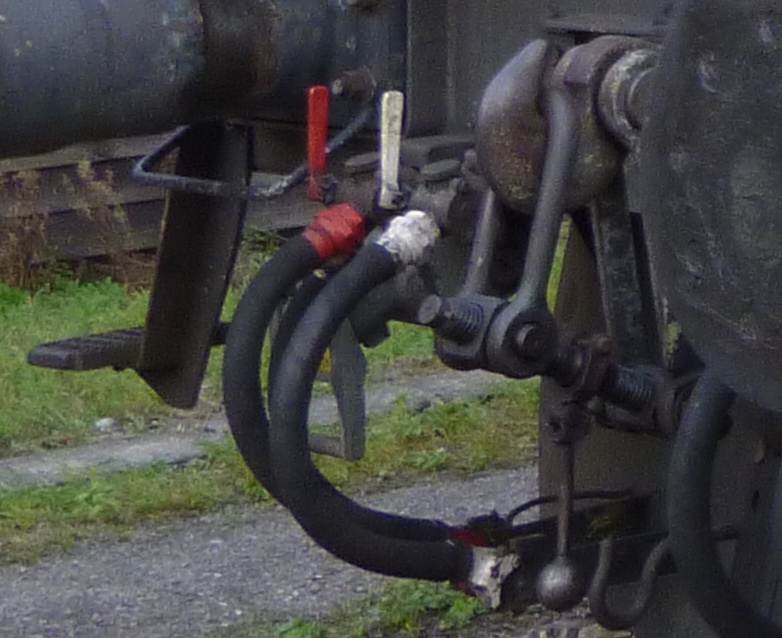 Am
Am

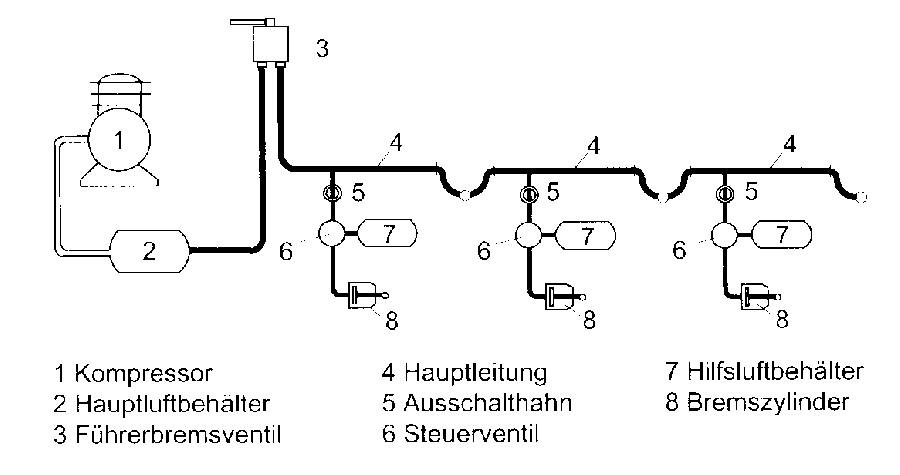 Gefüllt
mit dem Regeldruck von fünf
Gefüllt
mit dem Regeldruck von fünf
 Sämtliche
pneumatischen
Sämtliche
pneumatischen
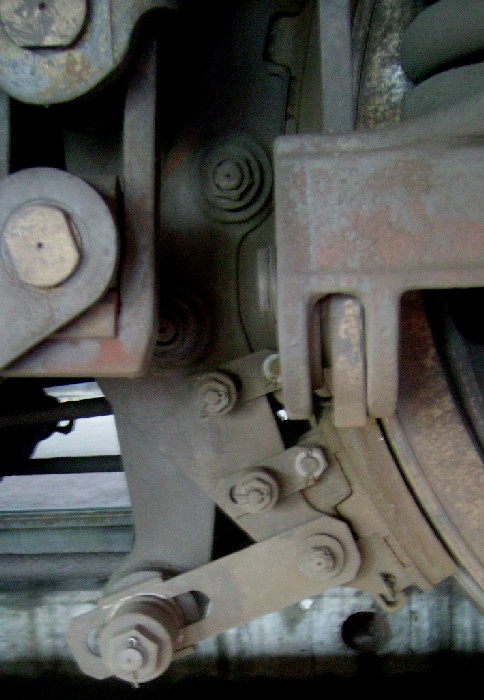 Die
von den
Die
von den