|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Kommen wir zur Bedienung der
Lokomotive.
Wie schon bei anderen Baureihen, gehen wir hier davon aus, dass das
Triebfahrzeug
neu aufgebaut wurde und betriebsbereit übergeben wurde. Es ist daher eine
normale erste Inbetriebnahme, wie sie im Betrieb vor dem ersten Zug des
Tages durchgeführt wurde. Der Lokführer trifft daher auf die remisierte
Lokomotive und hatte den Auftrag, diese zu übernehmen und eine Fahrt
durchzuführen.
Bei den anderen Nummern musste dazu zuerst der Weg in die
Lokomotive
gefunden werden. Dieser erfolgte über die Leiter und eine der seitlichen
Türen. Es folgten weitere Kontrollen im Maschinenraum. Hier befanden sich bei den Nummern 401 bis 426 auch die Hähne zu den Hauptluftbehältern. Jedoch wurden hier im Unterschied zu den anderen Modellen erste Funktionen geschaltet.
Der Grund lag bei der
Vielfachsteuerung,
die bei den erst-en sechs Exemplaren eingebaut wurde und die einige
we-nige Funktionen auf jedem Fahrzeug benötigte. Für die weitere
Inbetriebnahme blenden wir diese Einrichtung aus. Die weitere Bedienung erfolgte ab einem der beiden Führerstände. Welcher das effektiv war, spielte für die Maschine eigentlich keine Rolle.
Lediglich bei der Prüfung der
Zugsicherung,
musste etwas mehr Weg zurückgelegt werden. Letztlich wurde jedoch die
Lokomotive
dort aufgerüstet, wo die Fahrt begonnen werden durfte. Es war nicht
erlaubt, mit der Maschine rückwärts zu fahren. Das galt jedoch nicht nur
für diese Baureihe.
Die Bedienung der Maschine erfolgte bei den Nummern 401 bis 416
stehend. Eine einfache Sitzgelegenheit war zwar vorhanden, sie durfte auf
der Fahrt jedoch nicht benutzt werden. Die restlichen Maschinen der Reihe
Re 4/4 bekamen jedoch eine Sitzgelegenheit. Eine einheitliche Lösung gab
es dabei jedoch nicht, so dass wir etwas genauer darauf blicken müssen. So
wurde ab der Nummer 417 eine wahlweise Lösung verwendet.
Die nicht benötigte Sitzgelegen-heit wurde einfach hochge-klappt. Das war wegen dem Durchgang für die Reisenden wichtig, weil deren Weg durch einen Stuhl versperrt worden wäre.
Diesen gab es jedoch bei den Nummern 427 bis 450 nicht mehr,
trotzdem gab es dort die gleiche Sitzgelegenheit. Folgen hatte diese Änderung auch auf den Führertisch. Damit die Bedienung auch im Sitzen möglich war, wurde das Führ-erpult leicht geneigt ausgeführt. Bei der Position der einzelnen Bedienelemente gab es zwi-schen den Lokomotiven jedoch keine Unterschiede und so kön-nen wir uns auf eine Lokomo-tive beschränken.
Diese stammt aus den ersten sechs Maschinen, da wir so auch die
elektrische
Bremse und die nur hier vorhandene
Vielfachsteuerung
haben.
Der
Führertisch
mit den Bedienelementen wurde im
Führerstand
auf der linken Seite montiert. Bereits bei der Baureihe
Ae 4/6
war diese Anordnung verwendet worden. Durch die linke Bedienung waren die
Signale, die ebenfalls links standen, für den Lokführer besser zu
erkennen. Das war besonders beim einmännigen Betrieb ein grosser Vorteil
für das Personal, so dass die Erfahrungen mit den
Ae 4/6
so gut waren, dass während Jahrzehnten keine Umstellung mehr erfolgte.
Auch wenn bei den Modellen mit den Nummern 427 bis 450 mehr Platz
vorhanden gewesen wäre, wählte man bei allen Maschinen das gleiche Pult.
Das war eine Massnahme, die es dem Personal ermöglichte, auf allen
Modellen zu fahren. Die Schulung musste daher nur auf einer
Lokomotive
durchgeführt werden und die Unterschiede wurden erwähnt. Bei der Bedienung
selber gab es daher nur die technischen Unterschiede.
Jedoch gab es immer wieder die Sit-uation, dass ein Heizer mitgeführt wurde, oder der Vorgesetzte eine Be-gleitfahrt machte.
Auch er durfte sitzen und hatte die gleiche Sitzgelegenheit
bekommen, wie wir sie schon beim Lokführer kennen gelernt hatten. Selbst
der Grund war identisch. Vor dem Beimann wurde ein iden-tisches Pult aufgebaut. Es war bei allen Maschinen flach und es befanden sich kaum Bedienelemente darauf. Markant war dabei die Handbremse, die mittig auf diesem Pult montiert wurde.
Die Kurbel war mit einer Lochscheibe versehen worden. Mit dieser
konnte mit einem Stift verhindert werden, dass sich die
Handbremse
ungewollt löste. Vorerst belassen wir diese, da sie der
Sicherung
diente, in diesem Zustand.
Um
die
Lokomotive
in Betrieb zu nehmen, begeben wir uns wieder an den Platz des Lokführers.
Dieser fand vor sich die benötigten Bedienelement. Dabei stach als erstes
das
Handrad
des
Steuerkontrollers
in die Augen. Dieses werden wir später noch benötigen, denn zuerst muss
die Maschine ja noch eingeschaltet werden und dazu musste man sich den
Steuerschaltern
zuwenden. Diese befanden sich unmittelbar oberhalb des Handrades.
Die benötigten
Steuerschalter
wurden in einem schwarz eingefärbten Kasten angeordnet. Dieser Kasten war
so ausgelegt worden, dass die Schalter nur bewegt werden konnten, wenn
deren Wege frei gegeben wurden. Daher wurde hier von einem
Verriegelungskasten gesprochen. Dank der Verriegelung wurde verhindert,
dass die Schalter von unbefugten Personen bewegt werden konnten. Zudem war
der besetzte
Führerstand
schnell erkennbar.
Bei der
Zugsheizung
war das Blech mit den definierten Posi-tionsangaben gelb ausgeführt
worden. Die Lösung erlaubte es dem
Lokomotivpersonal
den
Hauptschalter
auch bei Dunkelheit nur durch ertasten zu bedienen.
Dabei befand sich ganz rechts aussen der mit einem Symbol einer
Batterie
versehene
Steuerschalter
zur Steuerung. Er musste in jedem Fall eingeschaltet werden, denn ohne
diesen Steuer-schalter konnten die weiteren Funktionen im
Verriegelungskasten gar nicht genutzt werden. Das galt natürlich auch,
wenn der Schlüssel für die Verriegelung nicht vorhanden war. Dieser musste
schliesslich beim Wechsel des
Führerstandes
mitgenommen werden.
Jeder
Steuerschalter
war mit den möglichen Schaltpositionen beschriftet worden. Dabei konnte
diese unterschiedlich sein, weil einige Schalter mehrere Funktionen
kannten. So konnte zum Beispiel der
Hauptschalter
nur ein- oder ausgeschaltet werden. Beim
Kompressor
gab es dazu aber auch noch die automatische Regelung mit dem
Druckschwankungsschalter.
Daher gab es dort drei Stellungen. In der Mitte waren alle Funktionen
ausgeschaltet oder neutral.
Auf die Vorstellung der einzelnen Schalter verzichte ich, da wir
bei der Bedienung diese benötigen werden. Es wird zudem Zeit, dass die
Lokomotive
eingeschaltet wird. Dazu mussten mindestens drei
Steuerschalter
bewegt werden. Diese gehörten zur Steuerung, zum
Stromabnehmer
und zum
Hauptschalter.
Dabei befanden sich diese in der genannten Reihenfolge von rechts nach
links im Verriegelungskasten. Sie mussten zudem in dieser Richtung bedient
werden.
Damit war die automatische Regelung aktiv und das Personal musste
sich eigentlich nicht mehr weiter um den Luftvorrat kümmern. Nur, wenn
manuell
Druckluft
ergänzt werden sollte, verbrachte man den
Steuerschalter
auf die Stellung «1». Ob die Lokomotive erfolgreich eingeschaltet wurde, be-merkte das Personal am laufenden Kompressor und an den Anzeigen, die oberhalb des Verriegelungskastens ange-bracht wurden.
Dort war am
Instrument
die
Fahrleitungsspannung
abzu-lesen. Obwohl dies so genannt wurde, wurde eigentlich nur die
Spannung
der
Hilfsbetriebe
gemessen. Neben die-sen Instrumenten befanden sich die
Manometer
für die
Druckluft.
Die
Manometer
wurden beim nächsten Schritt wichtig, denn dort wurde mit einem kleinen
roten Zeiger der Vorrat angezeigt. Wenn der
Kompressor
arbeitete stieg dieser Druck an. Es war der einzige Druck in der Anzeige,
der nicht mit den eingebauten
Bremsen
zu tun hatte. Diese waren so wichtig, dass diese nach der Inbetriebnahme
geprüft werden mussten. Ein Vorgang, den wir daher jetzt ebenfalls machen
müssen.
Die
Ventile
zur Bedienung der
Bremsen
befanden sich auf der linken Seite am Rand des
Führerpultes.
Etwas weiter vom Lokführer entfernt war das
Handrad
zum
Bremsventil
W2 von
Westinghouse
gut zu erkennen. Wurde dieses gegen den Uhrzeigersinn verdreht, schlug der
Zeit beim Symbol für den
Bremszylinder
aus. Damit war die Rückmeldung dieser
direkten Bremse
vorhanden. Die weiteren
Achsen
wurden nicht kontrolliert.
Gelöst wurde diese
Bremse
in der Gegenrichtung. Der Zeiger bewegte sich gegen null und die Klötze
lagen nicht mehr auf. Damit war die
Regulierbremse
geprüft und die Kontrolle der
automatischen Bremse
konnte erfolgen. Dazu musste jedoch die
Hauptleitung
ausreichend gefüllt sein. Das konnte vom Lokführer am dritten
Manometer
abgelesen werden. Dort wurde mit einem schwarzen Zeiger der Druck in der
Hauptleitung angezeigt.
Damit sank der Druck in der
Hauptleitung
und wenn dieser einen Druck von 4.6
bar
erreicht hatte, wurde der Hebel auf die
Abschlussstellung
gestellt. Im
Bremszylinder
musste nun ein Druck vorhanden sein. War dies nicht der Fall, musste die
Prüfung wiederholt werden.
Dazu wurde der Hebel entweder in die Stellung «Fahren» verbracht,
oder mit der Stellung «Füllen» ein Füllstoss ausgeführt. Im letzten Fall
war jedoch keine Druckbegrenzung vorhanden, so dass diese Stellung bei
einem Druck in der
Hauptleitung
von fünf
bar
abgebrochen werden musste. In der Stellung «Fahren» blieb der Druck jedoch
permanent erhalten und Verluste in der Hauptleitung wurden nachgespeist.
Wenn die Prüfungen der pneumatischen Bremsen erfolgreich abgeschlossen wurden, konnte die Lokomotive mit der Regulierbremse gesichert werden. Dazu musste vom Bremszylinder jedoch keine sehr grosse Bremskraft aufbauen.
Erst jetzt wurde die
Handbremse
gelöst. Dazu wurde der Stift herausgezogen und die Kurbel gedreht. Erst
wenn sich diese am gelösten Anschlag befand, war die
Feststellbremse
als gelöst zu betrachten. Damit war die Maschine soweit fahrbereit und die
Beleuchtung
konnte richtiggestellt werden.
Mit dem
Steuerschalter,
der ganz links montiert wurde, konnte die
Beleuchtung
mit der Stellung «1» eingeschaltet werden. Die Stellung in der Mitte, war
mit einem Punkt markiert worden und definierte keinen Schaltzustand. Damit
wurde auch die an der Decke des
Führerstandes
montierte Ausleuchtung der
Instrumente
versorgt und an der
Lokomotive
gab es Licht. Jedoch konnten so noch keine
Signalbilder
erstellt werden.
Die
einzelnen Lampen der
Stirnbeleuchtung
konnten mit an der Seitenwand montierten Schaltern eingestellt werden.
Stand dieser Schalter senkrecht, brannte die Lampe. Wobei die Markierung
nach oben zeigen musste. Der obere Schalter konnte um 180 Grad verdreht
werden. Damit leuchtete nicht mehr die weisse, sondern die obere rote
Lampe. Welche Lampe wie beleuchtet werden musste, oblag dem
Lokomotivpersonal,
welches die Bilder kannte.
Wenn wir schon bei diesem an der seitlichen Wand montierten Panel sind,
behandeln wir kurz die anderen vorhandenen Schalter. Mit diesen konnten
die diversen
Heizungen
geschaltet werden. Jedoch befanden sich hier auch ein Schalter für die
Beleuchtung
der
Instrumente
und jener Schalter, der schon betätigt wurde, als die Arbeit begann. Das
war die Beleuchtung des
Führerstandes,
die der Lokführer daher von seinem Platz aus bedienen konnte.
Um
die Fahrt zu beginnen, musste zuerst die Fahrrichtung bestimmt werden.
Dazu war unter dem
Handrad
ein Griff mit Pfeilen vorhanden. Dieser stand im Stillstand in der Mitte
und wurde vor Beginn der Fahrt in die gewünschte Richtung verschoben
werden. Die
Wendeschalter
wurden damit so gruppiert, dass die
Fahrmotoren
in der gewünschten Richtung drehten. Jedoch wurde bei keiner Maschine mit
diesem Griff die
elektrische
Bremse aktiviert.
Damit wurde die
Bremse
gelöst und gleichzeitig
Zugkraft
aufgebaut. Die alleine verkehrende
Loko-motive
rollte im ebenen Gelände bereits los. Um die Zugkraft zu erhöhen, wurden
einfach zusätzliche
Fahrstufen
geschaltet. Anhand der Skala konnte der Lokführer erkennen, welche Fahrstufe er eingestellt hatte. Die damit er-zeugten Fahrmotorströme wurden ihm an den Instrumenten angezeigt.
Welche Werte er einstellen durfte, konnte der Lok-führer an einer Tabelle,
die auf den
Führerpult
mon-tiert wurde, ablesen. Wurde die dort vorgegebenen Werte überschritten,
konnte es Schäden an den
Fahrmotoren
geben. Dabei reagierte die Steuerung jedoch nicht immer. Speziell war, dass die ersten vier Stufen wegen der Belastung der Drosselspulen schnell geschaltet wer-den mussten. Dank der direkten Hüpfersteuerung war das auch möglich.
Wobei bei Fahrten mit der
Lokomotive
alleine im
Rangierdienst
dies schlicht nicht möglich war. Je-doch waren dort die Belastungen nicht
so gross, dass es zu Schäden kommen konnte. Jedoch bei den schweren
Anfahrten, musste der Lokführer darauf achten.
Die
gefahrene Geschwindigkeit konnte der Lokführer an einem
Geschwindigkeitsmesser
ablesen. Dieser wurde auf dem
Führertisch
bei der rechten Ecke montiert und er war elektrisch angetrieben worden.
Damit war diese Anzeige identisch zu den anderen Baureihen platziert
worden und auch hier gab es je nach
Führerstand
unterschiedliche Modelle. Eine Massnahme, die wegen den Reklamationen bei
der Baureihe
Ae 4/6
so gewählt wurde.
Der Streifen wickelte
sich dabei von einer Rolle ab und eine Nadel ritzte die Werte ein. War der
Vorrat aufgebraucht fand keine Aufzeichnung mehr statt, daher musste eine
neue Rolle eingesetzt werden. Im Führerstand zwei kam ein Modell mit Farbscheibe zum Einbau. Diese zeichnete nur die letzten 1 800 Meter auf und wurde immer wieder neu beschriftet. Dabei konnten die Angaben jedoch auf den Meter genau ausgewertet werden. Entnommen wurde diese jedoch nur bei schweren Vorfällen, wo auch eine Meldung erstellt werden musste.
Dieser
Geschwindigkeitsmesser
hatte aber noch andere Aufgaben. Hier wurden die Kontakte eingebaut, die
von der Geschwindigkeit abhängige Funktionen schalteten. Dazu gehörte zum
Beispiel die
R-Bremse.
War die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, wurde einfach die
Zugkraft
reduziert. Damit war eine einfache Regelung der Zugkraft vorhanden. Erst
wenn das
Handrad
des
Steuerkontrollers
auf die Stellung «0» verdreht wurde, öffneten sich die
Trennhüpfer
und die
Lokomotive
rollte einfach aus. Damit war jedoch in vielen Fällen kaum eine
Verzögerung vorhanden. Um anzuhalten, musste gebremst werden. Dazu standen
die pneumatischen
Bremsen
bereit. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426 konnte zur Verzögerung die elektrische Bremse genutzt werden. Dazu wurde der Steuerkontroller einfach gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Die Wendeschalter gruppierten dann die Fahrmotoren neu und die Maschine wurde mit der elektrischen Bremse verzögert.
Jedoch konnte so nicht angehalten werden, denn im Stillstand wären
die
Fahrmotoren
beschädigt worden.
So wurde mit der pneumatischen
Bremse angehalten. Eine Schaltung verhinderte
jedoch, dass die mechanischen Bremsen der
Lokomotive
zusammen mit der
elektrischen
Bremse verwendet werden konnten. Dabei war
diese so ausgelegt worden, dass der Druck im
Bremszylinder
dafür sorgte, dass die
Trennhüpfer
zu den
Fahrmotoren
geöffnet wurden. Damit gab es mit Zügen jedoch ein kleines Problem und
einen solchen wollen wir nun mitnehmen.
Wurde nun mit einem Zug gebremst, erfolgte dies zuerst mit der
elektrischen
Bremse, reichte deren Kraft nicht aus, musste
die Wagen mit den pneumatischen
Bremsen helfen. Die Schutzeinrichtung
verhinderte dies jedoch. Damit die
Lokomotive
trotzdem weiterhin die elektrische Bremse nutzen konnte, war im
Pedal
eine Auslösung der mechanischen Bremse vorhanden. Diese wurde auch
genutzt, um die Lokomotive von einem Zug zu trennen.
Nach der Fahrt wurde die
Lokomotive
wieder remisiert und damit ausgeschaltet. Dazu wurden die vorgestellten
Handlungen einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen. Spezielle
Handlungen mussten nicht vorgenommen werden. Wie die genauen Schritte
auszuführen waren, wurde dem
Lokomotivpersonal
vermittelt. Auch die Handhabung des
Registrierstreifens
war geregelt worden und daher musste dieser am Ende des Tages entnommen
werden. Wer nun aufmerksam war, hat vermutlich bemerkt, dass ein Steuerschalter nicht bedient wurde. Das stimmt, wenn wir uns auf die Lokomotiven mit den Nummern 407 bis 450 beschränken. Dort war der Steuerschalter vorhanden, er wurde im Betrieb jedoch nicht benötigt, denn dieser Steuerschalter gehörte zu den Funktionen der Vielfachsteuerung und diese betraf nur die ersten sechs Lokomotiven und damit die Prototypen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
allen
Bei
allen
 Diese
Sitzgelegenheit war auf der Baureihe
Diese
Sitzgelegenheit war auf der Baureihe
 Im
rechten Bereich des
Im
rechten Bereich des
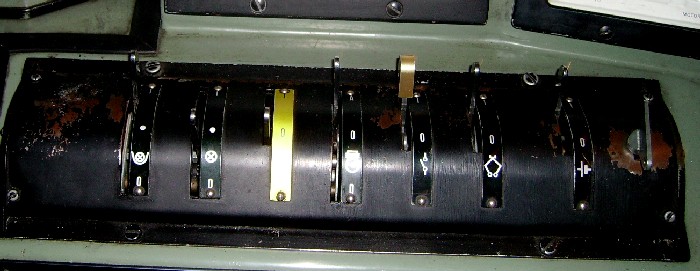 Bezeichnet
wurden die einzelnen
Bezeichnet
wurden die einzelnen
 Da
viele
Da
viele
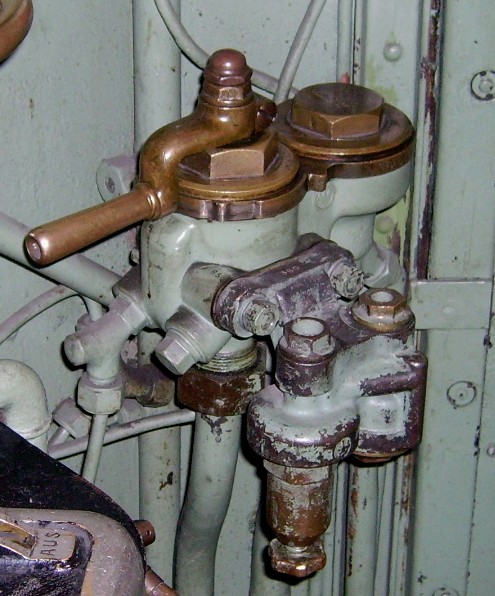 Eine
Bremsung mit dieser
Eine
Bremsung mit dieser
 Die
Fahrt begonnen wurde mit zwei parallel ausge-führten Handlungen. Während
mit der linken Hand die
Die
Fahrt begonnen wurde mit zwei parallel ausge-führten Handlungen. Während
mit der linken Hand die

 Wurde
ein
Wurde
ein