|
Bedienung der Vielfachsteuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Zu den im Kapitel «Bedienung der Lokomotive» beschriebenen
Arbeiten und Handlungen gab es bei den mit
Vielfachsteuerung
ausgerüsteten Maschinen mit den Nummern 401 bis 406 zusätzlich Arbeiten
auszuführen. Diese waren jedoch nur nötig, wenn die Einrichtung auch
genutzt wurde. Ohne Vielfachsteuerung waren die Maschinen auf die normale
Weise zu bedienen und lediglich die zusätzlichen Einrichtungen waren
vorhanden.
Dazu werden wir die vorher in Betrieb genommene
Lokomotive
nun zusammen mit einem
Steuerwagen
und einigen Zwischenwagen zu einem
Pendelzug
formieren. Wo es bei der Kombination zweier Maschinen Unterschiede zu
beachten gab, werden diese natürlich erwähnt werden. Wobei es für die
ferngesteuerte Lokomotive zwischen den beiden Möglichkeiten keinen
Unterschied gab. Sie arbeitete in der üblichen Weise.
Bevor wir aber mit den Arbeiten beginnen können, benötigen wir
einen passenden
Steuerwagen
und die Zwischenwagen. Dabei war bei der Auslieferung der ersten
Lokomotiven
dieser Baureihe die Auswahl nicht besonders gross. Als Zwischenwagen
wurden angepasste
Leichtstahlwagen
verwendet. Jedoch gab es auch hier anfänglich noch nicht viele Modelle,
die mit dem entsprechenden Kabel vom Typ III ausgerüstet wurden.
Speziell
war, dass dieses Mo-dell, das neben dem Abteil für Reisende auch ein
Gepäckabteil
besass, nie in Serie gebaut wur-de. Wir benutzen daher dieses Modell für
die weiteren Arbeiten bei der Bildung und Bedienung unseres
Pendelzuges.
Verwendet wurde dazu das Kabel vom Typ III.
Wenn die
Lokomotive
an den Zug gekuppelt wurde, musste sie ausgeschaltet werden. Dabei mussten
sämtliche
Steuerschalter
in der neutralen Stellung sein. Die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
konnten jedoch geöffnet bleiben. Weitere Arbeiten, damit die
Vielfachsteuerung
aktiviert wurde, waren jedoch nicht erforderlich. Die Einrichtung stand,
sofern sie eingebaut worden war, jederzeit zur Verfügung und war leicht
einzurichten.
Erst wenn die
Lokomotive
ausgeschaltet war, durfte das Kabel der
Vielfachsteuerung
verbunden werden. Dazu wurde dieses in die Steckdosen gesteckt und
anschliessend verdreht. Damit konnte es nicht herausrutschen. Genau diese
Drehung war der Grund, warum die Lokomotive ausgeschaltet werden musste,
denn beim einstecken wurden falsche Kontakte verbunden und es konnten beim
verdrehen
Kurzschlüsse
entstehen.
Zusätzlich mussten auch alle anderen
Verbindungen
erstellt werden. Dazu gehörten sämtliche Luftleitungen. Die
Zugsheizung
wurde bei den
Pendelzügen
immer verbunden, auch wenn die
Heizung
im Sommer nicht eingeschaltet wurde. Auch der
Faltenbalg
wurde verbunden. Wobei der Durchgang nur geöffnet wurde, wenn die
Lokomotive
zwischen den Wagen eingeklemmt worden war. Für uns ist das jedoch nicht
der Fall.
Auf der
Lokomotive
wurde nun der Durchgang zum
Maschinenraum
abgeschlossen. Damit war gesichert, dass sich allenfalls auf die Maschine
begebende Reisende nicht verlaufen konnten. Der Schlüssel zum
Verriegelungskasten wurde abgezogen und in im Schrank mit den
BV-Hähnen
versteckt. Zum Schluss wurden noch die Stirnlampen, die gegen den Zug
gerichtet wurden, komplett gelöscht. Das weisse Rücklicht wurde nun am
Ende des
Pendelzuges
gezeigt.
Nach dem Abschluss dieser Arbeiten konnte der
Pendelzug
in Betrieb genommen werden. Dazu wechseln wir nun auf den
Steuerwagen.
Bei
Lokomotiven,
die in der
Vielfachsteuerung
verkehren sollten, war dies die zweite Maschine. Wobei hier die
Zugsheizung
nicht verbunden wurde. Alle anderen Leitungen waren in jedem Fall bei
Anwendung der Vielfachsteuerung zu verbinden. Doch nun wieder zu unserem
Pendelzug mit dem CFt4.
Wurde nun die
Lokomotive
ein-geschaltet, fand das einfach am anderen Ende des Zuges statt. Die mit
den
Steuerschaltern
er-teilten Befehle wurden über das Kabel zur Lokomotive übermit-telt und
von dieser die Anfor-derung entsprechend ausge-führt. Wir haben daher nur
die Bedienelemente ausgelagert. Leicht anders war die Situation bei der Vielfachsteuerung von Lokomotiven. Hier wurden zwei vollwertige Triebfahrzeu-ge verbunden. Damit wurden die Befehle, die der vorderen Lokomotive erteilt wurden, einfach auf das zweite Modell übermittelt.
Bei der zweiten Maschine führ-te dies dazu, dass sie die
Infor-mationen einfach von einem an-deren Fahrzeug bekam. Daher galt für
diese kein Unterschied, denn die Signale waren identisch.
Ob die Anforderungen auch ausgeführt wurden, wusste der Lokführer
erst, wenn er den
Hauptschalter
einschaltete. Dabei bemerkte er jedoch nur den erfolgreichen Versuch, denn
in diesem Fall war die Anzeige der
Fahrleitungsspannung
im
Steuerwagen
vorhanden. Diese erste Inbetriebnahme eines neu formierten
Pendelzuges
wurde im Betrieb auch Pendelprobe genannt. Dabei ging es jedoch nur darum,
ob die Lokomotive die Anforderungen auch ausführt.
Bei Anwendung der
Vielfachsteuerung
von zwei
Lokomotiven
waren die
Meldungen
der zweiten Lokomotive direkt vorhanden. Wurde von der ferngesteuerten
Lokomotive der
Hauptschalter
ausgeschaltet, erfolgte das auch auf der bedienten Maschine. Das Personal
hatte daher in diesem Fall deutlich mehr Informationen zur Verfügung, als
das bei einem
Pendelzug
der Fall war, denn dort waren wirklich nur die Bedienelemente vorhanden.
Die weiteren Schritte waren mit der zuvor beschriebenen Lösung
identisch, es gab daher keine Beschränkungen zu beachten. Jedoch führten
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei den
Pendelzügen
zusätzliche Funktionen ein. Diese wurden bei Pendelzügen und nur dort, vom
Lokführer übernommen. Dazu waren sowohl im
Steuerwagen,
als auch auf den
Lokomotiven
zusätzliche Bedienelemente eingebaut worden.
Er hatte dabei die gleichen Stellungen, wie jener der
Stirn-lampen. Jedoch wurde das Symbol zur Kennzeichnung leicht ver-ändert.
So sollte auf die geänderte Funktion dieses
Steuer-schalters
hingewiesen werden.
Wurde der
Steuerschalter
auf die Position «1» verschoben, wur-den die Abteile der im
Pendelzug
eingereihten Wagen beleuchtet. Es lag daher beim Lokführer diese richtig
zu beleuchten. Dabei galt die Regel, dass nur bei Dämmerung, in der Nacht
und in
Tunnel
das Licht eingeschaltet wurde. Daher befand sich der Steuerschalter bei
Tag auf der Stellung «0». In der mittleren Stellung konnte der
Führerstand
mit oder ohne Funktion gewechselt werden.
Zudem sollten auch die Türen durch den Lokführer gesteuert werden.
Dazu wurden auf dem
Führerpult
eine rote Taste und eine gelbe Lampe eingebaut. Auch sie waren nur bei den
Pendelzügen
aktiv und hatten auf die
Lokomotive
schlicht keinen Einfluss. So lange die Türen freigegeben waren, leuchtete
die gelbe Lampe und meldete so diesen Zustand an den Lokführer. Er hatte
damit vorerst noch nichts zu tun, denn benötigt wurden diese während der
Fahrt.
Wurde eine Türe im Zug geöffnet, begann auch der rote Taster zu
leuchten. Damit war eine offene Türe zu erkennen. Wo und auf welcher Seite
das erfolgte, konnte jedoch nicht erkannt werden. Es gab daher nur die
Information alle Türen geschlossen, oder eben eine offen. Damals reichte
diese Lösung durchaus, weil auf dem Zug ein
Zugführer
mitfuhr und der so seine Kontrollaufgaben übernehmen konnte.
Wie erwähnt, benötigt wurde die Speiseleitung in erster Linie für die pneumatischen Bremsen. Jedoch wurden damit auch andere Einrichtungen auf dem Steuerwagen, wie zum Beispiel die Pfeife angesteuert.
Bei den Zwischenwagen wurde diese Leitung benötigt um die Türen zu
schliessen. Wurde die
Speiseleitung
aus irgendeinem Grund unterbrochen, erfolgte durch die
Bremsventile
eine Bremsung. So war gesichert, dass der Zug auch anhalten konnte, wenn
er die
Lokomotive
verlor. Auf dem Steuerwagen stand die Spannung der Hilfsbetriebe nicht zur Verfügung. Daher wurden für die Heizungen andere Lösungen benötigt. In der Folge schloss man die Heizkörper an der Zugsheizung an und die Scheibenheizung an der Batterie.
Weil nun mehr Energie ab der
Batterie
bezogen wurde und diese nicht vom
Bordnetz
der
Lokomotive
übermittelt werden konnte, mussten die Batterien auf dem
Steuerwagen
ver-doppelt werden.
Eine besondere Funktion mit der
Vielfachsteuerung
dieser Baureihe war die Erteilung des Abfahrbefehls. Diese wurde in
Haltestellen
vom
Zugpersonal
erteilt. Damit dieses bei einem
Pendelzug
nicht zur Lampe und zur
Pfeife
greifen musste, waren an den angepassten Zwischenwagen und beim
Steuerwagen
CFt4 spezielle Schalter vorhanden. Betätigte der
Zugführer
diesen, leuchtete im
Führerstand
eine grüne Lampe und es erklang ein Horn.
Wurde die Fahrt begonnen, verriegelte der Lokführer die Türen.
Dazu drücke er die vorher erwähnte rote Taste. Damit erlosch die gelbe
Lampe. War eine Türe offen, leuchtete der rote Taster. Erst wenn beide
Meldungen
dunkel waren, galten die Türen als korrekt verschlossen. Diese konnten von
den Reisenden nicht mehr geöffnet werden, weil der Schliesszylinder mit
Druckluft
versorgt wurde. Viele diese aus, konnte die Türe normal geöffnet werden.
Ein
Einklemmschutz,
wie er heute bei solchen Einrichtungen vorhanden ist, gab es schlicht
nicht. Die Türen der Wagen knallten einfach zu. Zudem konnte sie von einer
kräftigen Person auch im verriegelten Zustand aufgezogen werden. Bei
schneller Fahrt, konnte es durchaus auch passieren, dass die Türen im
Fahrtwind flatterten. So wurde jedoch der Lokführer genervt, denn in
diesen Fall blinkte die rote Taste unregelmässig.
Die Fahrt konnte nun, wie schon im Kapitel zuvor beschrieben,
begonnen werden. Dabei erfolgte die Rückmeldung der
Fahrstufe
etwas verzögert, da zuerst die
Puffer
eingedrückt wurden. Bei der Kombination von zwei
Lokomotiven
wurde die Schaltung nicht so gut bemerkt, jedoch war nun eine Anzeige
vorhanden, die eine allfällige Differenz anzeigte. Diese konnte zum
Beispiel auftreten, wenn die ferngesteuerte Lokomotive ins Schleudern
geriet.
Weil der Lokführer diesen Vorgang auf dem
Steuerwagen nicht bemerkte,
wurden die
Lokomotiven mit einem
Schleuderschutz ergänzt. Zwar war dieser
bei allen Maschinen vorhanden, jedoch wurde er nur hier benötigt. Dabei
kontrollierte diese Einrichtung nicht nur die Drehzahlen der
Fahrmotoren,
sondern es war damit auch ein
Überdrehzahlschutz vorhanden. Dieser
schaltete die Lokomotive aus, wenn die Geschwindigkeit der Maschine 137
km/h überstieg.
Bei Problemen mit der
Vielfachsteuerung
konnte es jedoch pas-sieren, dass diese Einrichtung nicht bedient werden
konnte. Dann kam der Zug auf Grund der
Sicherheitssteuerung zum Stehen und
der Lokführer musste die Ursache suchen, was in diesem Fall nicht einfach
war. Auch sonst waren Störungen am Triebfahrzeug bei einem Pen-delzug schwerer zu erkennen, als das bei der Vielfachsteuerung der Fall war. Der Grund war einfach, denn auf dem Steuerwagen wurde lediglich die Ursache festgestellt.
Was auf der
Lokomotive davor genau passierte, erkannte das
Personal nicht. Behoben werden konnte die Störung jedoch nur auf dem
betroffenen
Triebfahrzeug. Daher war der Weg etwas weiter, als normal.
Wie einfach aufgebaut diese
Vielfachsteuerung wirklich war, zeigt sich,
wenn wir eine spezielle Kombination bilden. Dabei ersetzen wir lediglich
den
Steuerwagen durch eine zweite
Lokomotive. Der Lokführer bediente diese
nun, wie bei einer normalen Vielfachsteuerung. Dabei spielte es nur für
die Steuerung der
Beleuchtung, des Abfahrbefehls und der Türschliessung
eine Rolle, denn die war nun auf den Wagen auch aktiv.
Kam der
Pendelzug wieder an einem
Bahnsteig zum Stehen, wurden die Türen
vor den Halt mit drücken der gelben Taste wieder freigegeben. Nach dem
Stillstand konnten die Leute den Zug ungehindert verlassen und die rote
Taste begann zu leuchten. Den beschriebenen Vorgang mit der Abfahrt
wiederholte sich somit nach jedem Halt. Beim Wechsel des
Führerstandes war
die Steuerung nicht aktiv und die Türen konnten ungehindert geöffnet
werden.
Damit haben wir nun die Fahrt mit dem
Pendelzug beendet und dieser soll
nun aufgelöst werden. Dazu musste die
Lokomotive, wie vorher beschrieben
ausgeschaltet werden. Anschliessend konnten alle Leitungen getrennt
werden. Das Kabel wurde im
Maschinenraum der Lokomotive verstaut und damit
haben wir wieder eine normale Maschine erhalten. Auch jetzt waren keine
speziellen Schaltungen vorzunehmen.
Zum Schluss dieses Kapitel muss erwähnt werden, die die mit den sechs
Lokomotiven und dem
Steuerwagen erprobte
Vielfachsteuerung vom Typ III
sehr gut funktionierte. Das Kabel war in der Handhabung einfach, die
Steckdosen waren dicht und die Angelegenheit konnte einfach eingerichtet
werden. In der Folge sollten noch viele weitere Baureihen (Re 4/4
II, RBDe
4/4) mit dem Kabel
von Typ drei ausgerüstet werden. Dazu gehörten auch die Lokomotiven mit
den Nummern 407 bis 426.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
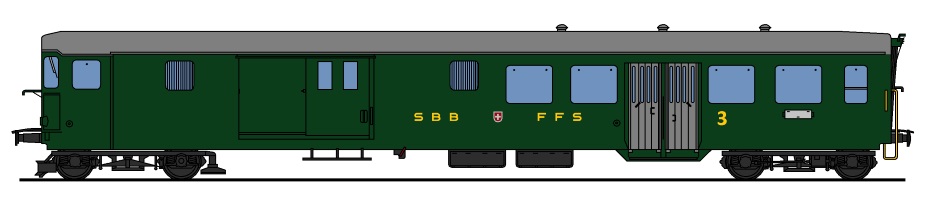 Zu
den sechs
Zu
den sechs
 Auf
dem
Auf
dem
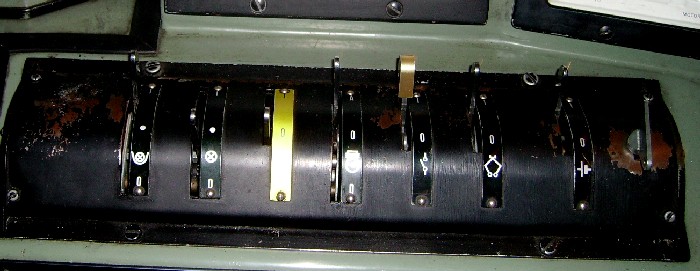 Eine
der neuen Funktionen betraf den bisher noch nicht ver-wendeten
Eine
der neuen Funktionen betraf den bisher noch nicht ver-wendeten
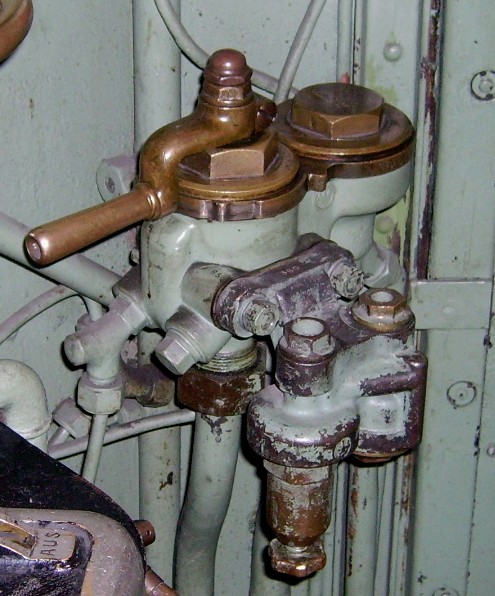 Bevor
die Fahrt jedoch begonnen werden konnte, musste auch jetzt die Funktion
der
Bevor
die Fahrt jedoch begonnen werden konnte, musste auch jetzt die Funktion
der  Während der Fahrt bediente der Lokführer die
Während der Fahrt bediente der Lokführer die