|
Starten wir durch |
|||||
|
Wir
starten durch, ist ein Begriff der Luftfahrt und beschreibt den Zeitpunkt,
wenn eine Landung abgebrochen werden muss. Wir haben aber Motoren und
Gasturbinen kennen gelernt und
wissen nun, wie die funktionieren. Was noch fehlt, ist der Teil um diese
zum laufen zu bringen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, wie
man allgemein denken könnte, denn in allen Fällen muss das Bauteil zuerst
zum drehen bewegt werden.
Selbst auf die
Elektrizität
kann bei kleineren Motoren verzichtet werden. In dem Fall startet man den
Motor mit einer Kurbel. Das wird zum Beispiel beim Mofa gemacht, denn dort
tritt man in die
Pedalen
um zu starten. Der weitere Betrieb funktioniert dann jedoch ohne elek-trische Energie. Wobei es davon eine Ausnahme gibt. Da beim Ottomotor das Gemisch gezündet werden muss, wird dort der elektrische Funke auch während dem Betrieb benötigt.
Jedoch stammt dann die Energie meistens direkt vom Motor, so dass auch er
sich alleine versorgen könnte. Der grösste Unterschied stellt aber der
Startvorgang dar, denn hier gab es Unterschiede.
Doch bevor wir die Maschinen anlassen, müssen wir sie dazu vorbereiten.
Denn einfach so kann man nicht starten. Die Maschinen brauchen die
Betriebsstoffe, die letztlich die Verbrennung starten. Bei beiden
Maschinen wird daher zuerst die Zufuhr des
Treibstoffes
gestartet. Das passiert meistens schon, wenn man das Fahrzeug in Betrieb
nimmt. Die Förderung des Treibstoffes benötigt deshalb bereits
elektrischen
Strom.
Ist
man soweit, benötigt man die Luft. Die ist sehr einfach zu erhalten, denn
die ist bei beiden Varianten schon vorhanden. Zwar steht sie noch nicht
unter dem für den Betrieb nötigen Druck, aber das führt beim Starten der
Maschinen zu keinem Nachteil. Sie können mit der normalen Luft starten.
Der Betrieb sorgt dann dafür, dass der Druck der Luft ansteigt und so die
normale Verbrennung einsetzt. Doch nun zum eigentlichen Start der
Maschine.
|
|||||
|
Die Maschine starten |
|||||
|
Der
ganze
Ablauf
um eine
Gasturbine, oder einen Motor zu
starten unterscheidet sich deutlich. In beiden Fällen muss aber die
Maschine in Bewegung versetzt werden. Dazu werden jedoch unterschiedliche
Methoden verwendet. Bevor wir uns mit dem Otto- und dem
Dieselmotor und den dort
möglichen Startmöglichkeiten befassen, starten wir die Gasturbine. Der
Grund dafür ist simpel, denn der Start einer Gasturbine benötigt mehr
Zeit.
Dazu benutzt man bei der
Gasturbine die normalen
Bat-terien,
die auf dem Fahrzeug auch für
Beleuchtung
und Steuerung vorhanden sind. Speziell belastet werden diese Batterien
dabei nicht, denn man benötigt nur einen klei-nen Zündfunken. Diese auf dem Fahrzeug montierten Batterien nennt man auch Stützbatterien. Sie stützen das Bordnetz, bis die Energie dazu von der Gasturbine erzeugt werden kann. Die Belastung für diese Batterien ist daher nicht besonders hoch, da keine grossen Kräfte nötig sind.
Die
Gasturbine selber benötigt
schliesslich nur den Zünd-funken und der muss auch nicht lange erzeugt
werden. Daher sind Stützbatterien eher auf einen dauerhaften Be-trieb
ausgelegt. Die Gasturbine wird daher mit einem elektrischen Funken in der Brennkammer gezündet. Das heisst, man aktiviert einfach den Brenner.
Durch die Verbrennung des
Treibstoffes
entstehen
Abgase,
die nun durch die Schaufeln der Turbinenräder in die Freiheit gelangen.
Damit beginnt sich die
Gasturbine langsam zu drehen. Der
Start ist erfolgt und die Gasturbine läuft nun selbstständig an. Das geht
wie folgt weiter.
Durch die drehende Bewegung der
Gasturbine
wird der
Kompressor
aktiviert und führt schwach komprimierte Luft zum Brenner. Die
Luftvorwärmerrohre
erwärmen die Luft bereits leicht. Der Brenner erhält nun erwärmte Luft,
womit er den
Treibstoff
heisser verbrennen kann, die Kraft nimmt zu und die Gasturbine beginnt
sich immer schneller zu drehen. Dadurch kann der Kompressor einen höheren
Druck erzeugen und so weiter.
Das
ist zum Beispiel der Grund, warum Flugzeuge vor dem Start einen Moment
warten. Diese Zeit wird genutzt um die
Gasturbinen
auf
Leistung zu
bringen. Vereinfacht gesagt, die Turbine wird angelassen. Ein kleiner Funke entzündet ein Feuer und dessen Abgase sorgen dafür, dass sich die Turbine bewegt. So kann mehr Luft zugeführt werden. Der Start bis zur für den Betrieb notwenigen Wert vollzieht die Turbine selber. Es erfolgt ein lang-samer Start, der mitunter eine gewisse Zeit braucht.
Es
wird eben angelassen und dann gewartet, wie beim Feuer, das in der
Feuerbüchse ausgebreitet
wird.
Starten des Dieselmotors:
Gestartet wird der
Dieselmotor tatsächlich nur
indem man ihn in Drehung versetzt. Durch die Drehung der
Kurbelwelle,
werden die Takte aktiviert. Nach zwei Umdrehungen sollte der Motor dann
automatisch starten. Den Grund finden wir bei den Takten. Drehen wir die
Kurbelwelle, wird die Luft in einem
Zylinder
verdichtet und dann der
Treibstoff
gezündet. Mit jeder weiteren Drehung startet die Verbrennung auch in den
anderen Zylindern.
Es
stellt sich die Frage, wie wir diese Drehung erzeugen. Eine einfache
Methode ist eine Kurbel, die man an der
Kurbelwelle
einsteckt und diese damit dreht bis der Motor läuft. Diese Lösung kann bei
kleineren Motoren durchaus angewendet werden. Der
Dieselmotor kann dann ohne
Elektrizität
gestartet werden, denn für den Betrieb benötigt es diese Elektrizität
nicht. Dieselmotoren zünden bekanntlich selber.
Man
vermag daher die
Kurbelwelle nicht
zu drehen. Daher benötigen wir eine Hilfe. Diese Hilfe bietet ein
elektrischer Motor, der genug Kraft hat um die Kur-belwelle zu drehen. Um die Kurbelwelle eines grösseren Dieselmotors in Bewegung zu setzen ist ein Starter vorhanden. Die-ser Starter besteht aus einem einfachen elektrischen Motor, der mit Hilfe eines kuppelbaren Zahnrades mit der Kurbelwelle verbunden ist.
Das
Zahnrad des Starters
ist so ausgelegt, dass bei laufendem
Dieselmotor der Elektromotor
automa-tisch abgekuppelt wird. Dadurch werden Schäden am Starter
verhindert. Die Elektrizität für den Starter stammt von den Star-terbatterien. Diese Batterien entsprechen den Stütz-batterien, die wir bei der Gasturbine kennen gelernt haben.
Die
Starterbatterien zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie kurzfristig
auch sehr hohe
Ströme
ver-tragen und so optimale Verhältnisse zum Start des
Dieselmotors bereitstellen.
Nach dem Start, wird die
Batterie,
die beim Start stark belastet wurde, wieder geladen.
Daher kann man nicht beliebig oft einen Startversuch durchführen. Das
würde dazu führen, dass die
Batterien
zu stark entladen werden. Die verfügbare
Leistung
reicht dann nicht mehr für den Start. Ideal sind hier
Bleibatterien
und diese benötigen einen regelmässigen Unterhalt. Dabei ist dieser bei
den Starterbatterien sogar noch intensiver, als bei den Stützbatterien.
Daher haben Modelle für den Start auch eine kürzere Lebensdauer.
Diese Einschubmodule bestehen aus einem Auszug, der es erlaubt die
Bleibatterien
aus dem Fahrzeug zu ziehen. Ausserhalb des Fahrzeuges kann man dann die
Batterien
mit Hilfe eines
Kranes
heben und so auswechseln. Einschubmodule sind jedoch nur bei neueren Fahrzeugen der Eisenbahn vorhanden, da dort schwerere Batterien benötigt werden. Zudem können solche Module auch bei anderen Baugruppen verwendet werden. Sie
erfüllen den Zweck immer dann, wenn schwere Teile unterhalten werden
müssen. Sie kennen solche Module auch zu Hause. In der Küche sind solche
vorhanden um das Material zu verstauen. Sie nennen diese Schubladen.
Schubladen sind also nichts anderes als Einschubmodule. Jedoch klingt es
bei einer
Lokomotive etwas besser, wenn man
von einem Einschubmodul spricht und nicht von einer Schublade. Es klingt
technischer und mit dem müssen wir leben. Man zieht die Schublade heraus,
auf dieser sind die Starterbatterien und diese müssen gewartet werden.
Klingt einfacher, aber eben auch etwas wie bei einem Amateur der keine
Ahnung hat.
Es
fehlt eigentlich nur noch der Ottomotor. Beim dem besteht der einzige
Unterschied darin, dass bei der Drehung der
Lichtbogen
bei der Zündkerze erzeugt werden muss. Auch dann setzt die Verbrennung ein
und der Motor beginnt mit der Arbeit. Dabei gibt es aber ein Problem, denn
bei kalten Motoren klappt dieser Start wirklich nur bei den Ottomotoren
und bei der
Gasturbine ohne Probleme.
Trotzdem sollten Sie weiterlesen.
|
|||||
|
Der Winterstart |
|||||
|
Ich
nennen diesen Teil einfach mal Winterstart. Jedoch müssen solche Lösungen
bei gewissen
Dieselmotoren auch bei
normalen Temperaturen getroffen werden. Davon betroffen ist nun wirklich
nur der Dieselmotor, denn der
Treibstoff
hat einen hohen Punkt für die Entflammung. Ist der Motor zu kalt, kann das
Dieselöl nicht
auf normale Weise entzündet werden. Daher müssen wir genauer Hinsehen,
denn der erste Punkt betrifft auch den Ottomotor.
Das wird noch mit der Tatsache ergänzt, dass der Motor und das gilt auch beim Ottomotor nicht so leicht gestartet werden.
Man
benötigt von den schwachen
Batterien
mehr
Leistung
und das kann sie überfordern. Im dem Fall gelingt der Start auch nicht. Nur schon das Problem mit den Batterien würde es ratsam machen, das Fahrzeug in der Wärme abzu-stellen. Jedoch kann das nicht jeder und nun kommt es wirklich knüppeldick. Motoren die kalt gestartet werden, können dabei durchaus beschädigt werden. So kann es im Mo-torblock Risse geben, die dann Öl austreten lassen.
Sie
sollten sich wirklich überlegen, den Wagen in Zukunft in der Garage zu
parken und den Gerümpel draussen deponieren.
Da
wir das
Dieselöl mit dem
Winterdiesel auf den Betrieb im Winter vorbereitet haben, können wir nun
zum Start des
Dieselmotors übergehen. Daher
betrachten wir den Startvorgang, den wir vorhin kennen gelernt haben,
anhand eines Startes des Dieselmotors bei kalten Temperaturen. Wie tief
diese nun liegen, lassen wir so stehen, wird starten den Dieselmotor
einfach im Winter. Im Winter ist es kalt, daher ist es ein Kaltstart.
Der Kaltstart:
Beim Kaltstart sind der Motor und der
Treibstoff
kalt. Die Luft, die zur Verbrennung benötigt wird, glänzt dabei auch nicht
gerade mit Wärme. Das sind in etwa die Voraussetzungen, wie wir sie in
einem kalten Winter antreffen können. Diese Starts sind für den
Dieselmotor nicht ganz
einfach. Im Gegenteil, solche Kaltstarts sind für den Dieselmotor sogar
schädlich, da er unter einem gewissen Verschleiss leidet.
Das
kann dazu führen, dass keine optimale Verbrennung einsetzt. Statt dem
Knall ergibt sich nur eine kleine Stichflamme. So kann unverbrauchter
Treibstoff
in die
Abgasanlage
gelangen und dort sogar in Brand geraten. Daher kann es sein, dass die Verbrennung dadurch nur zögerlich beginnt. So lange dieser jedoch nicht korrekt zündet, ist auch die Kraft nicht vorhanden um die Kurbelwelle zu drehen.
Der
Starter muss daher länger betätigt werden, was bei den schwachen
Batterien
zu grossen Problem führen kann. Es ist wirklich schlecht so einen
Dieselmotor zu starten. Der
Vorteil vom Ottomotor ist, dass er fremd zündet, aber das ist es schon. Kaltes Benzin vermischt sich im Vergaser nicht so gut und so kann es dort zu Fehlern bei der Zündung kommen. Wer nun einen Wagen mit Ottomotor hat, ist etwas besser dran, als der Nachbar mit seinem grossen Wagen mit Dieselmotor.
Da
die Probleme jedoch bekannt sind, haben Hersteller dafür gesorgt, dass der
Start mit kaltem Motor etwas besser klappt und dazu muss es einfach im
Motor wärmer werden.
Mit Hilfe einer speziellen elektrisch betriebenen
Glühkerze kann man die Luft im
Zylinder
erwärmen. Dadurch erwärmt sich auch das Metall leicht. Man nennt diesen
Vorgang auch vorglühen. Der Motor startet, wenn der Vorgang abgeschlossen
ist. Die Zündung klappt nun besser, da die Luft erhitzt wurde und der
Treibstoff
daher optimal zündet. Bei den folgenden Umdrehungen erwärmt sich die Luft
durch die Explosionen und der Motor läuft korrekt.
Bei
grösseren Modellen vermag diese Zündkerze den Verbrennungsraum nicht
optimal auf Wärme zu bringen. Man muss den Motor auf andere Weise erwärmen
und das macht vielleicht der Nachbar mit dem grossen Wagen. Die Standheizung: Um den Dieselmotor aufzuheizen, benutzt man Heizungen, die im Stillstand funktionieren. Man nennt diese Heizungen deshalb Standheizungen.
Die
Standheizung funktioniert mit einem Brenner, der mit
Dieselöl betrieben
wird und der so das
Kühlwasser
aufwärmt. Mit einer Pumpe wird das Kühlwasser bewegt, so dass das warme
Wasser den Motor-block vor dem Start erwärmt. Damit kann der Motor warm gestartet werden, was den Kaltstart verhindert. Standheizungen haben jedoch den Nachteil, dass sie die Starterbatterie belasten und dass sie Treibstoff verbrauchen.
Jedoch kann die Belastung mit dem normalen Start ausgeglichen werden. LKW
benutzen heute solche Standheizung bereits in der Serie und die sorgen
zudem dafür, dass der Innenraum des Fahrzeuges auch nicht zu kalt ist.
Sollten Sie einen Wagen mit
Dieselmotor haben, sollten Sie
sich wirklich überlegen, eine solche Standheizung einbauen zu lassen. Der
Motor wird es Ihnen danken. Für die Anhänger vom Ottomotor ist es auch
nicht schlecht, wenn dieser nicht kalt starten muss. Zumindest profitieren
Sie, denn dank der Standheizung müssen keine Scheiben gekratzt werden. Sie
können in einen warmen Wagen steigen, starten und losfahren.
Die
arbeitet nicht mit dem
Treibstoff.
Das einzige was man dazu braucht, ist eine Steckdose und ein passendes
Kabel. Durchaus auch eine Lösung, die bei schweren LKW angewendet werden
kann. Die Vorheizanlage: Die Lösung um die Dieselmotoren warm zu halten, sind die in den Bahnhöfen montierten Vorheizanlagen für Lokomotiven. Die Diesellokomotive wird dabei an ein spezielles Stromkabel angeschlossen.
Durch die mit dem Kabel zugeführte elektrische Energie wird der
Dieselmotor erwärmt, so dass
es zu keinem Kaltstart kommt. Die Pumpe des
Kühlwassers
wird dabei aktiviert und das
Kühlmittel
erwärmt. Vorheizanlagen benötigen entsprechende Infrastruktur, das kann bei der Eisenbahn besser umgesetzt werden, als auf der Strasse. Dort können die Fahrzeuge auch nicht zu Hause abgestellt werden und dort fehlt dann der An-schluss.
Das
ist der Grund, warum sich die Standheizungen in dem Bereich durchgesetzt
haben, denn wer zu seinem Motor sorge tragen will, der sollte verhindern,
dass er kalt gestartet werden muss.
So,
wir haben unseren
Dieselmotor auch im Winter
gestartet und sind nun bereit, die
Lokomotive zu bewegen. Das
ist aber ein anderes Kapitel, denn nun müssen wir auch etwas sehen. Sie
kennen das, denn im Winter müssen Sie die Scheiben kratzten und auch dann
ist die Sicht nicht optimal. Vielleicht lohnt es sich wirklich beim
Händler nach einer Standheizung zu fragen. Eines ist sicher
Lokomotivpersonal
kratzt keine Scheiben.
|
|||||
| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | |||
| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | |||
| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | |||
| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | |||
| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | |||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||
 In
den meisten Fällen benötigt man dazu jedoch
In
den meisten Fällen benötigt man dazu jedoch
 Start
der Gasturbine
Start
der Gasturbine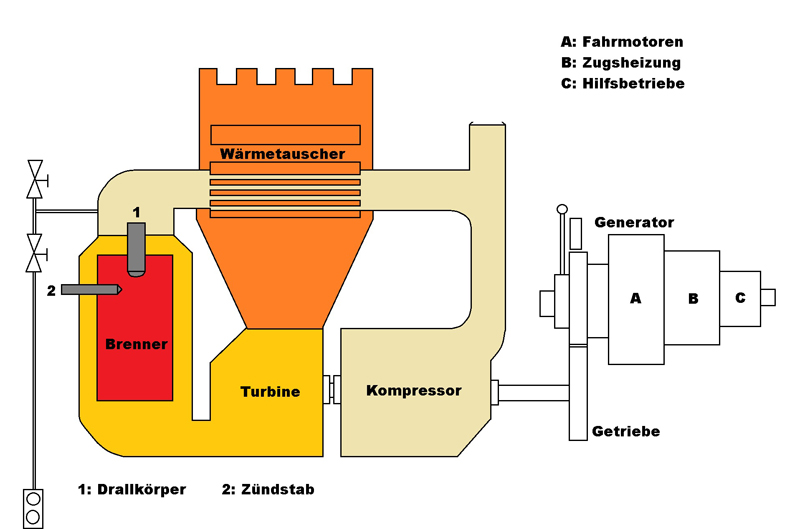 Die
Turbine läuft nun und wird immer schneller und heisser. Das kann einige
Minuten dauern, denn die Schaufeln müssen immer schneller drehen. Erst
wenn die
Die
Turbine läuft nun und wird immer schneller und heisser. Das kann einige
Minuten dauern, denn die Schaufeln müssen immer schneller drehen. Erst
wenn die
 Bei
grösseren Motoren reicht die Kraft nicht aus, um die
Bei
grösseren Motoren reicht die Kraft nicht aus, um die
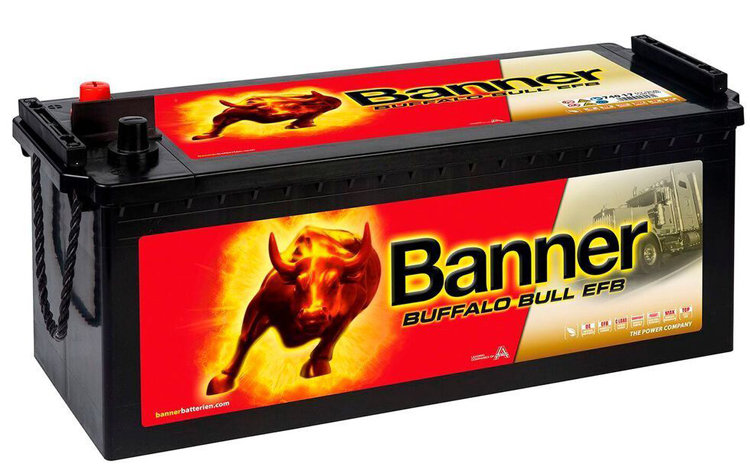
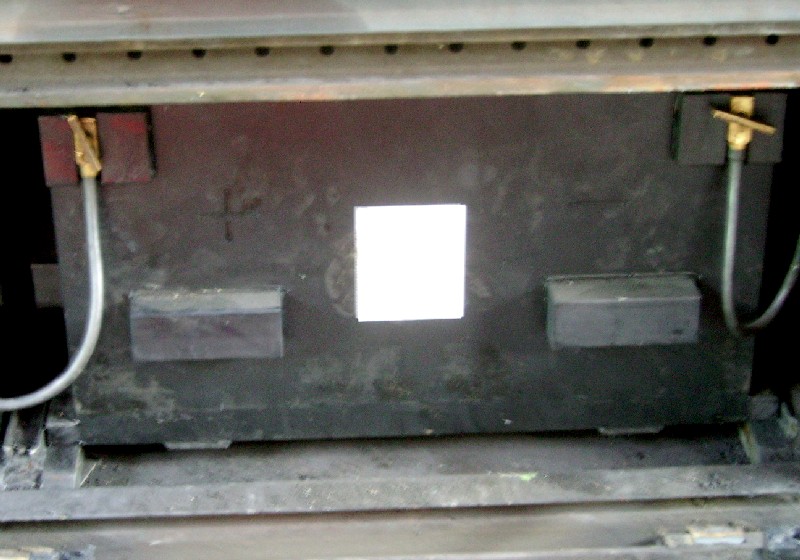 Je
tiefer die Temperatur sinkt, desto schwächer werden die
Je
tiefer die Temperatur sinkt, desto schwächer werden die
 Die
Zündung des
Die
Zündung des
 Wie
es der Name schon sagt, eine Glühkerze besteht aus einem glühend heissen
Faden. Verwendet werden diese Lösungen bei kleineren bis mittleren
Wie
es der Name schon sagt, eine Glühkerze besteht aus einem glühend heissen
Faden. Verwendet werden diese Lösungen bei kleineren bis mittleren
 Wie
gut solche Standheizungen sind, zeigt sich bei den
Wie
gut solche Standheizungen sind, zeigt sich bei den