|
Die Gasturbine |
|||||
|
Nicht immer kam der
Dieselmotor oder die
Dampfmaschine
zur Anwendung. Noch seltener als der Ottomotor wurde die Gasturbine
verwendet. Da es aber auch ein thermischer
Antrieb
ist, müssen wir uns diese Lösung ansehen. Grosse Erfolge erzielte man mit
Gasturbinen bei der Luftfahrt und in
Kraftwerken,
denn diese erbringen eine sehr hohe
Leistung und
diese kann oft ausgenutzt werden. Daher heisse ich Sie in der Welt der
Turbinen willkommen.
Bei
den Mantelstromtriebwerken wird ein Teil der Luft an der Turbine vorbei
geführt. So kann diese gekühlt werden und es wird erst noch ein grösserer
Schub erzeugt. Hub-schrauber nutzen die Gasturbine jedoch direkt
mechanisch und das ist die Lösung der Eisenbahn. Dabei gilt jedoch, dass Gasturbinen trotz dem Namen nicht mit Gas betrieben werden müssen. Der Treibstoff wird hier verbrannt und die Abgase für den Betrieb genutzt. Daher werden die entstehenden Gase zusammen mit der Wärme genutzt.
Die
Turbine wird dadurch in Drehung gebracht und das will man letztlich, denn
so kann man etwas in Bewegung setzen. Bei der Luftfahrt wurde damit ein
Ventilator,
oder ein Propeller angetrieben. Als grosser Vorteil der Gasturbine gilt, dass hier die Leis-tung gleichmässiger in Kraft umgewandelt wird, wie das bei Motoren der Fall ist.
So
lange der Gasstrom vorhanden ist, dreht sich die Tur-bine und das ist
letztlich auch der Grund für den grossen Erfolg bei den Flugzeugen. Jedoch
stellt sich die Frage, ob man denn wirklich immer
Gase
benutzen muss. Man könnte ja auch mit Dampf arbeiten, denn der hat
ähnliche Eigenschaften.
Dampfturbinen sind mit Dampf betriebene
Gasturbinen. Auch sie waren bei den Eisenbahnen sehr selten im Einsatz,
jedoch können diese Turbinen in thermischen
Kraftwerken
verwendet werden. Das ist zum Beispiel bei mit
Kohle
betriebenen Modellen der Fall. Es gibt dabei nur wenige Unterschiede und
uns fehlt eigentlich nur noch ein Beispiel der Eisenbahn. Denn es gab sie
wirklich die
Lokomotive mit Dampfturbine.
Sie
wurde als
Baureihe
B 3/5 geführt und sie wurde mit der Nummer 1801 versehen. Es war kein
Neu-bau, denn das Fahrzeug entstand 1919 durch Umbau einer Dampflokomotive
der Reihe B
3/4. Ursprüng-lich trug diese die Nummer 1578.
Wirklich eine lange Zeit konnte sich die Dampf-turbine bei den Bahnen aber
nicht halten. Diese besondere
Lokomotive mit quer
eingebauter Turbine wurde bereits wieder im Jahre 1924 ausrangiert. Die
beschlossene Elektrifizierung der Strecken machte solchen Sonderlingen zu
schaffen, denn sie waren oft das erste, das auf den Schrott geworfen
wurde. Damit können wir die Dampfturbine bereits wieder vergessen und uns
der Gasturbine zuwenden.
Aber
halt, was ist denn so eine Turbine? Man hört viel davon und wirklich viel
weiss man nicht, denn man kommt diese nur selten zu sehen. Nach den Einbau
arbeiten diese oft mehrere Jahre und während dem Betrieb möchte ich nicht
in der Nähe sein, denn da geht wirklich die Post ab. Sehen wir uns den
Aufbau von Turbinen genauer an, denn sie sind spannend, weil der Bau
wirklich keine leichte Aufgabe für die Arbeiter ist.
Die Turbine:
Bei Turbinen wird mit der Hilfe
eines fliessenden Mediums eine Welle in Drehung verbracht. Einfachere
Modelle sind die Muster nach Pelton, Francis und anderen, die in
Flusskraftwerken verwendet werden. Turbinen, die mit
Gasen, oder mit Dampf
betrieben werden, müssen anders aufgebaut werden. Man benötigt mehr Fläche
um die Kraft auf die Welle zu übertragen und dabei muss das Gas
vorbeiströmen können.
Es handelt sich um eine axiale
Turbine, die sehr einfach gebaut werden kann. Durch den Kanal in dem sich
der Rotor befindet, muss nun das
Gas, oder der Dampf strö-men. Da sich der
Querschnitt verringert, ändert sich die Geschwindigkeit. Sofern Sie sich mit der Dampfmaschine befasst haben, haben Sie vermutlich auch den Injektor kennen gelernt. Dort wird der Dampf in einer Verengung beschleunigt und dieses Prinzip nutzt man hier.
Der Unterdruck sorgte
dafür, dass mehr Luft angezogen wird und sich die Turbine schneller drehen
kann. Bei der Luftfahrt wird so beschleunigt. Jedoch müssen wir uns noch
diese zahlreich vorhandenen Lamellen ansehen. Fachlich werden diese Lamellen als Schaufel bezeichnet. Sie sind dabei speziell geformt und die Form ist von den Flügeln der Propeller abgeleitet.
Bedingt durch den geschwungenen Aufbau sehen diese Bauteile
aus, wie übliche Schaufeln und daher diese Bezeichnung. Dank dem Aufbau
kann das
Gas, oder der Dampf besser daran vorbeifliessen, denn man will
diesen ja so gut es geht ausnutzen und das geht ganz gut.
Bei der auf
dem Bild zu sehenden Turbine sind einige Schaufeln ausgebrochen. Das
zeigt, wie gross die Belastung ist, denn durch den entstehenden Unterdruck
werden diese regelrecht aus dem Rotor gerissen. Das noch mit der
Fliehkraft kombiniert lässt die Kräfte erahnen. So ein Defekt kann
durchaus zur Zerstörung der Turbine führen. Für uns wird es nun aber Zeit,
das Muster für die Gasturbine kennen zu lernen.
Das Problem war, dass die
Dieselmotoren dank einer Turbine
besser funktionierten. Sie haben ihn ver-mutlich schon kennen gelernt, es
ist der
Turbolader.
Niemand
würde heute bei der Diesellokomotive eine Gasturbine einbauen. Früher war
das anders, denn die Gasturbine bot sehr viel
Leistung und war daher um
1940 den Motoren weit überlegen. Damit Sie sich ein Bild machen können,
erwähne ich hier die Leistung der ersten und einzigen Gasturbine die in
einer schweizerischen
Lokomotive eingebaut wurde. Die Leistung der Turbine
lag damals bei sagenhaften 9 000 PS.
Warum die
Lokomotive davon nur noch 2 200 PS nutzen konnte, erfahren Sie in den
folgenden Abschnitten. Aber bedenken Sie, diese Gasturbine hatte diese
Leistung im Jahre 1941, also zu einer Zeit, wo man nicht so
leistungsfähige
Dieselmotoren kannte, wie heute. Ach ja, eines muss ich zu
der Lokomotive noch erwähnen, denn sie hörte auf die Bezeichnung Am 4/6
mit der Nummer 1101 und sie war die erste Lokomotive mit einer Gasturbine.
Das natürlich weltweit gesehen.
Doch kommen
wir zur Gasturbine. Diese benötigte die gleichen Grundstoffe wie ein
Dieselmotor. Das wären Luft und
Kraftstoff und auch hier nicht viel mehr.
Bei der Gasturbine wurde der
Treibstoff
aber nicht in einem
Zylinder
verbrannt, sondern er wurde zur Erzeugung von Wärme genutzt und künstlich
entflammt. Daher lohnt es sich, wenn wir die Unterschiede zum
Dieselmotor
schnell ansehen. Nur so lernen wir die Unterschiede kennen.
Um es gleich zu erklären, 7
800 PS der Gasturbine gehen hier wieder verloren, denn der
Kompressor
versetzt die Luft in sehr hohen Druck. Das war für den Betrieb der Turbine
wichtig. Die vom Kompressor verdichtete Luft wird nun nicht weiter aufbereitet. Es gibt daher keine Ladeluftkühlung. Das wäre kontraproduktiv, denn man wollte heisse Luft und die konnte nicht heiss genug sein.
Der Grund war einfach,
denn man wollte den
Diesel
nicht in einem geschlossenen
Zylinder
verbrennten. Stattdessen sollten die heissen
Ab-gase der Verbrennung
genutzt werden. Daher musste die Luft zusätzlich erwärmt werden. Die durch den Kompressor verdichtete und erwärmte Luft wird den Luftvorwärmerrohren zugeführt. Diese Rohre hatten die Aufgabe die Wärme der heissen Abgase an die Luft zu übergeben.
Wir kennen das Prinzip dieser
Rohre, denn es handelt sich hier um einen einfachen
Wärmetauscher. Von
einem
Kühler sind wir aber weit ent-fernt, denn nun wird geheizt und zwar
die Luft für die Turbine.
Erst nach
den Luftvorwärmerohren gelangte die sehr heisse unter Druck stehende Luft
zur Brennkammer, wo der künstlich gezündete
Treibstoff
die Luft zusätzlich
erwärmt und diese dabei noch einmal beschleunigt wird. Wir werden diese
später noch etwas genauer ansehen, denn die Brennkammer sorgte dafür, dass
man etwa anderen
Treibstoff verwenden konnte. Das beschleunigt und
erhitzte
Gas wurde nun in der Turbine genutzt.
Zwar verdichtet man die Luft auch hier, danach wird sie aber erhitzt und nicht mehr gekühlt. Da es bei der Gas-turbine keine Explosionen gab, war der Schall leiser und wurde von den Leuten eher als heulen wahrgenommen.
Auch wenn ein grosser Teil der Wärme wieder an die frische Luft abgegeben wird, traten sehr heisse Abgase aus. Daher traten diese über der Lokomotive aus. Auch bei den Gasturbinen werden diese sehr heiss.
Daher sollte man sich
nicht hinter einem
Triebwerk auf-halten. Das ist nicht ratsam, da alleine
die Luftströmung so gross ist, das wir umgeweht würden. Jedoch sollten wir
uns die Funktion der Turbine ansehen.
Funktion der Gasturbine:
Wir haben den Weg der Ver-brennungsluft schon kennen gelernt. Diese wurde
verdich-tet und vorgeheizt und das galt teilweise auch für den
Kraftstoff.
Da wir nun einen Brenner und keinen Motor haben, kann hier
Heizöl
verwendet werden. Da keine Steuer erhoben wird, ist dieses billig und das
war sehr wichtig, denn eine Gasturbine ist ausgesprochen durstig und das
ergäbe bei
Dieselöl sehr hohe Kosten.
Der
Kraftstoff und somit das verwendete
Heizöl, wurde in der Brennkammer
künstlich gezündet. Der
Treibstoff verbrannte dabei mit der vom
Kompressor
zugeführten Luft. Da nun eine stetige Flamme entstand, wurde die immer
frisch zuströmende Luft weiter erhitzt und der Sauerstoff verbrannt. Dabei
wurden die entstehenden
Abgase in der Brennkammer weiter beschleunigt und
nun der eigentlichen Gasturbine zugeführt.
Auch wenn bei unserem Muster Heizöl verwendet wurde, in der Brennkammer kann nun alles ver-brannt werden. Das können auch Gase sein.
Der Name kommt von
den beschleunigten und erhitzen
Gasen, daher gibt es keinen Unterschied,
auch wenn der
Treibstoff geändert wird. Die heissen Abgase wurden durch Räder mit den Schaufeln gedrückt und dabei noch einmal be-schleunigt. Durch die auf die Schaufeln wirkenden Kräfte begann die Turbine sich zu drehen.
Bei der
Lokomotive wurde mit dieser Drehung der
Turbine der
Kompressor und auch ein
Generator angetrieben. Jedoch kann das
besser an einem Flugzeug erklärt werden, denn die Mantelstrom-triebwerke
haben die gleiche Gasturbine.
Hier
erzeugen die
Abgase aus der Gasturbine einen nach vorne gerichteten Schub.
Jedoch treibt diese einen
Ventilator an. Dessen Luft wird zu einem Teil
der Turbine zugeführt. Jedoch strömt ein grosser Teil der Luft an dieser
vorbei und erzeugt ebenfalls einen Schub. Da hier alle Kraft dem Vorschub
dient, haben diese
Triebwerke eine sehr hohe
Leistung und die reicht um
ein Flugzeug in der Luft zu halten.
Nach der
Gasturbine gelangten die
Abgase zu den Luftvorwärmerrohren, wo sie die
Luft vom
Kompressor vorwärmten. Danach erhitzten die heissen Abgase noch
den
Kraftstoff. Nun war die Arbeit getan und die Abgase gelangten durch
eine Öffnung ohne weitere Nachbereitung in die Umwelt. Viel mehr kann
eigentlich nicht zur Funktion der Gasturbine gesagt werden, denn sie war
wirklich simpel einfach, denn
Kühlungen gab es auch nicht.
Elektrische Maschinen erreichten diese hohen Wer-te nur mit
gigantischen
Lokomotiven wie der
Baureihe
Re 6/6. Trotzdem konnte hier
diese gigan-tische
Leistung nicht voll ausgenutzt werden. Das führte zu
einem schlechten Wirkungsgrad. Der grösste Teil der Leistung ging für die Verdich-tung der Luft verloren. Der Kompressor musste die Luft sehr hoch verdichten. Daher hatte er eine Leis-tung, die letztlich nur noch 2 200 PS für den Antrieb übrig liess.
Nur, was waren 1941 diese 2 200 PS der
Lokomo-tive wert? Dazu müssen wir
eine vergleichbare Maschine mit einem
Dieselmotor aus der damaligen Zeit
suchen. Meine Wahl fiel auf die Lokomotive vom Typ Am 4/4.
Die zum
vergleich genommene
Lokomotive mit
Dieselmotor hatte rund die halbe
Leistung und war daher damals schon eine sehr leistungsfähige
Die-sellokomotive. Auch wenn sie damit im Rückstand lag, hatte sie einen
Vorteil. Der Verbrauch beim
Treibstoff war deutlich geringer als bei
Gasturbine. Diese war wirklich durstig und die Betriebskosten trotz dem
Heizöl immer noch höher, als bei einem Dieselmotor, der sparsam ist.
Da beim
Starten die Gasturbine zuerst auf
Touren kommen muss, dauert es relativ
lange, bis sie die volle
Leistung entwickelte. Der Grund findet sich im
Abbau, denn der langsam drehende
Kompressor erzeugt nur einen geringen
Druck und die
Abgase sind noch kühl und erwärmen die Luft noch nicht so.
Das heisst, die Gasturbine muss zuerst vorgewärmt werden und dies erfolgt
mit zunehmendem Betrieb. Sie beginnt sich daher immer schneller zu drehen.
Das
wurde mit zunehmender Drehzahl immer lauter und so zu einem Heulen
überging. So heulte die
Lokomotive durch die Gegend. Diese Geräusche
kennen Sie, denn die Turbinen bei der Luftfahrt haben immer noch diese
Geräusche.
Damit man die Gasturbine nicht beim Rangieren in den
Bahnhöfen
starten
musste, baute man einen Hilfsdiesel ein. Das ist ein normaler
Dieselmotor,
der für diesen Zweck eingebaut wurde. Die
Lokomotive konnte daher zwischen
der Gasturbine und dem Dieselmotor des Hilfsdiesels wählen. Hilfsdiesel
kommen heute sogar bei elektrischen
Lokomotiven zum Einsatz. Sie
ermöglichen dort Fahrten ohne
Fahrleitung.
Doch die
erste
Lokomotive mit einem Hilfsdiesel hatte eine Gasturbine. Da wir mit
dem
Dieselmotor wieder einen Motor haben, musste die vorgestellte
Lokomotive auch noch
Dieselöl mitführen, denn wir wissen mittlerweile, das
für deren
Treibstoffe Steuern erhoben werden. Auch das machte es nicht
leicht, besonders wenn aus Versehen auch bei der Gasturbine Dieselöl statt
Heizöl in den
Tank gefüllt wurde.
Die weiteren
Unterschiede beim Starten und regeln der Gasturbine im Vergleich zum
Dieselmotor sind im nachfolgenden Kapitel berücksichtigt. Jedoch können
Sie mir jetzt schon glauben, eine Gasturbine wurde kaum geregelt und so
lässt sich dann nur noch eine Lösung beim effektiven
Antrieb
vermuten.
Aber auch das behandeln wird noch. Doch wie heisst es in Autorennen immer
wieder? «Gentlemen starten Sie die Motoren».
|
|||||
| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | |||
| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | |||
| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | |||
| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | |||
| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | |||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||
 Bevor
wir die wenigen Lösungen der Eisenbahn anhand eines Musters ansehen, sehen
wir die Modelle der Luftfahrt kurz an. Die Gasturbine ist dort nur ein
Teil des
Bevor
wir die wenigen Lösungen der Eisenbahn anhand eines Musters ansehen, sehen
wir die Modelle der Luftfahrt kurz an. Die Gasturbine ist dort nur ein
Teil des
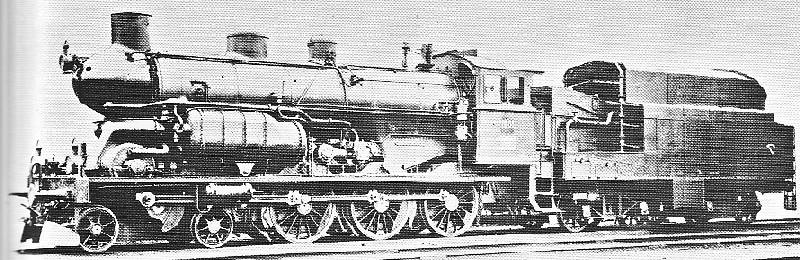 Ich
verbleibe dabei in der Schweiz, denn diese Exoten weltweit zu suchen ist
recht schwer. Das Modell stand bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB
im Einsatz und es war eine
Ich
verbleibe dabei in der Schweiz, denn diese Exoten weltweit zu suchen ist
recht schwer. Das Modell stand bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB
im Einsatz und es war eine
 Bei der auf
dem Bild gezeigten Turbine handelt es sich nur um den rotierenden Teil.
Dieser wird einfach ausgedrückt in einem Rohr eingebaut. Wir haben eine
der meisten Bauformen erhalten.
Bei der auf
dem Bild gezeigten Turbine handelt es sich nur um den rotierenden Teil.
Dieser wird einfach ausgedrückt in einem Rohr eingebaut. Wir haben eine
der meisten Bauformen erhalten.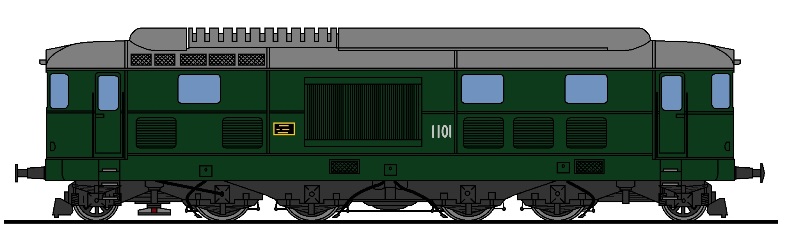 Die Lokomotive
Die Lokomotive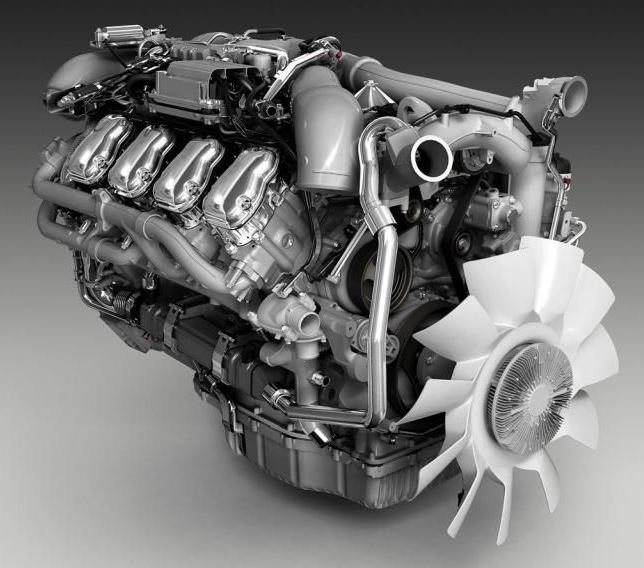 Unterschiede zum Dieselmotor
Unterschiede zum Dieselmotor Eine
Aufbereitung der
Eine
Aufbereitung der 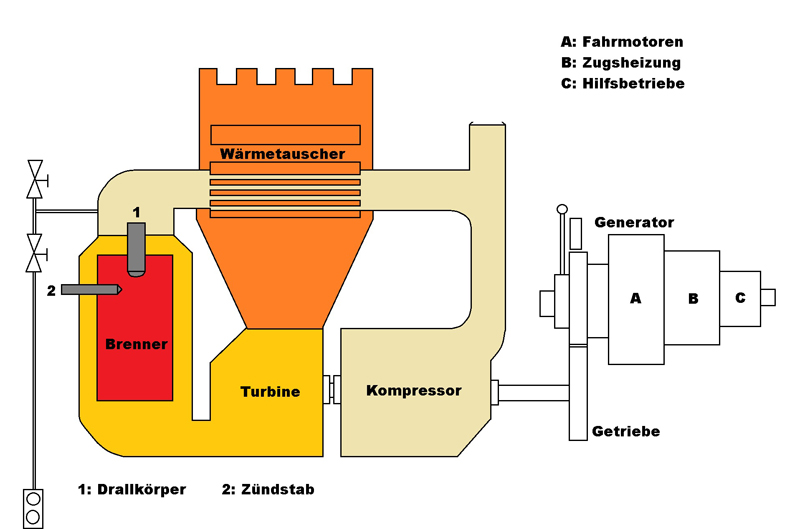 Der Brenner,
welcher der Brennkammer den Namen gab, war ausgerichtet worden. Es wurde
in jedem Punkt darauf geachtet, dass die Luft beschleunigt wurde.
Der Brenner,
welcher der Brennkammer den Namen gab, war ausgerichtet worden. Es wurde
in jedem Punkt darauf geachtet, dass die Luft beschleunigt wurde. Leistung der Gasturbine
Leistung der Gasturbine