|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Damit aus dem bisher vorgestellten Aufbau ein Fahrzeug wurde,
musste dieses auf ein
Fahrwerk
abgestellt werden. Dabei gab es grundsätzlich zwei Lösungen. Wegen den
Achslasten
und der Länge des Fahrzeuges konnten jedoch keine fest im Rahmen
eingebaute
Achsen
verwendet werden. Damit kam es zur Lösung mit den bei längeren
Reisezugwagen
durchaus üblichen
Drehgestellen. Diese müssen wir uns jedoch ansehen.
Nicht nur, dass dies in der Regel so üblich ist. Bei diesen drei
Triebwagen
gab es nur in diesen einen
Antrieb.
Inwieweit sich das zweite
Drehgestell
davon unterschied, wird natürlich er-wähnt werden. Für den Aufbau der Drehgestelle zeigte sich die Firma Schindler Waggon Schlieren SWS verantwortlich. Hier konnte man schon mit den neusten Reisezugwagen die notwendigen Erfahrungen sammeln.
Daher verwundert es eigentlich nicht, dass viele Merkmale von
diesen Modellen genommen wurden. Auch wenn man damals nicht von einem
Baukasten sprach, die Hersteller nahmen oft bekannte Teile und passten
diese an.
Das
Drehgestell
bestand aus einem aus Blechen und Gussteilen geformten Rahmen. Auch hier
wurden die einzelnen Bauteile mit der Hilfe von
Nieten
verbunden. Es wurde hier mit warm geschmiedeten Nieten gearbeitet. Der
Vorteil dabei war, dass diese bei der Abkühlung schrumpften. So wurde eine
kräftige und formschlüssige
Verbindung
möglich. Bei einem Drehgestell war dies wichtig, damit nur so auch die
erforderliche Stabilität entstand.
Aufgebaut wurde der
Drehgestellrahmen
als geschlossenes H. Daher wurden die beiden Längsträger in der Mitte mit
den Hauptträger verbunden. Damit die so entstandenen Wangen eine genügende
Stabilität hatten, wurden deren Enden mit jeweils einen Stirnträger
verbunden. Es war so ein üblicher Aufbau von solchen
Laufwerken
entstanden zu ersten Unterschieden zu den damals aktuellen Wagen für
Reisezüge
kam bei den
Achsen.
Daher wurden am
Drehgestellrahmen
zwei
Schienenräumer
montiert. Diese waren nur gegen die äussere Seite des Fahrzeuges
vorhanden. Zudem ent-sprachen sie den üblichen Modellen. Es mussten daher
in diesem Punkt keine neuen Ersatzteile angeschafft werden. Ein Radsatz bestand aus der geschmiedeten Achse und den beiden im üblichen Abstand auf die Sitze geschrumpften Rädern. Dank dieser formschlüssigen Montage konnten die Räder im Unterhalt auch von der Achse getrennt unterhalten werden.
Die auf der
Achse
zusätzlich noch vorhandenen Sitze für die
Lager
befanden sich aussen. Bevor wir aber zu den Lagern kommen, müssen wir uns
die bei-den
Räder
genauer ansehen.
Es wurden
Speichenräder
bestehend aus dem
Radkörper
und der aufge-zogenen
Radreifen
verwendet. Obwohl man damals bei den
Reisezugwagen
bereits auf die besseren
Scheibenräder
umgestellt hatte, konnten diese hier nicht verwendet werden. Der Grund
dafür lag beim hohen Gewicht des Fahrzeuges. Man musste beim Bau Gewicht
sparen, wo man nur konnte. Die
Räder
mit der ungefederten Masse waren dazu ideal.
Das
Rad
hatte mit der
Bandage
einen Durchmesser von 1 100 mm. Das war ein Wert, der auch bei
Reisezugwagen verwendet wurde. Die gemachte Angabe bezog sich jedoch auf
den halb abgenützten
Radreifen. Das war so üblich, da die Bandage mit der
Lauffläche und dem
Spurkranz einem Verschleiss unterworfen war. Daher
konnte sie im Unterhalt auch getrennt vom restlichen Rad bearbeitet
werden. Wobei das oft bei den Herstellern erfolgte.
Dieses Metall hatte schon
früher gezeigt, dass es über eine gute Schmiereigenschaft verfügte. Jedoch
waren die so aufgebauten
Lager auch sehr anfällig auf zu gros-se Wärme. Im
schlimmsten Fall konnten sie schmelzen. Um dies zu verhindern musste die Reibung verringert werden. Dazu wurde über Kanäle in der Lagerschale das Schmiermittel zugeführt. Wie bei solchen Lagern damals üblich wurde eine Sumpfschmierung mit Öl verwendet.
Das Schmieröl reduzierte die
Reibung, führte aber auch die trotzdem noch entstehende Wärme ab. Dabei
wurde das
Öl aus dem
Lager getrieben und gelangte so un-weigerlich ins
Schotterbett.
Daher musste ein Vorrat
mitgeführt werden. Da man hier wegen den
Drehgestellen nicht auf eine
damals durchaus bekannte
Schmierpumpe setzen konnte, muss-te die Lösung der
Wagen benutzt werden. Daher war bei jedem
Lager ein Behälter vorhanden.
Dieser war mit einem Deckel verdeckt worden und er konnte so jederzeit
nachgefüllt werden. Solche Lösungen kamen bei
Triebfahrzeugen bei den
Tendern zur Anwendung.
Die beiden
Achslager wurden im
Rahmen in den jeweiligen Achslagerführungen gehalten. Diese Führungen
liessen jedoch nur zu, dass sich das
Lager und damit die
Achse in der
senkrechten Richtung frei bewegen konnte. Sowohl seitlich, als auch in der
Längsrichtung gab es keine merkliche Bewegung. Man sprach in diesem Fall
von einer starren Führung und diese war damals auch bei den mit
Drehgestellen versehenen Wagen üblich.
Durch diesen Aufbau haben wir
jedoch ein weiteres
Gleitlager erhalten. Dieses lineare
Lager hatte keine
speziellen
Lagerschalen und arbeitete daher Stahl auf Stahl. Das ging,
weil hier die Bewegungen nicht so schnell erfolgten. Trotzdem auch hier
musste geschmiert werden. Dazu verwendete man jedoch
Fett. Das hatte den
Vorteil, dass es nur im Unterhalt erneuert werden musste und, dass es
nicht so schnell ausgewaschen wurde.
Um die während der Fahrt
auftretenden
Stösse und Schläge nicht auf den Rahmen des
Drehgestells zu
übertragen, mussten die
Achsen abgefedert werden. Dazu wurde bei jedem
Achslager eine
Feder vorgesehen. Wobei wir nicht von einer einzelnen Feder
sprechen dürfen. Es kam hier eine kombinierte
Federung zur Anwendung. Die
Betrachtung dieser Lösung müssen wir jedoch nicht bei der Achse, sondern
im Rahmen beginnen.
Diese besassen jedoch
weder
Dämpfer noch waren sie mit dem
Achslager verbunden. Das erfolgte
erst mit dem zweiten Teil der
Federung und hier wur-den
Blattfedern
verwendet. Damit befand sich diese über dem
Lager. Bei dieser Federung machte man sich die Eigen-schaften der beiden Federn zu Nutze. So fing die Blattfeder die Stösse und Schläge auf. Dazu war sie mit der langen Schwingungsdauer ideal geeignet.
Jedoch konnten diese Federn die feinen Vibra-tionen, die
bei höheren Geschwindigkeiten auf-traten nicht auffangen. Dazu wurde nun
der zweite Teil genutzt, denn hier wirkten nun die
Schrauben-federn und
bauten auch diese ab.
Damit es nicht zu einer
gefürchteten Entlastung eines
Radsatzes und damit zu einer
Diese
Federung mit zwei
unterschiedlichen Typen war sehr fein ausgefallen. Bei diesem Fahrzeug war
das wichtig. Daher betrachten wir die Abstützung vor der Ausrüstung mit
den
Antrieben. Auch hier gab es zwischen den beiden
Drehgestellen keinen
Unterschied, den wir beachten müssten. Dabei stütze sich der Kasten mit
Gleitplatten auf dem
Drehgestellrahmen ab. Diese Platten mussten jedoch
zur Verminderung der Reibung ebenfalls geschmiert werden.
Diese Gleitplatten gaben dem
Kasten eine gewisse Stabilität. Und damit haben wir das Fahrzeug auf sein
Laufwerk gesetzt. Dabei gab es bei der Höhe zu den anderen Fahrzeugen
einen Unterschied. Die Masse wurden beim
Triebwagen
über die Bügel
gemessen. Diese waren dabei gesenkt. Die Nachmessung ergab hier mit 4 410
mm einen üblichen Wert. Wobei dieser das neue
Lichtraumprofil für Strecken
mit einer
Fahrleitung einhalten musste.
Auch wenn der Kasten abgestützt
wurde, das
Drehgestell musste zusätzlich noch eingebaut werden. Dazu wurde
unter dem Wagenkasten ein
Drehzapfen
montiert. Dieser griff im Bereich des
Hauptträgers in den
Drehgestellrahmen. Dort endete der Zapfen in eine
entsprechend ausgeführte Pfanne. Diese war so gestaltet worden, dass der
Drehzapfen darin gehalten war. Der Kasten konnte somit auch nicht vom
Laufwerk fallen.
Jedoch war keine feste
Verbindung vorhanden. Das
Drehgestell konnte sich in der Längsrichtung
bewegen und so auch abknicken. Das war wichtig, weil nur so
Kuppen und
Senken befahren werden konnten. Auch das seitliche Abknicken liess der
Drehzapfen
zu. Dieser Effekt wurde aber durch die zuvor vorgestellte
Abstützung verhindert. Die Verwindungen im
Geleise mussten daher zusätzlich
auch vom Kasten aufgenommen werden.
Sowohl der
Drehzapfen, als auch
die Gleitplatten mussten geschmiert werden. Hier wurde dazu eine
Schmierung mit
Öl vorgesehen. Der Grund dafür lag in der Tatsache, dass
dieses nicht so anfällig auf Verschmutzungen war, wie das bei den
Fetten
der Fall war. Gerade beim präzise gefederten Drehzapfen war das wichtig.
Die Platten hätten auch anders geschmiert werden können, doch auch hier
war das
Schmiermittel ideal.
Wenn Sie nun die zweite
Federstufe vermissen, diese gab es hier schlicht nicht mehr. Damals waren
solche Lösungen selten und sie kamen auch nur bei den neuen Wagen des
Fernverkehrs zur Anwendung. Der
Triebwagen
gehörte jedoch nicht dazu und
dank der guten
Federung der einzelnen
Achsen, war die Fahrt nicht nur
unangenehm. Wobei viel Komfort durfte der Reisende in diesem Fahrzeug wohl
nicht erwarten.
Bisher waren die beiden
Drehgestelle identisch aufgebaut worden. Sie haben daher nichts verpasst.
Das bedeutet aber auch, dass bei allen vier
Achsen des Fahrzeuges auch der
Einbau eines
Antriebes möglich war. Das war im
Pflichtenheft vorgesehen,
konnte jedoch wegen dem Gewicht des
Triebwagens nicht wunschgemäss
umgesetzt werden. Daher müssen wir zuerst sehen, wo denn die Antriebe
eingebaut wurden und hier hilft die
Achsfolge.
Daher erklärt sich nun auch meine Wahl ganz am Anfang, als ich mich für
das
Drehgestell eins entschieden habe. Dieses müssen wir uns daher noch
weiter ansehen und den Antrieb einbauen. Die
Achsfolge besagt dabei auch,
dass eine
Achse ausreichend ist. Jede Achse verfügte über einen eigenen Fahrmotor. Dabei können wir be-haupten, dass hier für die damalige Zeit ein unüblicher Einzelachsantrieb ver-baut wurde.
Dabei wurde der
Fahrmotor
zwischen der von ihm angetriebenen
Achse und dem Hauptträger des
Drehgestells eingebaut. Der dazu verfügbare Platz führte jedoch dazu, dass
beim Motor die Baugrösse verringert werden musste. Das wirkte sich auch
die verfügbare
Zugkraft aus.
Abgestützt wurde der
Triebmotor
sowohl im Rahmen, als auch auf der
Achse. Damit bei dieser die Federung
durch den Motor nicht funktionslos wurde, musste dieser gegenüber dem
Rahmen ebenfalls abgefedert werden. Diese
Federung erfolgte mit speziellen
Elementen aus Gummi, die auf am
Drehgestellrahmen vorhandenen Tatzen
abgestützt wurden. Wegen dieser Bauweise der Abstützung wurde bei dieser
Lösung von einem
Tatzlagerantrieb gesprochen.
Das im
Fahrmotor erzeugte
Drehmoment wurde über das angebaute
Getriebe auf die
Achse übertragen.
Dabei hatte dieses Getriebe eine
Übersetzung von
1 :
5.6 erhalten. Dabei
wurde das Drehmoment so umgewandelt, dass sich die Drehzahl Achse
verringerte. Während das Ritzel fest an der Motorwelle befestigt wurde,
war das
Zahnrad auf der Achse befestigt worden. Das Moment, wurde somit
ohne weitere Massnahme übertragen.
Am unteren Rand der Umhüllung wurde eine
Ölwanne ange-baut. In
dieser lagerte das
Schmiermittel, das den
Ölen der
Lager entsprach. Eine
weitere Lösung war jedoch nicht mehr vorhanden, so dass wir genauer
hinsehen. Das grosse Zahnrad lief durch das Schmiermittel und nahm dieses auf. Dank den guten Hafteigenschaften des Öls ging das gut. Durch die Drehung gelangte so das Mittel auch auf das Ritzel, so dass dieses auch geschmiert wurde.
Durch die hohe Drehzahl
wurde das
Schmiermittel jedoch weggeschleudert und lief an den Wänden
wieder in die Wan-ne. Die so aufgebaute Lösung war so gut, dass sie seither
nahezu unverändert angewendet wird. Das so auf die Achse übertragene Drehmoment wurde schliesslich im Triebrad mit Hilfe der Haftreibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zugkraft umgewandelt.
Diese wiederum
gelangte über die
Achslager auf die Führ-ungen und so in den Rahmen des
Triebdrehgestells. Dort verbanden sich die Kräfte der beiden
Triebachsen und
bündelten sich im
Drehzapfen. Ab dort erfolgte die Übertragung durch den
Rahmen zu der hinteren
Zugvorrichtung.
Es war daher ein simpel
einfacher Kraftfluss vorhanden, wobei der Kasten hier zur Übertragung der
Zugkraft mitbenutzt werden musste. Auch hier gilt jedoch der Passus, dass
nicht benötigte Zugkraft in einer Beschleunigung resultierte. Wie sich
diese Werte genau präsentieren, erfahren wir, wenn wir den elektrischen
Teil ansehen. Hier wollen wir etwas vorgreifen und den
Triebwagen
auf die
Waage stellen, denn dort gab es eine Überraschung.
Die
Achslast beim angetriebenen
Drehgestell wurde mit 16 Tonnen angegeben. Diese reduzierte sich beim
Laufdrehgestell um 3.8 Tonnen. Dieses Gewicht der
Fahrmotoren mit den
Antriebes
war dort ja nicht vorhanden. Daher war dort noch eine Achslast von 12.8
Tonnen gemessen worden. Der
Triebwagen
hatte daher keine ausgeglichen
Werte erhalten. Das war jedoch wegen den Antrieben zu erwarten, doch war
da noch das
Pflichtenheft.
Im
Pflichtenheft wurden vier
angetriebene
Achses gefordert. Gleichzeitig wurde aber auch verlangt, dass
eine
Achslast von 16 Tonnen nicht überschritten werden konnte. Das wäre
mit zwei weiteren
Triebmotoren
und deren
Antrieben auch nicht passiert. Jedoch hätten diese
zusätzliche elektrische Bauteile erfordert und diese hätten dazu geführt,
dass die verlangten Lasten überschritten worden wären. Damit reduzierte
man die Anzahl Motoren.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
beiden
Die
beiden 
 Eingebaut wurden die beiden
Eingebaut wurden die beiden
 Neben den jeweiligen
Neben den jeweiligen
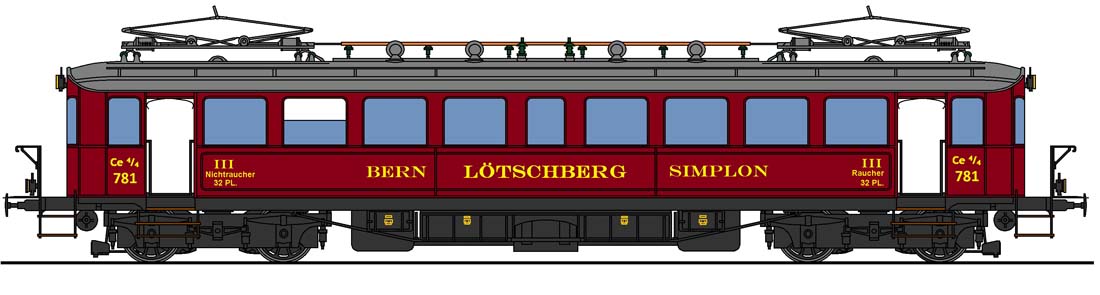
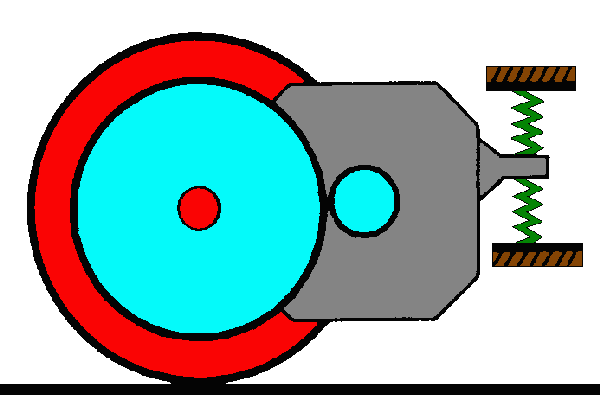 Angegeben wurde die
Angegeben wurde die
 Um das
Um das