|
Der Wagenkasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
So einfach, wie das vorhin dargestellt wurde, war die
Angelegenheit auch wieder nicht. Die damals gebauten
Personenwagen
waren vom Aufbau her zu schwach. Der Grund war, dass in einem
angetriebenen Fahrzeug andere Kräfte entstehen und auch, dass durch die
elektrische Ausrüstung mehr Gewicht getragen werden musste. Für die Firma
Schindler Waggon Schlieren SWS bedeutete das, dass neue Lösungen umgesetzt
wurden.
Der Grund ist ganz simpel, denn es muss ein Platz für den
Lokführer geschaffen werden. Dieser sollte mit Vorteil am Ende des
Fahrzeuges angeordnet werden.
Wie bei jedem Fahrzeug musste ein tragendes Teil erstellt werden.
Bei den Wagen mit
Drehgestellen war das ein einfacher Rahmen. Dieses
Bauteil wurde auch beim Kasten für den
Motorwagen
verwendet. Dabei wurden die einzelnen Stahlbleche mit der Hilfe von
Nieten
verbunden. Eine Bauweise, die damals üblich war und die keine ausreichend
tragende Rahmen ergab. Auch wenn hier viele Verstärkungen angebracht
wurden, änderte sich dies nicht.
Um die Stabilität des Rahmens zu verbessern, musste dieser
verspannt werden. Zu diesem Zweck baute man eine Abzugsvorrichtung ein.
Dieses
Sprengwerk
bestand aus einfachen Profilen, welche vom Rahmen diagonal nach unten
gezogen wurden. Auf etwa halber Höhe zur Oberkante der
Schiene
wurden diese beiden Profile verbunden. Die Abstützung dieser
Verbindung
erfolgte mit senkrechten Streben an drei Stellen.
Wurde nun auf den Rahmen von oben eine Kraft ausgeführt, drückte
sich dieser nach unten. Das führte dazu, dass im Abzug eine Veränderung
der Länge entstand. Durch den Aufbau, konnte diese jedoch nicht umgesetzt
werden. Die Kräfte wurden so auf den restlichen Rahmen übertragen und die
Tragfähigkeit der Konstruktion war damit gegeben. Eine Lösung, die bei
Wagen verwendet wurde und die hier einfach verstärkt wurde.
Eine Massnahme, die durchaus gewählt wurde, um das Gewicht des
Fahrzeuges zu verringern. Jedoch konnten so die entstehenden Kräfte nicht
optimal aufgenommen werden. Mittig wurden die Zugvorrichtungen im Rahmen montiert. Damit die hier auf das Fahrzeug übertragenen Kräfte besser im Kasten verteilt wurden, waren im Rahmen spezielle Profile vorhanden.
Zudem wurde der
Zughaken,
in seiner Aufnahme gefedert gelagert. Diese
Federung
sorgte dafür, dass sich der Haken lediglich in der Fahrrichtung verändern
konnte. So wurden die
Zugkräfte
im Rahmen zusätzlich reduziert. Ergänzt wurden die Zugvorrichtung mit den am Zughaken montierten Bauteilen. Im Regelfall wurde die Schraubenkupplung nach den Normen der UIC benutzt. Mit der Spindel konnte sie in der Länge verstellt werden.
Jedoch war deren Belastung sehr gross und daher wurde am
Zughaken
auch noch eine
Notkupplung
montiert. Diese wiederum bestand aus einem einfachen Bügel, der in der
Länge nicht verändert werden konnte.
Diese Baugruppen konnten die
Zugkräfte
optimal in den Rahmen übertragen, jedoch versagten sie komplett, wenn
Stosskräfte
auftragen. Um diese auch ideal in den Rahmen übertragen zu können, wurden
seitlich die beiden
Stossvorrichtungen
montiert. Diese bestanden aus dem damals üblichen
Stangenpuffer
und den runden
Puffertellern.
Wobei bei den Tellern einer gewölbt und der andere flach ausgeführt wurde.
So konnten am
Triebwagen
übliche mit den Einrichtungen nach
UIC
ver-sehenen Fahrzeuge gekuppelt werden. Das
Pflichtenheft
war somit in diesem Punkt eingehalten worden. Bevor wir nun zum Kasten selber und die anderen Aufbauten kommen, können wir noch die Länge bestimmen. Bei Fahrzeugen mit Stossvorrichtungen nach UIC wurde diese immer als Länge über Puffer angegeben.
Auch wir greifen nun zum Messband. Mit einem Wert von 20 500 mm
war der
Triebwagen
eher kurz ausgefallen, jedoch hätte ein längeres Fahrzeug durch-aus auch
mehr Gewicht bedeutet. Man musste Kompromisse eingehen.
Soweit können wir den Rahmen abschliessen. Die nun vorgestellten
Bau-gruppen wurden entweder darauf aufgebaut, oder unter diesem
aufgehängt. Da wir die aufgehängten Teile später noch genauer betrachten,
lassen wir diese hier weg. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass keine
der Baugruppen an der Übertragung der
Zugkräfte
beteiligt war. Das werden wir schnell erkennen, wenn wir den Kasten des
Motorwagens
ansehen.
Für den Aufbau des Kastens wurde ein Gerüst erstellt. Dieses war
eine Arbeit der Zimmerleute. Sie haben richtig gelesen, der
Triebwagen
hatte einen Kasten aus
Holz
erhalten. Damit entsprach er den anderen
Reisezugwagen.
Das mit Balken aufgebaute Gerüst wurde versteift und die einzelnen
Baugruppen mit den im Holzbau üblichen Methoden verbunden. Auch hier
musste jedoch gegenüber einen Wagen verstärkt gebaut werden.
Da nun aber die Stahlbleche nicht überlappend eingebaut wurden, waren auch hier die bekannten Nietenbänder vorhanden.
Dieser sorgten dafür, dass mit der Schrauben das Blech nur
eingeklemmt wurde. Daher konnte sich auch diese Verblechung anpassen. So leicht dieser Aufbau vielen Lesern erscheinen mag, so überraschend schwer war er. Das Gewicht des Daches war wegen den dort aufgebauten Stromabnehmern sehr hoch und so mussten, um dieses zu tragen, kräftige Balken verwendet werden.
Diese hatten jedoch, wie das Blech ein recht an-sehnliches
Gewicht. Jedoch knackte und knirschte es im Gebälk, wenn der
Triebwagen
auf die grosse Reise geschickt wurde. Doch noch sind wir nicht soweit.
Der Grundaufbau des Fahrzeuges war symmetrisch. In der Mitte des
Motorwagens
wurde die Anordnung gespiegelt. Das hilft uns nun weiter, denn wir müssen
somit nur das halbe Fahrzeug betrachten. Alle nicht erwähnten Punkte, sind
deshalb auch auf der anderen Seite vorhanden. Ein Aufbau, der bei
Triebwagen
und
Lokomotiven
sehr oft verwendet wurde. Der
Wagenbauer
machte sich schliesslich das Leben auch nicht unnötig schwer.
Wir beginnen die Betrachtung beim
Stossbalken,
beziehungsweise bei dem Träger zur Aufnahme der Zug- und
Stossvorrichtungen.
Auf diesem wurde die bei Wagen übliche
Plattform
aufgebaut. Jedoch diente diese hier nur dem Bahnpersonal. Damit diese gut
stehen konnte, wurden die Träger des Rahmens in diesem Bereich mit einem
einfachen Blech abgedeckt. Es entstand so eine Standfläche, die bei Nässe
sehr rutschig war.
So wurden auf beiden Seiten Aufstiege montiert. Diese bestanden
aus einer steilen Treppe, die mit Holzbrettern versehen war und den beiden
seitlich benötigten
Griffstangen.
Der Aufbau entsprach da-her den Modellen von
Güterwagen. Jedoch konnte die Plattform auch von einem ange-hängten Reisezugwagen betreten werden. Dazu war über dem Zughaken ein Übergangsblech vor-handen. Dieses war, sofern es nicht benutzt wurde, hochgeklappt worden.
Damit war es nun auch möglich, die
Plattform
während der Fahrt zu betreten. Damit der Zugang nicht zu einem Tanz mit
dem Leben wurde, mon-tierte man auch hier
Griffstangen
und gegen Ende des Fahrzeuges ein Geländer.
Es bleibt nur noch der vierte Zugang. Dieser wurde vom
Zugpersonal
benutzt, wenn dieses bei der damals durchaus üblichen Kontrolle von einem
Wagen in den
Triebwagen
wechseln wollte. Da während der Fahrt nicht abgestiegen werden konnte, war
in der
Front
des
Führerstandes
eine Türe vorhanden. Diese war seitlich verschoben, so dass die
Plattform
auch dazu genutzt wurde, um zur Seite zu wechseln.
Wir können die vordere
Plattform
abschliessen und zum
Führerstand
wechseln. Dieser wurde als einfache Kabine ausgeführt und er beinhaltete
den Arbeitsplatz des Lokführers. Dabei unterteilte sich diese
Führerkabine
in die beiden Seitenwände und die gerundete
Front.
Wobei korrekt in diesem Bereich nicht von einer Rundung gesprochen werden
durfte. Es lohnt sich daher, wenn wir uns diese Partie genauer ansehen.
Diese stand im rechten Winkel zur
Achse
des Fahrzeuges. In der oberen Hälfte war das
Frontfenster
eingebaut worden und es nahm nahezu die komplette Breite der Wand in
Anspruch. Eine Lösung, die zu schmalen Säulen in diesem Bereich führte. Das Fenster hatte annähernd quadratische Abmessungen erhalten. Beim Aufbau der Scheibe griff man auf die schon bei den Reisezugwagen für die Seitenfenster benutzten Gläser zurück.
Diese waren gehärtet worden, damit sie bei den Vibrationen nicht
brechen konnten. Kam es trotzdem zu einem Bruch der Scheibe, entstanden
keine scharfkantigen Scherben. Ein Vogel konnte diese Scheibe jedoch
durchschlagen, so dass kaum ein Schutz vorhanden war. Bei nasser Scheibe war die Sicht behindert. Damit diese verbessert werden konnte, wurde am oberen Rand ein Scheibenwischer eingebaut. An einem ein-fachen Arm wurde dazu eine Gummilippe befestigt.
Diese Einrichtung konnte dann von Hand über die Scheibe bewegt
werden. Dazu war im
Führerstand
ein Handgriff montiert worden. Da auch das nachfolgend vorgestellte
Element so einen
Scheibenwischer
hatte, war das Personal beschäftigt.
Zwischen den beiden Seiten des Fahrzeuges gab es bei der Kante zur
seitlichen Partie einen Unterschied. Nur auf einer Seite es Fahrzeuges war
die
Dachleiter
vorhanden. Diese konnte bei Bedarf ausgeklappt werden. So war der Zugang
zum Dach ohne Probleme möglich. Eine Vorrichtung, die vor den Gefahren der
Spannung
in der
Fahrleitung
gewarnt hätte, gab es jedoch nicht. Daher durfte die Leiter nur in
bestimmen Fällen genutzt werden.
Jedoch gab es bei der
Dachleiter
eine einfache Schutzvorrichtung. Diese bestand aus einem
Ventil.
Wurde die Leiter ausgeklappt, öffnete sich dieses Ventil. Damit strömte
Druckluft
in eine an der oberen Kante montierte
Pfeife.
Waren die beiden
Stromabnehmer
gehoben, wurde die Pfeife aktiviert. Mit anderen Worten, die Bügel mussten
gesenkt sein, wenn man über diese Leiter auf das Dach des
Triebwagens
gelangen wollte.
In Fahrrichtung gesehen rechts wurde eine weitere
Frontwand
aufgebaut. Sie entsprach der zuvor vorgestellten Ausführung. Jedoch wurde
sie nach aussen hin in einem Winkel nach hinten gezogen. Von vorne
betrachtet erschien sie deshalb schmaler, auch wenn die Breite etwa dem
mittleren Teil entsprach. Wir haben somit identische Wände, die jedoch in
einem anderen Winkel aufgebaut wurden und das galt auch für die Türe.
Links von der Mittelpartie war dann die Türe zur
Plattform
eingebaut worden. Das Wandsegment hatte die Breite der zuvor vorgestellten
Wand, jedoch wurde hier eine Fronttüre eingebaut und das führte dazu, dass
die Säule optisch breiter wurde, als das bei den anderen Kanten der Fall
war. Auch in der Türe war aber ein Fenster eingebaut worden. Es handelte
sich um das einzige Fenster in der
Front,
das nicht mit einem
Scheibenwischer
versehen wurde.
Diese nach aussen öffnende Türe hatte einen Vorteil, denn bei der
Fahrt wurde sie durch den Fahrtwind gegen das Schloss gedrückt und konnte
sich somit nicht ungewollt öffnen. Das war jedoch nur dank der
Plattform
mög-lich geworden. Fehlen uns eigentlich zum Abschluss der Frontpartie nur noch die beiden Ecken. Diese waren auf beiden Seiten, wie die Seitenwand, identisch ausgeführt worden. Wir können uns daher auf eine Seite beschränken.
In der gerundeten Ecke war kein Fenster eingebaut worden. Daher
entstand in diesem Bereich ein recht grosser toter Winkel. Bei
Triebfahrzeugen
der Eisenbahn war dies jedoch kein so grosses Problem. Die Seitenwand ergab sich, weil für das Fahrpersonal der Platz geschaffen werden musste. Es war eine einfache Wand und sie hatte oben ein Fenster erhalten. Soweit entsprach sie der Front.
Jedoch konnte hier das Fenster geöffnet werden. Es war ein
Senkfenster,
das mit Schrauben im geschlossenen Zustand gehalten wurde. Der später in
der Schweiz bei solchen Fenster vorhandene weisse Strich war jedoch nicht
vorhanden. Gegen das Fahrzeug abgeschlossen wurde der Führerstand durch die Rück-wand. Diese war ebenfalls mit einer Türe versehen worden. Fenster baute man in dieser Rückwand jedoch nur bei der Türe ein.
Diese war jedoch auch nur vorhanden, dass das
Lokomotivpersonal
die Türe beim öffnen nicht jemanden an den Kopf schlug. Daher war es auch
nicht sehr gross ausgefallen. Ein Blick durch das Fenster auf die Strecke
war aber möglich.
Unmittelbar nach dem
Führerstand
folgte der Einstieg für die Reisenden. Die offene
Plattform
war von beiden Seiten her mit einer Treppe und seitlichen Handläufen
zugänglich. Die hier verwendete Treppe war nicht so steil, wie jene für
das
Zugpersonal
und entsprach den Ausführungen von normalen
Reisezugwagen.
Das bedingte jedoch, dass im Rahmen der Platz für die benötigten Nischen
geschaffen werden musste.
Damit war jedoch auch keine
Sicherung
vor ungewollten Abstürzen vorhanden. Das Personal auf dem Fahrzeug wies
daher Reisende an, das anschliessende Abteil zu benutzen und sich während
der Fahrt nicht auf der
Plattform
aufzuhalten.
Bevor uns dem Abteil zuwenden, müssen wir ein paar Punkte zum
Thema Sicherheit betrachten. Beim
Motorwagen
gab es kaum Einrichtungen, die zum Schutz gedacht waren. Auch die nicht
den Reisenden vorbehaltenen Bereiche, wie die beiden
Führerstände, oder die
Plattformen
an der
Front,
waren leicht zugänglich. Die Türen besassen zudem ganz normale Türfallen
und konnten nicht abgeschlossen werden.
Die Abteile für die Reisenden sehen wir uns später noch genauer
an. In diesem Teil geht es um den Kasten und dessen Aufbau. Daher
betrachten wir nun die beiden Seitenwände, die sich zwischen den beiden
inneren
Plattformen
auf der ganzen Länge erstreckten. Durch diese grosse Länge mussten mehrere
Bleche verwendet werden. Die Unterteilung war anhand der Nietenbänder gut
zu erkennen. Es gab dabei eine obere und eine untere Hälfte.
Einfach gestaltete sich die untere Hälfte der Seitenwände. Diese
wurde auf beiden Seiten des Fahrzeuges identisch ausgeführt. Die hier
verbauten Bleche besassen die damals verfügbare maximale Länge. So gelang
es die Wand mit drei Segmenten aufzubauen. In diesen drei Elementen gab es
weder Öffnungen, noch auffällige Anbauten. Es handelte sich daher um den
einfachsten Teil des ganzen Fahrzeuges und entsprach den Wagen.
In der Mitte des Fahrzeuges fand sich noch Platz für ein weiteres
schmaleres Fenster. Im Gegensatz zu den anderen Modellen, konnte dieses
nicht geöffnet wer-den. Bei diesen beiden Fenstern gab es nun den Unterschied der beiden Seiten und mit diesem kann auch die Richtung definiert werden. Das in Fahrrichtung eins rechts angeordnete Fenster war mit Ausnahme des festen Einbaus nicht von den anderen Exemplaren zu unterschieden.
Auf der linken Seite wurde dieses Fenster jedoch mit einem weiss
gestrichenen Glas versehen. Daher konnte anhand dieses Fenster die
Ausrichtung definiert wer-den.
Abgedeckt wurde dieser Wagenkasten mit dem Dach. Dieses bestand
aus einer Holzverkleidung, die mit Blechen verkleidet wurde und es war
leicht gerundet. Dank dieser Wölbung konnte das Dachwasser, wie bei den
Reisezugwagen
seitlich abfliessen. An den beiden
Fronten
war das ganz gut zu erkennen. Auch die dort oft vorhanden Verlängerungen
war nicht vorhanden. Es war ein schlichtes Dach, dass beidseitig Stege für
die Wartung bekommen hatte.
Das Dach bot jedoch für das auf den äusseren
Plattformen
befindliche Personal eine grosse Gefahr. Wurde der
Stromabnehmer
heruntergerissen, konnten die Teile in den Bereich der Personen kommen und
diese schwer verletzen. Damit diese Gefahr gemildert werden konnte, wurde
auf beiden Seiten über dem
Führerstand ein Schutzbügel montiert. So erreichten die Teile
nicht mehr auf die Plattform und das sich allenfalls dort befindliche
Zugpersonal.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
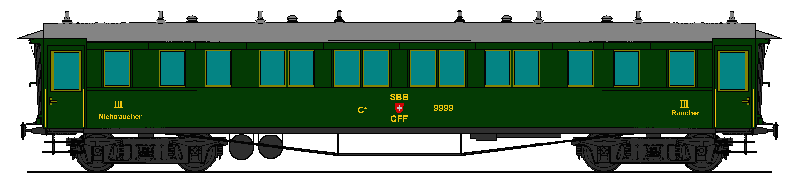 Das
begann bereits bei den damals verwendeten Einstiegen. Diese wurden damals
immer am Ende platziert. Bei den im
Das
begann bereits bei den damals verwendeten Einstiegen. Diese wurden damals
immer am Ende platziert. Bei den im
 Beidseitig
wurde der Rahmen mit der Aufnahme für die Zug- und
Beidseitig
wurde der Rahmen mit der Aufnahme für die Zug- und
 Die
Die
 Dieses
Gerüst wurde abschliessend noch mit Blechen verkleidet und so auch das
Dieses
Gerüst wurde abschliessend noch mit Blechen verkleidet und so auch das  Die
Grösste der
Die
Grösste der  Die
eigentliche Frontpartie bestand aus drei Bereichen. Dabei müssen wir jede
Wand ansehen, denn sie unterschieden sich. Ich beginne die Betrachtung mit
der zentralen
Die
eigentliche Frontpartie bestand aus drei Bereichen. Dabei müssen wir jede
Wand ansehen, denn sie unterschieden sich. Ich beginne die Betrachtung mit
der zentralen

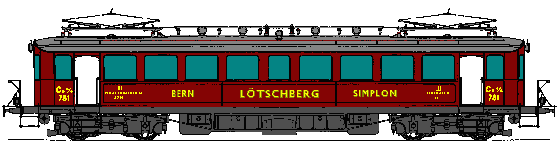 Seitliche
Türen, Ketten oder Seile, die den Zugang zu dieser
Seitliche
Türen, Ketten oder Seile, die den Zugang zu dieser  Der
obere Teil der Seitenwände war eigentlich auch auf beiden Seiten
vorhanden. Jedoch gab es einen auf-fälligen Unterschied. Nach beiden
Der
obere Teil der Seitenwände war eigentlich auch auf beiden Seiten
vorhanden. Jedoch gab es einen auf-fälligen Unterschied. Nach beiden