|
Dampfnutzung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im
Kessel
wurde der Dampf erzeugt. Es entstand dabei
Nassdampf
von etwa 200°C. Um die
Leistung
zu steigern, wurden vor Auslieferung dieser Baureihe spezielle
Dampftrockner eingebaut. Der Vorteil war, dass so deutlich weniger Wasser
in die
Zylinder
gelangten. Wasser war dort unerwünscht, da es nicht verdichtet werden
konnte. Daher war klar, dass auch hier nicht mehr mit dem Nassdampf der
älteren Modelle gearbeitet wurde.
Dieser wurde mit dem Nass-dampf aus dem Kessel ver-sorgt und leitete diesen nun in zusätzliche Rohrschleif-en, die in den Rauchrohren eingebaut wurden. Gerade diese Überhitzer-schleifen waren der Grund für die deutlich grösseren Rauchrohre. In den Schleifen des
Über-hitzers
wurde der Dampf durch die
Rauchgase
erneut erwärmt. Das führte dazu, dass das im
Nassdampf
enthaltene Wasser ebenfalls noch in den gasförmigen Zustand umgewandelt
wurde. Die Temperatur stieg nun auf 350°C an. Dieser trockene Dampf wurde
deshalb als
Heissdampf
bezeichnet. Da dieser heisse Dampf bei einem Austritt schwere
Verbrennungen verursachen konnte, wurde der
Überhitzer
mit einem Ring aus Messing am
Kamin
gekennzeichnet. Daher war dieser keine Designlösung.
Da es hier aber zwischen den einzelnen Lokomotiven Abweichungen gab, müssen wir diese gesondert ansehen und wie so oft machen die Prototypen den Anfang. Die Prototypen mit den Nummern 1301 und 1302 hatten einen Überhitzer erhalten, der über eine Heizfläche von 26.2 m2 verfügte. Zusammen mit den Siede- und
Rauchrohren,
sowie der
Feuerbüchse
konnte eine totale Heizfläche von 137.8 m2
erreicht werden. Das war mehr, als beim Muster, jedoch musste der
Kessel
für die Serie nachgebessert werden. Das hatte zur Folge, dass dort
Veränder-ungen am
Überhitzer
vorgenommen wurden. Die Schleifen des Überhitzers hatten bei den Lokomotiven mit den Nummern 1303 bis 1322 eine Fläche von 28.6m2 erhalten. Dadurch konnte hier trotz der Reduktion der Siederohre um zwei Exemplare die totale Heizfläche leicht gesteigert werden. Es wurden daher bei diesen Maschinen 140,5
m2 angegeben. Gegenüber den
beiden
Pro-totypen
eine geringe Erhöhung, die sich nicht gross auf die Produktion beim Dampf
auswirken sollte. Somit fehlen und noch die restlichen
Maschinen. Hier wurde der
Kessel
verändert. Der Grund dafür fand sich bei der Baureihe
Eb 3/5, die mit diesem Modell
versehen wurde und so der Ersatz vereinfacht wurde. Für die
Lokomotiven
mit den Nummern 1323 bis 1369 bedeutete das, dass der
Überhitzer
33.5 m2 erreichte. Die
Steigerung war eine direkte Folge der längeren
Rauchrohre.
Diese hatten auch auf die totale
Heizfläche
Auswirkungen, die 153 m2
erreichte. Im Vergleich der
Heizflächen
schnitten die
Lokomotiven
mit
Überhitzer
eher schlecht ab. Durch die hier benötigten grossen
Rauchrohre,
ging im
Kessel
mehr Fläche verloren, als mit dem Überhitzer entstanden. Zudem wirkte sich
dieser auch nicht auf die Dampfproduktion aus, denn das Wasser, das noch
im Dampf war, war ja schon im Kessel erwärmt worden und gehörte, wie die
Wassertropfen in den Wolken zum Dampf dazu. Der grosse Vorteil bei der Erhitzung des Dampfes auf
bis zu 350°C war nicht nur der geringe Anteil Wasser. Der Dampf konnte
seine Kraft deutlich besser umsetzen. Das hatte direkte Auswirkungen auf
den Verbrauch.
Lokomotiven
mit
Überhitzer
hatten daher bei identischem
Aufbau eine Einsparung bei den Betriebsstoffen von 20 bis 25% erhalten.
Das waren merkliche Einsparungen bei den Betriebskosten, die gerade bei
den
Kohlen hoch waren.
Man sprach daher von einem Zwilling. Die technische
Kennzeichnung lautete daher h2d. Nach dem
Zylinder gelangte der Dampf
schliesslich über das
Blasrohr in der
Rauchkammer. Dort wurde er stossweise
aus dem
Kamin gedrückt. Zu beachten galt bei dieser Baureihe jedoch, dass beim Beginn des Betriebes die Schlemmhähne nur noch in be-stimmten Fällen geöffnet werden durften. Der Grund lag darin, dass hier bei den geöffneten Auslässen Heissdampf ins Freie trat. So konnte sich eine allenfalls auf dem
Bahnsteig
stehende Person verbrühen. Daher wurde eine entsprechende Weis-ung
über das «Sabbern» an das
Lokomotivpersonal erlas-sen. Ein Problem, das bei
Nassdampf
kaum bekannt war. Um aus dem
Zylinder eine
Dampfmaschine zu machen,
mussten die Einlässe gesteuert werden. Dabei wurden die einzelnen Einlässe
und der Ausstoss des Dampfes mit der Hilfe von Kolbenschiebern geregelt.
Diese hatten bei den höheren Dampfdrücken eine bessere Funktion, als die
früher verwendeten Flachschieber. Zudem hatten sich auch mit dem
Heissdampf
weniger Probleme ergeben. Insbesondere die benötigten
Abdichtungen wurden stark beansprucht. Jeder
Zylinder hatte eine Bohrung von 540 mm
erhalten. Damit lag diese durchaus im Bereich der damals verbauten
Niederdruckzylindern bei den grossen Baureihen mit
Verbund. Der
Unterschied lag hier darin, dass nur Frischdampf verwendet wurde und
dieser keine zweite Entspannung erhalten sollte. Daher war die Reihe B 3/4
auch akustisch leicht von den
Schnellzugslokomotiven mit Verbund, also der
Baureihe A 3/5, zu unterscheiden.
Da die beiden
Dampfmaschinen bei der Reihe B 3/4
eine
Leistung von 990 PS, oder 730 kW, erzeugen konnten, mussten die
Kreuzgelenke bereits doppelt geführt wer-den. Sie sehen, die Technik wurde
stark beansprucht. Wichtiger als die Leistung einer Dampfmaschine war deren Kraft. Für diese Baureihe wurde ein Wert von 70 kN angegeben. Diese Kraft wurde schliesslich über den Stangenantrieb auf die Triebachsen übertragen. Mit Hilfe der
Adhäsion konnte schliesslich die erforder-liche
Zugkraft umgesetzt werden. Da jetzt das immer wieder erwähnte
Adhäsionsgewicht besonders wichtig wird, sehen wir uns dieses an, denn
auch hier gab es Unterschiede. Bedingt durch die Veränderungen bei den Kesseln, veränderte sich das effektive Gewicht der Lokomotive und somit das Adhäsionsgewicht. Bei den beiden
Prototypen mit den Nummern 1301 und 1302
wurde bei einem Gewicht von 55.5 Tonnen bei der
Adhäsion ein Gewicht von
44.7 Tonnen erreicht. Damit haben wir die leichtesten Modelle dieser Baureihe
kennen gelernt. Wobei die Steigerungen nicht so gross ausfallen sollten,
wie man meint. Bei den Nummern 1303 bis 1322 erfolgte eine leichte
Steigerung bei den Gewichten. So wurde ein Gewicht von 56.3 Tonnen
erreicht. Für das
Adhäsionsgewicht bleiben bei diesen Modellen noch 45.1
Tonnen übrig. Sie sehen, dass hier vom zusätzlichen Gewicht nur die Hälfte
der
Adhäsion zu Gute kam. Das war die Folge davon, dass der
Überhitzer
im
vorderen Teil des
Kessels eingebaut wurde und daher dieses Gewicht auf die
Laufachse drückte.
Da davon 45.6 Tonnen für die
Adhäsion genutzt werden konn-ten,
wurde auch hier der grössere Teil über die
Laufachse abgestützt. Ein
Problem damit ergab sich jedoch nicht, denn die
Zugkraft passte zum
Adhäsionsgewicht. Sollten Sie sich wundern, dass bei diesen unterschiedlichen Gewichten, bei allen Maschinen ein Gewicht von 95 Tonnen angegeben wurde, dann erfolgt die Erklärung. Die Gewichte von
Dampflokomotiven sind immer mit den Be-triebsstoffen gerechnet, daher kann
sich das Gewicht in einem grossen Bereich verändern. Stellen Sie sich vor,
der leere
Tender hatte gegenüber dem vollen Modell eine maximale Dif-ferenz
von 22 Tonnen. Da spielen ein paar Kilogramm keine grosse Rolle. Wir
können jedoch feststellen, dass es genau genommen zwischen den Modellen
eine Differenz gab. Diese wirkte sich jedoch nicht auf die
Anhängelasten
aus und so kann dieses Gewicht be-ruhigt ignoriert werden. Was wir jedoch
nicht ignorieren können, sind die erreichten
Normallasten. Daher müssen
wir uns diese etwas genauer ansehen, und daher gab es drei Werte. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB definierten
immer drei Werte. Das war die Fahrt auf dem ebenen
Gleis und in Steigungen
von 10‰. Das waren die Vorgaben für die meisten Strecken im
Flachland.
Für Fahrten auf den steilen Strecken wurde der Wert auf 27‰ ausgelegt.
Diese drei Steigungen wollen wir uns ansehen und dabei gab es spezielle
Regeln zu beachten. Doch beginnen wir mit dem ebenen Gleis, das den
maximalen Wert ergab.
Im Vergleich zu den
Schnellzugslokomotiven waren das jedoch höhere Werte. Jedoch sank hier die
Geschwindigkeit auf einen deutlich tieferen Wert. Ein Punkt der besonders
bei Dampflokomotiven beachtet werden musste. Das zeigte sich deutlich bei den Werten für den Gotthard, denn hier galten 165 Tonnen als Normallast für die Reihe B 3/4. Im Vergleich mit der Baureihe A 3/5 der Gotthardbahn waren das sogar 15 Tonnen mehr. Jedoch blieb die kleinere Maschine bei der gefahrenen
Geschwindigkeit deutlich unter den Modellen für die
Schnellzüge. Aus
diesem Grund trugen die
Schnellzugslokomotiven auch die Bezeichnung und es
wurden gigantische
Leistungen installiert. Jetzt kommt jedoch der spezielle Passus zur Anwendung. Die oben erwähnten Werte durften nur mit Güterzügen gezogen werden. Bei Reisezügen wurde die Normallast im ebenen Gleis auf 400 Tonnen beschränkt. Bei 10‰ Steigung waren jetzt noch 350 Tonnen zugelassen. Auf
den steilen
Rampen der
Gotthardbahn, blieben die Werte jedoch gleich,
wobei dort aber ganz klar nicht das Tempo der Reihe
A 3/5 gefahren werden
konnte. Die Reduktion der Normallasten bei Reisezügen hatte zwei Gründe. Diese Züge sollten schneller verkehren können, als die Güterzüge. Zudem wurden bei den Zügen mit Person-enbeförderung noch zusätzliche Verbraucher an den Dampf angeschlossen. Insbesondere während
der kalten Jahreszeit ging ein Teil des erzeugten Dampfes, an die
Zugsheizung verloren. Dank den geringeren
Normallasten sollten sich keine
Probleme mit dem
Fahrplan geben. Für die Zugsheizung wurde der Dampf direkt aus dem Kessel entnommen. Um die Reise-zugwagen zu heizen, reichte die Temperatur des Nassdampfes ohne Probleme. Mit Heissdampf wären die Heizelemente in den Abteilen schlicht zu heiss geworden.
Heissdampf
hätte die Leute gefährden können.
Sie müssen bedenken, dass unmittelbar nach der
Lokomotive
durchaus noch
Werte von über 350°C vorhanden gewesen wären. So aber wirkte der
Überhitzer
nur auf die
Dampfmaschine. Jedoch musste der Dampf den Weg zu den Wagen und in
dessen Abteile finden. Dazu wurde auf der
Lokomotive
die Leitung für die
Dampfheizung verlegt. In dieser war ein
Regulator vorhanden. Damit konnte
die
Zugsheizung einfach ein- oder ausgeschaltet werden. Das war je nach
Jahreszeit der Fall. Meist wurde in diesen Fällen das
Lokomotivpersonal
verständigt, da die Leitung ja noch mit den Wagen verbunden werden musste. An jedem
Stossbalken waren entsprechende Anschlüsse
vorhanden. Dabei war der Anschluss am
Tender jedoch spannender. Dieser
hatte gegenüber der anderen Seite eine tiefere Temperatur. Der Grund lag
darin, dass mit der
Dampfheizung auch das Wasser im
Wasserkasten leicht
erwärmt wurde. So gefror es weniger und dank dem warmen Speisewasser fiel
die Produktion des Dampfes nicht so schnell zusammen, wie wenn kalten
Wasser benutzt wurde. Die Anschlüsse der
Dampfheizung waren nicht komplett
abgedichtet. So entwich immer etwas Dampf. So wurde verhindert, dass sich
in der Leitung Wasser bilden konnte. Besonders im Winter hätte dieses in
der Leitung gefrieren können und die
Heizung wäre ausgefallen. Im Betrieb
entwich der Dampf beim letzten Wagen und so konnte sich dank der
dauerhaften Zufuhr von frischem Dampf kein Eis in den Leitungen bilden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
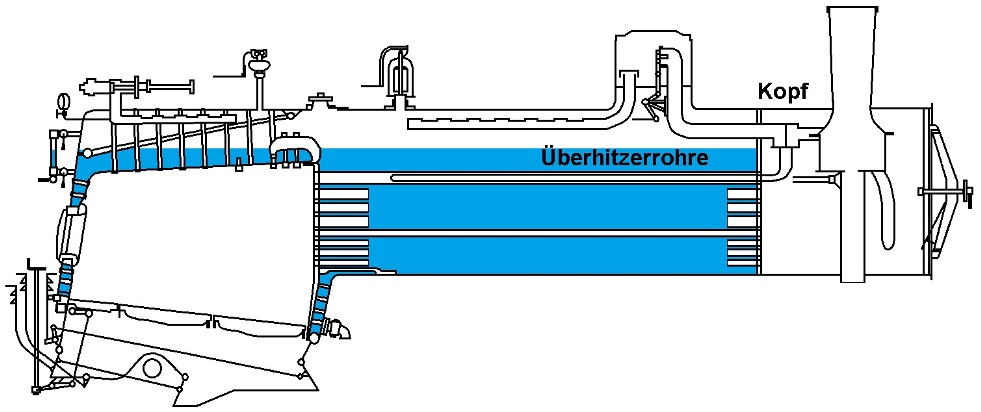 Bei
der Baureihe B 3/4 wur-de erstmals in der Schweiz ein
Bei
der Baureihe B 3/4 wur-de erstmals in der Schweiz ein
 Im
Gegensatz zu den Dampftrocknern gehörten die Schleifen des
Im
Gegensatz zu den Dampftrocknern gehörten die Schleifen des
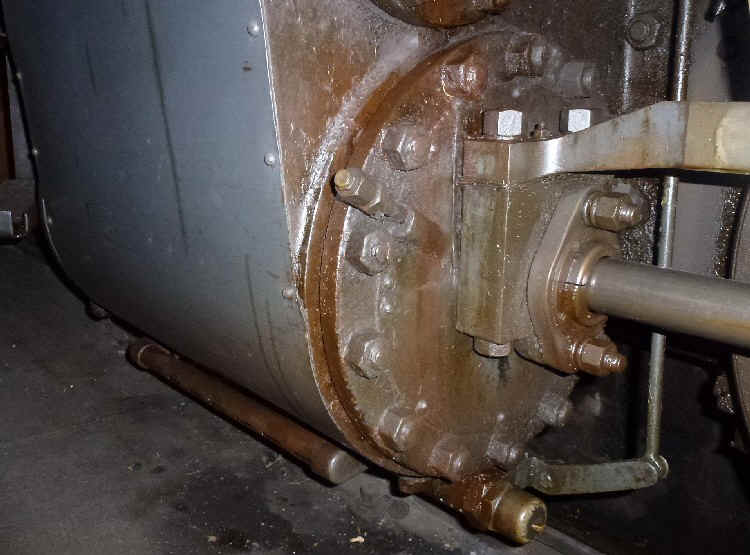 Nach dem
Nach dem
 Der Kolbenhub betrug 600 mm. In diesem Punt gab es
bei den Maschinen keine grossen Unterschiede, denn der Kolbenhub entsprach
den Kurbelkreis und je grösser dieser war, desto stärker wurde das
Der Kolbenhub betrug 600 mm. In diesem Punt gab es
bei den Maschinen keine grossen Unterschiede, denn der Kolbenhub entsprach
den Kurbelkreis und je grösser dieser war, desto stärker wurde das
 Die grössten Lasten verbuchten jedoch die Maschinen
mit den Nummern 1323 bis 1369. Hier wurde bekanntlich der
Die grössten Lasten verbuchten jedoch die Maschinen
mit den Nummern 1323 bis 1369. Hier wurde bekanntlich der
 Auf dem ebenen
Auf dem ebenen