|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die beiden
Lokomotiven
wurden im Laufe ihres Lebens verändert. So wurden viele Punkte korrigiert,
die bei der Auslieferung nicht vorhanden waren. Es gab jedoch auch viele
Veränderungen, die sich aus dem Betrieb ergeben haben. Betroffen von den
Anpassungen waren jedoch nicht die beiden
Dampfmaschinen
und der
Kessel.
Diese wurden belassen, auch wenn sich optisch einige Punkte veränderten
und so das Aussehen der beiden Lokomotiven.
Das Personal war mit den vielen grossen
Öffnungen nicht glücklich. Es war ausgesprochen zugig auf den kleinen
Maschinen, was bei kälteren Tagen un-angenehm war. Bei Regen war der
Bediener schnell nass, was auch nicht angenehm war. Zur Verbesserung der Situation wurde die Front-wand verändert. Die sehr grosse Öffnung wurde verschlossen. An deren Stelle wurden beidseitig vom Kessel zwei identische Frontfenster eingebaut. Diese konnten vom
Lokomotivpersonal
an heissen Tagen sogar geöffnet werden. Ein Punkt, der bei
Dampflokomotiven oft so gelöst wurde, weil im
Führerhaus
wegen der dort angeordneten
Feuer-büchse
immer viel Wärme vorhanden war. Ein weiteres Problem waren die beiden Seiten-wände und das Dach. Regnete es, tropfte das Was-ser genau auf den Rand der Öffnung und spritzte dann in den Bereich des Lokführers. Für den Bediener war das natürlich
unangenehm und der Boden aus
Holz
begann früh zu faulen. Um diesen Punkt zu verbessern, wurde die Seite
verschlossen. Lediglich im Bereich des Aufstieges blieb die Öffnung weiter
bestehen. So entstand ein ganz normales
Führerhaus,
das auch über ein verändertes Dach verfügte. So stand dieses auf den
Seiten nun etwas weiter von der Seitenwand ab. Das führte dazu, dass das
Dachwasser nun fei auf den Boden tropfen konnte. Im Führerhaus wurde es
nun trockner, was den am Boden verlegten Holzbalken und dem
Lokomotivpersonal
gefiel. Unverändert blieb die Rückwand, da über diese die
Kohlen
verladen wurden.
Doch mit dem
Führerhaus
war es nicht getan, denn es gab noch viele Punkte, die nicht optimal
gelöst wur-den. Mit den Einnahmen durch den Betrieb, konnte die
Gotthardbahn diese Fehler ohne Probleme beheben, und das zu
Gunsten des Personals. Auch die bei der Auslieferung fehlenden Hilfstritte beim Stossbalken ergänzte die Gotthardbahn. So war es nun dem Personal leichter möglich zur Rauch-kammer und zu den Aufbauten im Bereich des Kessels zu gelangen. Das von der Auslieferung her bekannte
Geländer blieb jedoch erhalten. Die Baureihe mutierte so zu einer normalen
kleinen
Lokomotive
und die Sparmassnah-men während dem Bau waren nicht mehr zu sehen. Nahezu unverändert blieb das
Laufwerk
der
Lokomo-tive.
Jedoch zeigte der Betrieb, dass es immer wieder zu Problemen mit der
Adhäsion
kam. Insbesondere bei einem schlechten Zustand der
Schienen
und bei hohen
Zugkräften
neigte die leichte Lokomotive dazu zu hüpfen. Die
Räder
drehten wegen der geringen
Achslast
frei durch und das fühlte sich an, wie wenn die Maschine springen würde.
Die Last musste verringert werden, was den Betrieb behinderte. Um die
Adhäsion
der
Lokomotiven zu verbessern, wurde eine
Sandstreueinrichtung
verbaut. Dazu war auf dem
Kessel
unmittelbar vor dem
Führerhaus
ein Sandkasten montiert worden. Wie bei den anderen Dampflokomotiven der
Gotthardbahn wurde dieser mit
Quarzsand
befüllt. Von dort konnte der Sand mit Hilfe der Schwerkraft vor die
hinteren
Triebräder
gestreut werden. Eine einfache Einrichtung, die vom Bediener bei Bedarf
aktiviert werden konnte.
Jedoch muss gesagt werden, dass die
Maschinen wirklich sehr klein geraten waren und da musste man auch den
Platz für neue Sachen finden. Gerade die
Sander
benötigten damals sehr viel Platz um den
Kessel. Verändert wurde auch der vorhandene Anstrich. Wegen den erwähnten Umbauten am Führerhaus musste dieser erneuert werden. Das seinerzeit verwendete Schema der Schweizerischen Centralbahn SCB verschwand. Die beiden Modelle wurden nun nach den
Regeln der
Gotthardbahn eingefärbt und das bedeutete, dass die grünen Farben
verschwanden und das in der Schweiz sehr bekannte schwarze Farbkleid
verwendet wurde. Auch die Anschriften an den beiden
Stossbalken
wurden aufgegeben. Die bisher noch vorhandenen Bahnanschriften
verschwanden gänzlich. Die
Gotthardbahn war dafür bekannt, dass sie die
Lokomotiven
nicht beschriftete. Eine Tradition, die später von den
Staatsbahnen
viele Jahren weiter verfolgt wurde. Man wusste auch so, wem die Lokomotive
gehört, denn diese fuhren selten über die Grenzen der
Privatbahnen. Weiter angebracht werden musste aber die
Betriebsnummer. Diese war bisher am
Stossbalken
angebracht worden. Neu wurde sie an der neuen Seitenwand des
Führerhauses
angebracht. Dazu wurden aufgesetzte Ziffern, wie das bei anderen Baureihen
auch der Fall war, verwendet. Die Maschinen der Reihe AI wurden den
anderen Baureihen angepasst und auch die Bezeichnung sollte keine lange
Dauer haben.
Zumindest wusste man nun, dass zwei
Triebachsen
vorhanden war und es sich um eine
Rangierlokomotive
handelte. Die speziellen Punkte waren also immer noch nicht erwähnt
worden. Es war daher deutlich zu erkennen, dass die beiden Maschinen kaum für andere Aufgaben verwendet werden konnten, als für den leichten Rangierdienst. Auch dort waren die Lokomotiven dem Verkehr der Gotthardbahn kaum gewachsen. Die aus den Anfängen stammenden Maschinen
sahen nun nach ganz normalen
Tenderlokomotiven
für den
Rangierdienst
aus, aber die bescheidene
Leistung
von 75 PS war wirklich zu gering. Gerade der dichte Verkehr auf der
Gotthardbahn war wegen den
starken Gefällen
sehr personalintensiv. Insbesondere die
Reisezüge
mussten mit vielen
Bremsern
bestückt werden. Nur so konnten die höheren Geschwindigkeiten auch
gefahren werden. Aus diesem Grund begannen die ersten Versuche mit neuen
Lösungen für die
Bremsen.
So sehr es Sie als Leser überraschen mag, die Reihe F2 war davon voll
betroffen. Im Jahre 1887 wurde bei der
Gotthardbahn als erster Versuch die
Vakuumbremse
eingeführt. Damit die bei dieser
Bremse
im Normalfall angezogenen Wagen bewegt werden konnte, wurde diese Bremse
auch auf den beiden
Lokomotiven
eingebaut. Dazu kam, dass diese auch die
Klotzbremse
der Lokomotive bewegen konnte. So musste nur eine Bremse benutzt werden
und die Bedienung der Maschinen war immer noch einfach.
Auf der Gotthardbahn sollten ab dem Jahr 1888 die ersten Züge mit der aus Amerika stammenden Westinghouse-bremse geführt werden. Diese
Bremse
arbeitete mit
Druckluft
und erlaubte es auch die Wagen unge-bremst zu bewegen. Dazu musste
ein-fach die Einrichtung im Fahrzeug ent-lüftet werden. Um auch die Eignung dieser Druckluft-bremse im Rangierdienst zu erproben, wurden die Rangierlokomotiven mit dieser Bremse versehen. Die beiden F2 waren davon natürlich auch
betroffen. Neben dem kleinen
Kessel
wurde dazu rechts an der
Rauchkammer
eine
Luftpumpe
montiert. Diese war nahezu so gross, wie der Kessel, der sie mit Dampf
versorgen musste. Wenn noch gefahren wurde, war der Druck schnell ein
Problem. Damit die
Luftpumpe
nicht dauerhaft arbeiten musste, wurde ein Druckluftbehälter benötigt. Im
doch sehr gut gefüllten Rahmen war schlicht kein Platz mehr zu finden.
Daher wurde der Druckluftkessel unter dem vorderen
Stossbalken
quer zu Fahrrichtung eingebaut. Er war gut zu erkennen und es sah fast so
aus, als führe die kleine
Lokomotive
ein Fässchen mit. Da damals der entsprechende Hund noch nicht bekannt war,
nannte man sie nicht Bernhardiner. Weiter wurden diverse Leitungen verlegt. So
musste die neue
Hauptleitung
zu den
Stossbalken
geführt werden. Im
Führerhaus
waren dann die Bedienelemente vorhanden. Dabei kam auch die
Regulierbremse
für die
Lokomotive
zum Einbau. Die Wagen wurden im
Rangierdienst
jedoch nur mit der indirekten
Westinghousebremse
betrieben. Schliesslich standen in einem
Bahnhof
keine längeren Fahrten in einem Gefälle an. Verändert wurden auch die akustischen
Signalmittel. Die
Lokpfeife
wurde auf den
Dampfdom
verschoben und die Bedienung beibehalten. Neu war jedoch die an der
bisherigen Stelle eingebaute Glocke. Mit dieser konnten auch die noch
gültigen Glockensignale mit der
Lokomotive
gegeben werden. Sehr speziell, da sonst bei den
Triebfahrzeugen
in der Schweiz auf die Montage von Glocken verzichtet wurde. Die F2 war
eine Ausnahme.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wenn
wir dem Aufbau der
Wenn
wir dem Aufbau der  Die
mühsame Verladung der
Die
mühsame Verladung der
 Speziell
war, dass diese
Speziell
war, dass diese
 Mit
den ersten vereinheitlichen Lösungen für die Bezeich-nungen in der Schweiz
mutierten die bisher als AI be-zeichneten Maschinen. Daher wurde nun von
der Bau-reihe F2 gesprochen. Eine Angabe, die nicht viel mehr
Informationen enthielt.
Mit
den ersten vereinheitlichen Lösungen für die Bezeich-nungen in der Schweiz
mutierten die bisher als AI be-zeichneten Maschinen. Daher wurde nun von
der Bau-reihe F2 gesprochen. Eine Angabe, die nicht viel mehr
Informationen enthielt.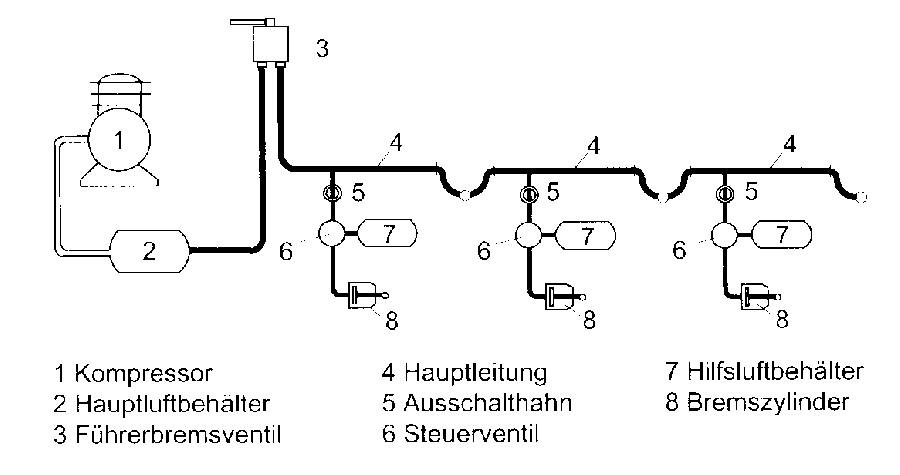 Da
die Erfahrungen mit der
Da
die Erfahrungen mit der