|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im
Pflichtenheft,
das von der
Gotthardbahn erarbeitet wurde, war nicht nur eine kostengünstige
Lokomotive
verlangt worden. Auch Hinweise zur Bedienung dieser Maschinen waren
enthalten. So sollte eine einfache Bedienung vorhanden sein, die den
Aufwand für die Schulung des Personals verringerte. Noch wusste man ja
nicht, wie sich der Betrieb entwickeln könnte und da wurde für weitere
Sparmassnahmen geplant.
Diese fing bereits im Depot und dort mit der kalten Maschine an. Mit anderen Worten, es war eine Vorbereitung für den Dienst erforderlich. Die jedoch nur erfolgte, wenn die
Loko-motive
im Unterhalt war. In den anderen Fällen wurde eine Abstellung unter Dampf
vorgesehen. Um die Lokomotive in einem Depot auf den Betrieb vorzubereiten, war nicht im-mer das Lokomotivpersonal erforderlich. Der Standort beschäftigte Leute, die sich um die Schmierung kümmerten und An-gestellte, die ein Kessel in Betrieb neh-men durften. Diese speziellen
Heizer
konnten dabei mehrere Maschinen gleichzeitig betreu-en, was der Besatzung
der
Lokomotive
nicht möglich war. Daher konnte bereits so auf teures Personal verzichtet
wer-den. Die Zeit bis der
Kessel
dieser Baureihe den für den Betrieb erforderlichen Druck hatte, war sehr
kurz. Nachdem das Feuer angefacht wurde, wirkte die natürliche Strömung
der Luft. Sobald aber im Kessel ein geringer Druck vorhanden war, konnte
der
Hilfsbläser
aktiviert werden. So wurde der Abdampf simuliert und das Feuer zusätzlich
angefacht. Die Dampfproduktion wurde dadurch beschleunigt, was die Zeit
verkürzte. Der
Hilfsbläser
wurde auch im Betrieb eingesetzt. Besonders bei
Lokomotiven,
die im
Rangierdienst
tätig waren, kam es immer wieder zu längeren Stillständen. Da nun die
Dampfmaschinen
nicht liefen, war es schwer, den erforderlich Druck nach einer Einspeisung
schnell wieder zu erzeugen. Dank dem Hilfsbläser konnte das jedoch
schneller erfolgen. So war immer eine optimal einsatzbereite Maschine
vorhanden.
Das war bei Dampflokomotiven in der Schweiz
jedoch speziell geregelt worden, denn die
Karbidlampen
für die
Beleuchtung
gehörten nicht zur Maschine, sondern sie mussten vor der Fahrt bei der
Lampisterie
bezogen werden. Die Lampen konnten einfach auf speziellen Halterungen aufgesteckt werden. Jedoch wurden die Flammen nicht immer angefacht. Die Lampen signalisierten auch so, dass die Lokomotive bereit war. Wobei gerade im
Rangierdienst
die Disziplin mit den Lampen gering war. Es war also durchaus möglich,
dass an Stelle der
Karbidlampe
nur eine entsprechende Signalscheibe aufgesteckt wurde und so die
Bereitschaft geregelt war. Angefacht wurden die Karbidlampen nur während der Nacht. Damit war die Lokomotive in den spärlich ausgeleuchteten Anlagen besser zu erkennen. Besonders dann, wenn sie gefahren kam. Das Licht reichte aber kaum aus um den
Bereich vor der
Lokomotive
ausreichend zu erhellen. Das nun verbrauchte
Kalziumkarbid
wurde nach dem Einsatz in der
Lampisterie
wieder auf-gefüllt. Daher mussten die Lampen wieder abgenommen werden. Sollten Sie vorher beim Lokomotivpersonal den Heizer vermisst haben, war das kein Fehler, denn diesen gab es hier nicht. Die Versorgung des Feuers konnte durch den Lokführer erfolgen. Die entsprechenden Fähigkeiten hatte er und
gerade im Bereich des
Rangierdienstes
waren immer wieder kurze Stillstände vorhanden, bei denen nach dem Feuer
gesehen werden konnte. Auch die
Nachspeisung
wurde dann aktiviert. Die von der Gotthardbahn erhoffte Vereinfachung bei der Besatzung war also vorhanden. Daher lassen wir nun den Lokführer in das Führerhaus steigen. Dort fand er für den Betrieb alle erforderlichen Materialen und Bedienelemente vor. Gerade die Verladung der 400 Kilogramm
Kohlen
war durch das Depot
erfolgt, da hier nicht die üblichen Anlagen genutzt werden konnten. Der
kleine Haufen Kohle schränkte den Platz jedoch ein. Bevor wir losfahren, sehen wir uns schnell
im recht offenen
Führerhaus
um. Um den
Kessel
waren die Bedienelemente für diesen selbst und die Steuerung vorhanden.
Einige Anzeigen waren jedoch auch vorhanden. Diese zeigten dem Lokführer
den Wasserstand im Kessel an. Eine wichtige Anzeige, die angab, wann der
Regulator
zum
Injektor
aktiviert werden musste. Auch dieser Regler war im Bereich des Kessels
angeordnet worden. Neben diesen Anzeigen und Bedienelementen,
war auch noch der Hebel für den
Regulator
beim
Dampfdom
und die
Zugstange
für die
Lokpfeife
vorhanden. Abgeschlossen wurden diese bescheiden vorhandenen
Bedienelemente noch mit dem
Exterhebel
für die
Bremse
der
Lokomotive.
Dieser war nun in der Stellung, die eine
Bremsung
zur Folge hatte. Wir haben aber unsere Betrachtung noch nicht
abgeschlossen. Unmittelbar über dem mit Holzplanken
belegten Boden des
Führerstandes,
befand sich die Türe zur
Feuerbüchse.
Diese war in der Regel verschlossen und wurde nur geöffnet, wenn
Kohlen
nachgelegt werden mussten. Da kein
Heizer
vorhanden war, musste der Lokführer daher noch das Feuer kontrollieren und
allenfalls noch ein paar Schaufeln Kohlen in die Feuerbüchse werfen. Damit
war die Maschine aber bereits fahrbereit.
Damit nahm die Dampfmaschine ihre Arbeit auf und der Exterhebel konnte in die gelöste Stellung ver-bracht werden. Dank dieser Lösung mit der auch als
Wurfhebel-bremse
bezeichneten Lösung, war die
Bremse
der Maschine schnell gelöst. Je mehr der Regulator geöffnet wurde, desto grösser war die Zugkraft. Es oblag der Erfahrung des Lok-führers, wie stark der Griff gezogen wurde. Musste viel Last mitgeführt werden, war der Regulator voll geöffnet. Dabei müssen wir bedenken, dass in
Bahnhöfen
bis zu 240 Tonnen zugelassen waren und dass die Ein-haltung im
Rangierdienst
nicht immer erfolgte. Kam die Maschine nicht vom Fleck, musste aber
abge-hängt werden. Wie schnell gefahren wurde, konnte nicht
abgelesen werden. Damals waren bei den
Lokomotiven
in der Schweiz noch keine Anzeigen für die Geschwindigkeit vorhanden. Der
Lokführer musste daher zusehen, dass er die
Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h nicht überschritt. Was im
Rangierdienst
selten der Fall war und auch mit Zug erreichte die Lokomotive diese
maximale Geschwindigkeit oft auch nur mit Rückenwind und einem Gefälle. Um mit der
Lokomotive
anzuhalten, wurde der
Regulator
geschlossen und mit der anderen Hand der
Exterhebel
umgeworfen. Danach konnte mit aller Kraft der Hebel nach unten gedrückt
werden. Je kräftiger der Lokführer den Exterhebel gegen den Boden drückte,
desto kräftiger fiel die
Bremsung
der Lokomotive aus. Erst im Stillstand wurde der Hebel losgelassen und die
Bremsung reichte für den Stillstand aus.
Die Forderungen der
Gotthardbahn waren in diesem Punkt daher auch erfüllt worden.
Aufwendig war die Arbeit jedoch nur, wenn die Maschine ins Depot
fuhr. Das bedeutete, dass der Aschekasten geleert werden musste. Dazu konnte dieser entriegelt werden und der Inhalt fiel in die dazu vorgesehene Grube. Gleich-zeitig stand auch die Reinigung der Rauchkammer an. Bevor das möglich war, musste das Werkzeug
auf das Umlaufblech gelegt werden. Anschliessend stand dann die
Kletterpartie an und das Öffnen der
Rauchkammertüre
erfolgte durch lösen der Riegel. Falls in der
Feuerbüchse
noch ein Feuer war, füllte sich die Kammer augenblicklich mit Rauch, was
die Arbeit nicht begünstigte. Arbeit die darin bestand, die sich am Boden
der
Rauchkammer
befindliche
Lösche
zu entfernen. Das erfolgte mit einer Schaufel und auch dieses Material
verschwand nun vor der
Lokomotive
in der Grube, die daher auch als
Schlackengrube
bezeichnet wurde und die es damals in jedem Depot
gab. Sollte die
Lokomotive
in den Unterhalt, wurde auch das Feuer entfernt. Die noch immer
vorhandenen heissen Metalle im Bereich der
Feuerbüchse
erzeugten noch genug Dampf, dass die Lokomotive aus eigener Kraft in die
Remise
fahren konnte. Damit sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben, denn wie
schon erwähnt, das Feuer erlosch nur, wenn die Maschine dem Unterhalt
zugeführt werden musste. Das bedeutet
Feierabend.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bevor
wir etwas genauer auf die Be-dienung eingehen, noch ein paar weitere und
nicht unwichtige Hinweise zur Be-handlung einer Dampflokomotive.
Bevor
wir etwas genauer auf die Be-dienung eingehen, noch ein paar weitere und
nicht unwichtige Hinweise zur Be-handlung einer Dampflokomotive.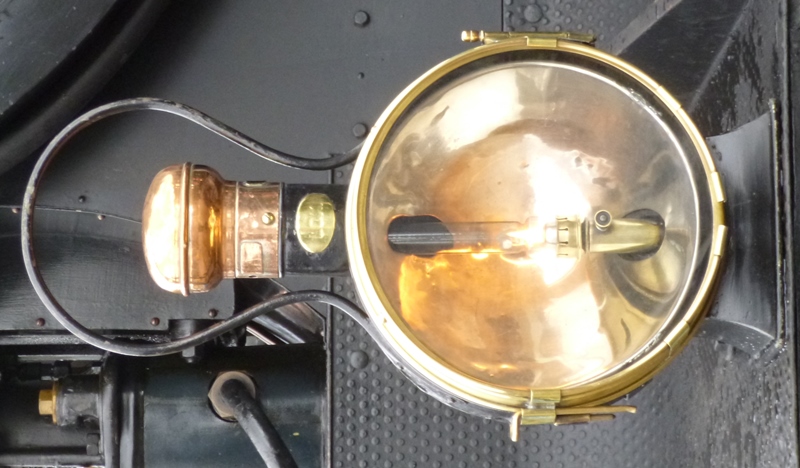 Es
wird nun Zeit, dass wir das Fahrpersonal zur
Es
wird nun Zeit, dass wir das Fahrpersonal zur
 Konnte
die Fahrt begonnen werden, verlegte der Lokführer den Hebel für die
Steuerung in die ge-wünschte Fahrrichtung. Dann betätigte er den
Be-dienhebel für den
Konnte
die Fahrt begonnen werden, verlegte der Lokführer den Hebel für die
Steuerung in die ge-wünschte Fahrrichtung. Dann betätigte er den
Be-dienhebel für den
 Sollte
nun in einer andere Richtung gefahren wer-den, wurde die Steuerung
umgestellt und die vorher beschriebenen Handlungen wiederholt. Es war
wirk-lich sehr einfach diese
Sollte
nun in einer andere Richtung gefahren wer-den, wurde die Steuerung
umgestellt und die vorher beschriebenen Handlungen wiederholt. Es war
wirk-lich sehr einfach diese